sondern was wir über die Dinge denken.
Epiktet
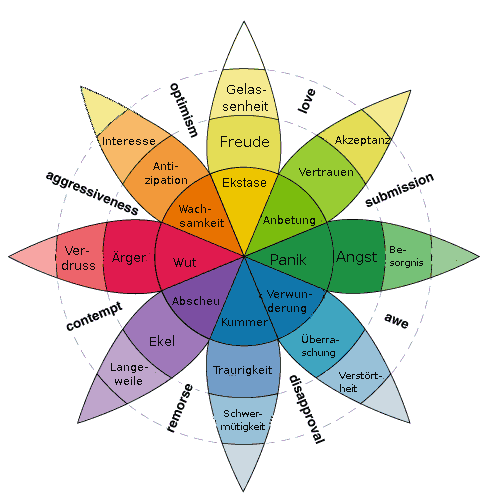 Die menschlichen Emotionen
Die menschlichen Emotionen
Emotionen sind komplexe, in weiten Teilen genetisch präformierte
Verhaltensmuster, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben,
um bestimmte Anpassungsprobleme zu lösen und dem Individuum ein
schnelles und der Situation adäquates Handeln zu ermöglichen.
Die Mechanismen hinter den Emotionen sind dabei vom Fisch bis zum
Menschen weitgehend gleichgeblieben. Am Zustandekommen und Ablauf
emotionaler Vorgänge sind daher sowohl kognitive (kortikale und
subkortikale) Mechanismen der Verarbeitung externer oder interner Reize,
neurophysiologische Muster, motorischer Ausdruck und
Motivationstendenzen beteiligt. Die kognitive Komponente wird dabei
meist als Auslöser von Emotionen angesehen, die motivationale Komponente
eher als Folge der emotionalen Erregung denn als Teil der Emotion
selbst betrachtet, aber es bestehen wie bei den meisten innerpsychischen
Abläufen sehr enge Wechselwirkungen.
Diese stammesgeschichtliche Betrachtung der Entwicklung von Emotionen stellt also die Frage nach ihrem Zweck bzw. ihrer biologischen Funktion. Schon Darwin ging es darum, seine Evolutionstheorie durch die Beobachtungen von Parallelen im emotionalen Ausdruck bei Menschen und Tieren zu stützen. Er folgerte auf Grund der Beobachtung von Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, dass der emotionsspezifische Ausdruck universell verbreitet ist (vgl. Franken 2004). Nach Stangl (1989) stellen Emotionen stammesgeschichtlich ältere und ursprüngliche Formen von Kognitionen dar.
Das Stirnhirn, also der präfrontale Cortex ist jene Instanz, die die aus tieferen Schichten aufkommenden Emotionen integriert und zumindest teilweise kontrolliert. Emotionen bewirken dabei organische Veränderungen, wie erhöhten Hautwiderstand, Muskelverspannung, Verkrampfung, Erweiterung oder Verengung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, Magen- und Darmtätigkeit, schnelle Atmung und erhöhte Herzfrequenz. Die Atmung ist aber nicht nur für die Sauerstoffzufuhr überlebenswichtig, sondern wirkt sich nach neueren Untersuchungen (Zelano et al., 2016) auch auf die Gehirnfunktionen aus. Probanden, denen man in schneller Abfolge Bilder von Gesichtern, die entweder Überraschung oder Angst ausdrückten, zeigte, konnten die angstvollen Gesichter schneller erkennen, wenn sie das Foto während des Einatmens gesehen hatten als während des Ausatmens. Die Gesichter, die Überraschung zeigten, wurde in beiden Fällen gleichermaßen gut erkannt. Auch zeigte sich dieser Effekt nur, wenn die Probanden durch die Nase geatmet hatten, denn beim Atmen durch den Mund unterschieden sich Ein- und Ausatmen nicht. Offensichtlich gibt es beim Einatmen im Vergleich zum Ausatmen einen Unterschied in der Hirnaktivität, denn atmet man durch die Nase ein, werden Neuronen im limbischen System stimuliert, vor allem in der Amygdala und im Hippocampus. Evolutionär betrachtet macht das Sinn, denn wenn sich Menschen in Angst oder Panik befinden, wird ihr Atemrhythmus schneller und man atmet mehr ein als im ruhigen Zustand. Diese angeborene Reaktion auf Angst kann in einer gefährlichen Situation von Vorteil sein, denn sie wirkt sich positiv auf die Hirnfunktion aus, indem man Signale, die auf Gefahr hindeuten, schneller erkennt.
Die Psychologie als Wissenschaft hat sich lange vor allem mit den negativen Emotionen und deren Wirkungen beschäftigt. Emotionen sind nach der Qualität ihrer Zuständigkeit charakterisierte subjektive Erlebnisse, die meist als Gegenpol zur Kognition durch verschiedene Dimensionen beschrieben werden können: Richtung (angenehm oder unangenehm), Qualität (Erlebnisinhalt bzw. Aufmerksamkeit oder Ablehnung), Ausmaß der Aktivierung und das Bewusstsein. Die Stärke beschreibt, wie sehr die Person erregt ist und wie intensiv das Gefühl aktivierend auf Denken und Handeln einwirkt. C. E. Izard (1981) nennt drei Verhaltensebenen, um Emotionen zu beschreiben und zu definieren: das subjektive Erlebnis, die neurophysiologischen Vorgänge und das beobachtbare Ausdrucksverhalten. Sie nimmt an, dass Emotionen eine körperliche, eine psychische und eine verhaltenssteuernde Komponente besitzen.
Gefühle wie Angst oder Wohlbefinden kennt das Baby schon vor der Geburt, denn es hat bereits vor der Geburt gelernt zu strampeln, sich zu drehen und zu wenden und an seinem Daumen zu lutschen. Es kennt aber nicht nur seinen Körper, sondern hat schon eine ganze Reihe Erfahrungen über die Welt draußen gemacht und in seinem Gehirn verankert: Es kennt die Stimme der Mutter und des Vaters, ihre Lieblingslieder und Lieblingsmusik und weiß, wie die Mutter riecht, da die Duftstoffe und Aromen auch im Fruchtwasser enthalten waren. Ein Ungeborenes kann auch Erfahrungen im Mutterleib machen, die es später anfällig für Angst machen: Wenn die Mutter Angst vor dem Vater hat, spürt der Fötus das, denn ihre Bauchdecke zieht sich während eines Streits zusammen, Stresshormone werden ausgeschüttet, das Herz rast. Dabei wird das Kind zusammengedrückt, hört es die schnellen Herztöne und die laute Stimme des Vaters. Der Fötus erstarrt und diese Erfahrung wird im Gehirn gespeichert. Nach der Geburt verfällt das Kind in eine ähnliche Erstarrung, wenn die Stimme des Vaters eine ähnliche Färbung annimmt.
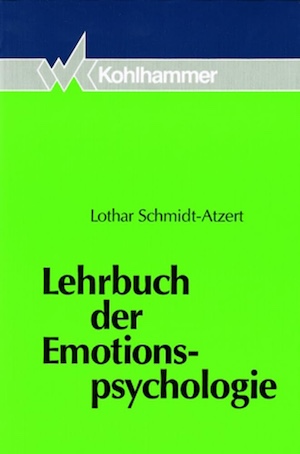
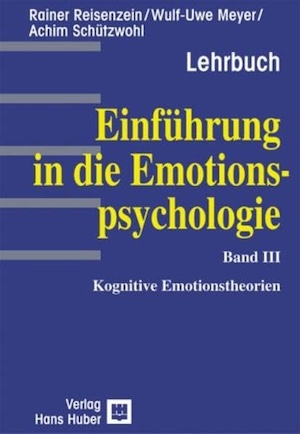
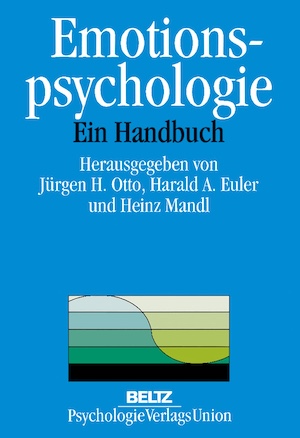 Vor
etwa 50 Jahren entdeckte man bei Experimenten mit Ratten zufällig, dass
diese von der elektrischen Stimulation eines bestimmten Gehirnareals
gar nicht genug bekommen konnten. Die Ratten durften in diesen
Experimenten diesen elektrischen Reiz für diese Gehirnregion durch
Drücken auf einen Hebel selbst auslösen und drückten in der Folge den
Hebel immer häufiger. Manche Tiere vergaßen dabei sogar zu essen und zu
trinken, und starben, offensichtlich süchtig danach, durch das
Hebeldrücken belohnt zu werden. Die daraus entstandene Neurobiologie des Glücks
hat in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends große Fortschritte
gemacht, sodass man die neuronalen Strukturen ziemlich genau kennt, die
an diesen Glückserlebnissen beteiligt sind: tief im Mittelhirn liegt
eine kleine Ansammlung von Neuronen - im Fachjargon als A10 bezeichnet
-, die den Botenstoff Dopamin produzieren und in den Nucleus accumbens
und ins Frontalhirn weiterleiten. Diese Neuronen feuern immer dann,
wenn ein Ereignis besser ausfällt als erwartet. Im Nucleus accumbens
führt das Dopamin dazu, dass Endorphine produziert und ins Frontalhirn
ausgeschüttet werden. Dieses Dopamin bewirkt, dass das Frontalhirn
besser funktioniert, sodass man unter diesem Einfluss z.B. auch besser
denken und lernen kann. Das Glücksempfinden ist vermutlich nur ein
Nebenprodukt des menschlichen Lernvermögens und ist auch nicht auf
"Dauerbetrieb" angelegt, denn Gewöhnung sorgt schon bald dafür, dass man
sich nicht allzu lange glücklich fühlt oder wie Süchtige die Dosis
erhöhen muss. Menschen, die sich als überwiegend glücklich bezeichnen,
produzieren unter Stress
relativ kleine Mengen des Hormons Cortisol, das u.a. Diabetes,
Bluthochdruck, Gefäßkrankheiten und Depressionen begünstigt.
Glückszustände sind daher für ein langes Leben ebenso bedeutsam wie
eine gesunde Lebensweise, denn glückliche Menschen sind erfolgreicher
beim Lernen und bei ihrer Arbeit, oft auch kreativer, beliebter,
geselliger, geistig gesünder, weniger egoistisch und weniger aggressiv.
Vor
etwa 50 Jahren entdeckte man bei Experimenten mit Ratten zufällig, dass
diese von der elektrischen Stimulation eines bestimmten Gehirnareals
gar nicht genug bekommen konnten. Die Ratten durften in diesen
Experimenten diesen elektrischen Reiz für diese Gehirnregion durch
Drücken auf einen Hebel selbst auslösen und drückten in der Folge den
Hebel immer häufiger. Manche Tiere vergaßen dabei sogar zu essen und zu
trinken, und starben, offensichtlich süchtig danach, durch das
Hebeldrücken belohnt zu werden. Die daraus entstandene Neurobiologie des Glücks
hat in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends große Fortschritte
gemacht, sodass man die neuronalen Strukturen ziemlich genau kennt, die
an diesen Glückserlebnissen beteiligt sind: tief im Mittelhirn liegt
eine kleine Ansammlung von Neuronen - im Fachjargon als A10 bezeichnet
-, die den Botenstoff Dopamin produzieren und in den Nucleus accumbens
und ins Frontalhirn weiterleiten. Diese Neuronen feuern immer dann,
wenn ein Ereignis besser ausfällt als erwartet. Im Nucleus accumbens
führt das Dopamin dazu, dass Endorphine produziert und ins Frontalhirn
ausgeschüttet werden. Dieses Dopamin bewirkt, dass das Frontalhirn
besser funktioniert, sodass man unter diesem Einfluss z.B. auch besser
denken und lernen kann. Das Glücksempfinden ist vermutlich nur ein
Nebenprodukt des menschlichen Lernvermögens und ist auch nicht auf
"Dauerbetrieb" angelegt, denn Gewöhnung sorgt schon bald dafür, dass man
sich nicht allzu lange glücklich fühlt oder wie Süchtige die Dosis
erhöhen muss. Menschen, die sich als überwiegend glücklich bezeichnen,
produzieren unter Stress
relativ kleine Mengen des Hormons Cortisol, das u.a. Diabetes,
Bluthochdruck, Gefäßkrankheiten und Depressionen begünstigt.
Glückszustände sind daher für ein langes Leben ebenso bedeutsam wie
eine gesunde Lebensweise, denn glückliche Menschen sind erfolgreicher
beim Lernen und bei ihrer Arbeit, oft auch kreativer, beliebter,
geselliger, geistig gesünder, weniger egoistisch und weniger aggressiv.
Negative Emotionen wie Angst oder Wut
sind nicht von vornherein schlecht, denn durch sie haben Menschen
schließlich gelernt zu überleben, Gefahren zu erkennen und ihnen
auszuweichen. Auch Stress erfüllt eine nützliche Funktion, denn ein
aktives Leben braucht einen gewissen Stresslevel. Vermutlich sind aktive
Menschen unter Stress glücklicher als diejenigen, die Anstrengungen
oder Konflikten aus dem Weg gehen. Martin E. P. Seligman forderte Ende
der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts die PsychologInnen auf, sich
endlich mehr um das menschliche Wohlergehen zu kümmern. Seither wurde
eine Unzahl von Studien durchgeführt, die zeigen sollen, was glücklich
macht und welche Vorteile das bringt. Positive Psychologie
heißt dieser neue Forschungsbereich. Offenbar besitzen Menschen eine
bestimmte Bandbreite von Glücksempfindungen, die genetisch festgelegt
ist. Das bedeutet, dass jemand mit einem Wert von 5,5 auf einer
Glücksskala von eins bis zehn sich sowohl dem Wert fünf als auch dem
Wert sechs nähern kann, aber kaum die Sieben erreichen wird. Außerdem
fallen die meistens Menschen nach positiven oder negativen Ereignissen
nach zirka einem Jahr auf den früheren Glückslevel zurück. Manche
Menschen befinden sich auch in einer "Hedonistischen Tretmühle",
denn das neue Gewand oder das flotte Auto macht nur kurze Zeit
glücklich, doch dann braucht der Mensch wieder neue und meist auch
teuere Dinge, um positive Emotionen wie Glück oder Freude zu empfinden.
Übrigens: Wer karitativ tätig ist oder anderen Geschenke macht, ist im
Durchschnitt zufriedener als Menschen, die ihr Geld horten.
Empathie gegenüber Gruppen und Einzelpersonen
Einfühlen in andere ist nicht nur eine Frage der emotionalen Verfügbarkeit, sondern auch des kognitiven Aufwands, den diese Fähigkeit mit sich bringt. Eine Studie Moche et al. (2025) zeigte, dass Menschen eher bereit sind, Empathie gegenüber Gruppen als gegenüber Einzelpersonen zu zeigen – ein zunächst kontraintuitives Ergebnis, das auf wichtige psychologische Mechanismen verweist. In dieser Untersuchung analysierten knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fotos von Einzelpersonen und Gruppen. Dabei konnten sie zwischen einer sachlichen Beschreibung (Fokus auf äußerliche Merkmale) und einer empathischen Herangehensweise (Fokus auf mögliche Gefühle und Beweggründe) wählen. Die Ergebnisse zeigten, dass nur bei rund einem Drittel der Einzelpersonen eine empathische Perspektive eingenommen wurde. Bei Fotos von Gruppen hingegen zeigten über die Hälfte der Teilnehmenden Empathie. Interessanterweise entschieden sich die Probanden trotz höher eingeschätztem kognitiven Aufwand und emotionaler Belastung häufiger für Empathie gegenüber Gruppen als gegenüber Einzelpersonen. Man erklärt diesen Unterschied mit dem Kontext, der in Gruppenbildern häufiger präsent ist als in Fotos einzelner neutral dreinblickender Menschen. Dieser Kontext könnte dabei helfen, schneller und intuitiver eine emotionale Verbindung herzustellen. Zudem wird vermutet, dass der soziale Druck oder die wahrgenommene Relevanz größerer Gruppen das Mitgefühl verstärken könnte – möglicherweise, weil Gruppen stärker als Repräsentanten gesellschaftlicher oder kollektiver Erfahrungen wahrgenommen werden. Zudem greift die Studie eine These früherer Forschung auf, wonach Empathie häufig vermieden wird, wenn sie als kognitiv und emotional kostspielig wahrgenommen wird. Gerade bei Einzelpersonen, deren Gesichtsausdruck keine klare emotionale Richtung vorgibt, empfinden Menschen offenbar eine größere Unsicherheit oder Ambivalenz beim Versuch des Einfühlens. Diese Unsicherheit könnte die Bereitschaft, sich überhaupt empathisch zu engagieren, verringern. In der Gruppenbedingung hingegen überwog offenbar der Nutzen oder das Bedürfnis nach sozialem Verständnis trotz der empfundenen Belastung. Diese kontextuellen und motivationale Faktoren im Empathieerleben legen nahe, dass Empathie keine rein spontane Reaktion ist, sondern ein selektiver Prozess, der unter dem Einfluss kognitiver Einschätzungen und sozialer Wahrnehmung steht. Diese Erkenntnisse könnten weitreichende Implikationen für soziale Kommunikation, politische Kampagnen oder mediale Berichterstattung haben, insbesondere, wenn es darum geht, Mitgefühl für Individuen in Notlagen zu mobilisieren.Haben Tiere Emotionen?
Früher war man der Ansicht, dass nur Tiere mit Strukturen eines limbischen Systems Emotionen besitzen können, also auch Reptilien, doch zeigen auch Tiere ohne diese Strukturen Lernverhalten und verfügen über entsprechende morphologische Substrate wie Neurotransmitter, sodass man auch bei diesen von einem internen Belohnungssystem sprechen kann, denn sie weichen etwa schädigenden Signalen aus und suchen aus ihrer Sicht positive Situationen auf.
In den 1960er Jahren wurden an Tieren Versuche mit Gehirnreizungen unternommen, indem man feine Elektroden im limbischen System von Versuchstieren implantierte. Nach einer Reizung zum Beispiel der Amygdala konnte man die Reaktion der Tiere beobachten, über Analogie zum Menschen Schlüsse ziehen und so die Existenz bestimmter Emotionen nachweisen. Aktuell arbeiten die Forscher auch mit der Positronen-Emissions-Tomografie, um nichtinvasiv physiologische Vorgänge im Gehirn sichtbar zu machen.
Mittlerweile geht man davon aus, dass Tiere zwischen Emotionen wie "Angst" und entsprechenden Gegenspielern wie "Freude" oder "Wohlgefühl" unterscheiden können. Bei Gefühlsäußerungen wie Liebe oder Trauer scheiden sich die Geister, denn einige Forscher vertreten die Meinung, dies seien zutiefst menschliche Empfindungen, die keine Entsprechung im Tierreich hätten. Andere vermuten, dass diese Emotionen auch bei Tieren vorkämen, jedoch nicht eindeutig zu beweisen seien.
Neue Medien und Emotionen
Die Verbreitung sozialer Medien und offener Webdaten bietet Forschern eine einzigartige Gelegenheit, menschliches Verhalten auf mehreren Ebenen besser zu verstehen. Siriaraya et al. (2023) haben beispielsweise gezeigt, wie Open Street Map- und Twitter-Daten analysiert und verwendet werden können, um menschliche Emotionen auf stadtweiter Ebene in zwei Städten, San Francisco und London, detailliert darzustellen. Dazu wurden zwei Millionen Tweets aus sozialen Medien mit Standortdaten kombiniert, um zu vergleichen, wie glücklich die Menschen in verschiedenen Regionen sind. Dabei beschränkten sie sich nicht auf eine einzige Emotion, sondern bezogen auch Gefühle wie Glück oder Zufriedenheit mit ein. Dazu entwickelten und kodierten sie künstliche neuronale Netze und schufen so eine Grundlage für die Analyse von Tweets auch in anderen Städten. Aus allen Tweets leiteten sie acht Emotionen ab, die sie den Nachrichten zuordneten: Ärger, Vorfreude, Ekel, Angst, Freude, Traurigkeit, Überraschung und Vertrauen. Anschließend ordneten sie diese Emotionen den Orten zu und erstellten so eine Liste der emotionalen Hotspots in beiden Städten. In beiden Städten zeigte sich, dass Tweets in der Nähe von Bahnhöfen und anderen Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel in der Regel seltener Freude ausdrückten, sondern häufig von Ekel, Angst oder Wut geprägt waren. Krankenhäuser und Brücken erzeugten mehr ängstliche Tweets, während Restaurants, Hotels, Schwimmbäder oder Minigolfplätze mehr positive Botschaften erzeugten. Es gab jedoch messbare Unterschiede zwischen San Francisco und London, wobei viele negative Gefühle nur in San Francisco zum Ausdruck kamen, wenn die Tweets in der Nähe von Büros geschrieben wurden. Auf Tagesbasis waren die Nachrichten an den Wochenenden am fröhlichsten, während unter der Woche die Freude eher gering war, wobei die Traurigkeit vor allem am Dienstag und Mittwoch überwog. Gleichzeitig stieg jedoch die Vorfreude auf das Wochenende zum Ende der Woche hin an.
Primäre und sekundäre Emotionen
Während eine primäre Emotion darauf beruht, wie man sich in einer Situation fühlt, etwa man ist verletzt oder traurig, ist eine sekundäre Emotion eine Reaktion auf die primäre Emotion, weil man sich mit dieser Emotion unwohl fühlt. Das Problem ist bei sekundären Emotionen, dass man sich dem primären Gefühl oft gar nicht zuwendet und ihm keinen Raum gibt. Vor allem zwei Gefühle sind sehr häufig sekundäre Emotionen: Ein typisches Beispiel für eine sekundäre Emotion ist Wut. Wenn Menschen verletzt sind, sind sie sich dessen häufig gar nicht bewusst, weil die sekundäre Emotion Wut direkt einsetzt. Das hängt damit zusammen, dass man sich nicht gerne verletzlich fühlt, weil das Angst macht. Anstatt bei dem Gefühl des Verletztseins zu bleiben, springt man direkt zur Wut. Eine weitere häufige sekundäre Emotion ist Angst. Natürlich kann Angst auch ein primäres Gefühl sein, etwa wenn man vielleicht nervös wegen eines anstehenden Termins ist oder sich vor einer realen Gefahr fürchtet. Aber häufig ist die Angst sekundär, denn man ist womöglich traurig, schämt sich, ist enttäuscht oder eifersüchtig. Und da man sich mit diesen Gefühlen verletzlich macht, können die sekundären Emotionen dafür sorgen, dass man sich unwohl fühlr. Also übernimmt Angst das Ruder, als eine Art Schutzschild, um vor komplizierteren oder schmerzhaften Emotionen zu bewahren. Im Prinzip geht es also bei beiden sekundären Gefühlen darum, dass das primäre Gefühl unangenehm ist und Wut oder Angst in dem Fall einfache“ zu fühlen sind, weil man sich damit nicht so verletzlich macht oder diese weniger komplex sind als etwa Scham oder Verletztheit. Beispiele für weitere sekundäre Emotionen sind Scham, Schuld, Eifersucht oder Neid. Diese Gefühle entstehen oft durch gesellschaftliche Normen, persönliche Erfahrungen oder erlernte Verhaltensweisen. Sie können primäre Emotionen überlagern und sind oft schwerer zu erkennen oder zu verarbeiten sein. Daher ist es wichtig, sekundäre Emotionen zu erkennen und zu hinterfragen. Oft verbergen sich hinter ihnen primäre Gefühle, die adressiert werden müssen, denn so kann Eifersucht eine Reaktion auf Angst vor Verlust oder mangelndes Selbstwertgefühl sein. Um besser mit sekundären Emotionen umzugehen, empfiehlt es sich, die Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, die Ursache der Emotion ergründen, zu akzeptieren, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben. Oft hilft es auch, mit anderen darüber zu sprechen und wenn nötig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (Stangl, 2012).Alexithymie
Alexithymie (Gefühlsblindheit) bedeutet die Unfähigkeit, Gefühle hinreichend wahrnehmen und beschreiben zu können. Alexithymie bedeutet wörtlich das Nicht-Lesen-Können von Gefühlen. Konkret bezeichnet Alexithymie die Schwierigkeit eines Menschen, Emotionen adäquat bei sich wahrzunehmen, Affektqualitäten zu unterscheiden und diese schließlich sprachlich zu symbolisieren, ihnen Ausdruck zu verleihen.
Hochsensible Menschen sind besonders feinfühlig, besitzen eine erhöhte Empfänglichkeit sowohl für äußere als auch für innere Reize, wodurch hochsensible Menschen mehr Informationen aufnehmen als ihre Mitmenschen, dennoch werden Hochsensible oft als schüchtern stigmatisiert. Durch diese ungewöhnliche Charaktereigenschaft sind sie aber auch verletzlicher als andere, geraten schneller in Stress und kämpfen häufig mit Selbstzweifeln.
Was sind Emotionen? Ein Überblick
- Psychologische Erklärungsmodelle
- Plutchiks Emotionsmodell
- Perspektiven der Erforschung
- Wir fühlen, was wir sehen
- Emotion und Kognition
- Spiegelneuronen
- Alexithymie - Gefühlsblindheit
- Die Umarmung und deren Bedeutung
- Hochsensibilität
- Der richtige Umgang mit unkontrollierten Erregungen
Emotion - Psychophysiologische Merkmale
Aggression - Psychologische Erklärungsmodelle
- Theorien zum Erwerb und den Ursachen aggressiven Verhaltens
- Gewalt in den Medien - Methoden der Forschung
- Kleiner Exkurs zum Gewaltbegriff
- Lernpsychologische Erklärung von Aggressionen
- Rowell Huesmanns soziale Entwicklungstheorie
- Berkowitz' kognitive Neoassoziationstheorie
- Psychoanalytische Aggressionstheorien (Freud, Adler)
- Aggressionsminderung durch Katharsis
- Ethologisches Instinktkonzept (Lorenz)
- Frustrations- Aggressionstheorie (Dollard)
- Das Phänomen des Amok
- Eine Form der Autoaggression: Selbstverletzung
- Genetische Faktoren der Aggression
- Aggression und Serotoninspiegel
- Hooliganismus
- Selbstverletzung
- Tipps für Eltern
- Trainingsprogramm zum Umgang mit aggressiven Kindern
- Aggressionshemmung
- Die Entwicklung von Emotionen
- Die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien
- Computerspiele machen aggressiv
- Formen der Gewalt in der Familie
- Literatur zur Aggression
Siehe zu diesem Thema auch das neue
Inhaltsverzeichnis
Theorien zur Erklärung - Genetischer Ansatz - Ethologisches Konzept - Huesmann und Berkowitz - Lernpsychologische Erklärung - Katharsishypothese - Psychoanalytische Erklärung - Frustrationshypothese - Exkurs - Amok - ein interkulturelles Phänomen - Selbstverletzung - Wahrnehmung in der Familie - Familie - Hooliganismus - Medienwirkung - Medien-Forschung - Elterntipps - Selbstverletzendes Verhalten - Trainingsprogramm - Schule - Literatur
Kurioses zum Thema Emotion ;-)
Klassische Stresstheorien
 Cannons Stresstheorie (1932)
Cannons Stresstheorie (1932)
 Hans Selyes Theorie (1936)
Hans Selyes Theorie (1936)
 Lazarus kognitives Modell (1974)
Lazarus kognitives Modell (1974)
 Levis Stressmodell (1975)
Levis Stressmodell (1975)
 Stressmodell nach Mc Grath
Stressmodell nach Mc Grath
 "Misfit-Modell" von Harrison (1978)
"Misfit-Modell" von Harrison (1978)
 Laceys Fraktionierungstheorie
Laceys Fraktionierungstheorie
Stress und andere psychologische Merkmale
- Persönlichkeitsvariablen im Zusammenhang mit physiologischen Variablen
- Typische Stressmerkmale
- Stress und Psychosomatik
- Stress und Gedächtnis
- Mit Stress leben!? Einige Ratschläge und Techniken
- Entspannungsverfahren
- Progressive Muskelrelaxation (-entspannung) nach Edmund Jacobson
- Entspannung in der Schule
- Stressbewältigung durch Berührung
Angst - Psychologische Erklärungsmodelle
- Körperlicher, seelischer und sozialer Schmerz
- Soziale Phobien
- Panikattacken - Panikstörung - Angst vor der Angst
- Prüfungsangst
- Körperliche Grundlagen der Angstentstehung
- Ängste mit biologischen Grundlagen: Höhenschwindel und Höhenangst
- Das Repression-Sensitization-Konstrukt
- Aufmerksamkeit und die Art der Angstbewältigung
- Grundformen der Angst
- Riemanns Grundformen und Kommunikation: Das Riemann-Thomann-Modell
- Verhaltenstherapie bei Angst- und Panikstörungen
- Paradoxe Intention
- Die Depression
 Religion, Schuldgefühle und Angst
Religion, Schuldgefühle und Angst
- Entwicklungspsychologisch typische Ängste in der Kindheit
- Nachtängste (pavor nocturnus) und Alpträume
- Erklärungen für kindliche Angst
- Angstverarbeitungs strategien bei Kindern - Angstbilderbücher
- Entspannungsgeschichten für Kinder
- Stabilität von Temperament und Emotionen
- Schulangst
- Fritz Riemanns "Grundformen der Angst"
- Angst bei Jugendlichen
- Änste im Jugendalter
- Steffen Fliegel: Prüfungsangst
- Phobien ... damit man weiß, wovor man sich überhaupt fürchten kann ;-)
- Die Angst vor dem Zahnarzt
- Formen der Depression
- Herbstblues, Winterdepression
- Behandlung der Depression
- Depressionen und Suizidalität im Kindes- und Jugendalter
- Literatur zum Thema Depression
Quellen und Literatur

Mees, Ulrich (1991). Die Struktur der Emotionen. Göttingen: Hogrefe.
Ekman, P. (1973). Darwin and facial expression: A century of research in review. New York: Academic Press.
Averill, J.R. & Nunley, E.P. (1992). Die Entdeckung der Gefühle. Ursprung und Entwicklung unserer Emotionen. Hamburg: Kabel.
Franken, Ulla (2004). Emotionale Kompetenz. Eine Basis für Gesundheit und Gesundheitsförderung. Dissertation Universität Bielefeld.
Schmidt-Atzert, Lothar (1996). Lehrbuch der Emotionspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Plutchik, R. (1962). The emotions: Facts, theories, and a new model. New York: Random House.
Kleinginna, P.R. Jr. & Kleinginna, A.M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and Emotion, 5, S. 345-355.
Moche, H., Noryd, U., Rydén, S. & Västfjäll, D. (2025). To empathize with a group or an individual? Investigating the role of cognitive cost and distress in empathy choice. Frontiers in Psychology, 16, doi:10.3389/fpsyg.2025.1519113 (Stangl, 2025).
Stangl, W. (2025, 8. Mai). Warum Gruppen mehr Mitgefühl erhalten als Einzelpersonen. arbeitsblätter news.
https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/warum-gruppen-mehr-mitgefuehl-erhalten-als-einzelpersonen/.
Petri, H.L. (1996). Motivation: Theory, Research, and Application. Belmont, CA: Wadsworth.
Siriaraya, Panote, Zhang, Yihong, Kawai, Yukiko, Jeszenszky, Peter & Jatowt, Adam (2023). A city-wide examination of fine-grained human emotions through social media analysis. Public Library of Science, 18, doi:10.1371/journal.pone.0279749.
Sponsel, Rudolf (2002). Gefühle als Grundelemente des Psychischen. Ein Reader aus: Keller, Josef A. (1981). Grundlagen der Motivation. IP-GIPT. Erlangen: http://www.sgipt.org/gipt/allpsy/fuehl/reader/keller.htm (02-06-29)
Stangl, W. (1989). Die Psychologie im Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn.
Stangl, W. (2008). Haben Tiere Emotionen wie Menschen? – Stangl notiert …. Was Stangl so notiert.
Stangl, W. (2012, 14. August). Primäre und sekundäre Emotionen. Psychologie-News.
https://psychologie-news.stangl.eu/5340/primaere-und-sekundaere-emotionen
Stangl, W. (2023, 3. Februar). Stadtplan der Emotionen. arbeitsblätter news.
https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/stadtplan-der-emotionen/
Zelano, Christina, Jiang, Heidi, Zhou, Guangyu, Arora, Nikita, Schuele, Stephan, Rosenow, Joshua & Gottfried, Jay A. (2016). Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function. The Journal of Neuroscience, 36, 12448-12467.
https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2008_01/08_01_puppe/index.html (08-06-12)
Siehe auch Vorgeburtliches Lernen https://lerntipps.lerntipp.at/?p=89 (08-10-31)
![]() Hanke, Ottmar (2004). Gewaltprävention in der Schule. Zentrale Fragestellungen und Umsetzung in der Klasse. Die Deutsche Schule, 96, 68-84.
Hanke, Ottmar (2004). Gewaltprävention in der Schule. Zentrale Fragestellungen und Umsetzung in der Klasse. Die Deutsche Schule, 96, 68-84.
![]() Uslucan, H. & Fuhrer, U. (2004). Viktimisierungen und Gewalthandlungen im Jugendalter. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 51, 178-188.
Uslucan, H. & Fuhrer, U. (2004). Viktimisierungen und Gewalthandlungen im Jugendalter. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 51, 178-188.
Bildquellen
http://www.voll-psychologisch.de/2002/Studium&Beruf/ hoersaal/Emotionen/1-ekman.jpg (03-11-30)
http://seminarserver.fb14.uni-dortmund.de/boehm/SS_2003/ SE_EmoMot/02_Gesichtsausdruck_Basisemotionen.pdf (03-06-28)
http://www.teachsam.de/psy/psy_emotion/psy_emotion_1.htm (05-05-02)
http://www.stud.uni-wuppertal.de/~ya0023/phys_psy/emotion.htm (01-12-24)
Die Grafik des Emotionsmodells von Plutchik stammt von Maria Helena Oestreicher.
Häufige Suchwörter: Daniel Stern, Kommunikation, Sprache, Subjektivität der Wahrnehmung, Didaktik, Entspannungsübungen, Stress, Entwicklungspsychologie, Delinquenz, Hellinger, Konstruktivismus, qualitative, Lazarus, Transaktionsanalyse, eigenes Selbst- und Stimmungsmanagement, Stimmungsmanagement, Forum, Strategien des Textverstehens, Sucht, Entwicklung, Kleinkindalter, Intention, Adler, Stimmungsmanagement bei Entscheidungen, Schizophrenie
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::