Was ist Emotion? Psychologische Erklärungsmodelle
Handle wie du fühlst,
und fühle, wie du handelst.
Plinius d.J.
Wir machen immer einen Fehler: Wir investieren Gefühle, statt sie zu verschenken.
Arthur Schnitzler
Seit mehr als 2000 Jahren befaßten sich die Psychologie bzw. ihre Vorläuferwissenschaften mit Emotionen. Theodor Piderit schrieb eine wissenschaftliche Abhandlung mit dem Titel "Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik", in der er behauptete, dass zwar die Sprache zwischen den Völkern verschieden sei, dass aber das Mienenspiel bei allen Menschen dasselbe wäre. In den Gesichtszügen des "Wilden" wie des europäischen Kulturmenschen, beim Kind wie beim Greis äußern sich Gefühle und Stimmungen, Begierden und Leidenschaften auf gleiche Weise.
Franz Brentano bezeichnete Gefühle als menschliches Grundvermögen, deren Verständnis auf der Vermögenslehre beruht, die von der weitgehenden Autonomie der Gefühlswelt ausgeht. Drei Klassen seelischer Akte betrachtete er als zentral: Vorstellung, Urteile und Gemütsbewegung.
Charles Darwin versuchte in seinem Werk "Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und Tieren", die sichtbaren mimischen Veränderungen mit der Aktivität bestimmter Gesichtsmuskeln zu erklären. Ihm zufolge offenbaren sich Emotionen nicht nur in der Mimik, sondern auch in typischen Verhaltensweisen wie Herumwälzen und Schreien bei Wut, und körperlichen Veränderungen wie z. B. durch schnellere Atmung. Er betrachtete den Grundgedanken der biologischen, psychischen und moralischen Entwicklung als Ergebnis von Selektion und Vererbung, von Auslese im Kampf um das Dasein.
 Wilhelm Wundt
(1896) stellte die Gefühle den Empfindungen gleichgewichtig zur Seite
und stand so im Gegensatz zur damaligen Auffassung, Gefühle als bloße Begleiterscheinungen
von Sinneselementen zu betrachten oder sie gar mit solchen
gleichzusetzen. Bei seiner Analyse des Wesens der Gefühle erkannte er
die Unzulänglichkeit der zu dieser Zeit vorherrschenden Tendenz, Gefühle
nur als Lust- oder Unlustgefühle anzusehen. Er postulierte drei
bipolare Hauptrichtungen der Gefühle: Lust-Unlust, Erregung-Hemmung und
Spannung-Lösung. Damit hatte Wundt das Kontrast- oder Polaritätsprinzip
der Gefühle geschaffen. Mithilfe der introspektiv-phänomenologische
Methode wurden u. a. folgende Kriterien für Gefühlserlebnisse -
vornehmlich zu ihrer Abhebung von anderen Erlebniseinheiten,
insbesondere Empfindungen, erarbeitet (siehe dazu Bottenberg 1972. 35
ff.):
Wilhelm Wundt
(1896) stellte die Gefühle den Empfindungen gleichgewichtig zur Seite
und stand so im Gegensatz zur damaligen Auffassung, Gefühle als bloße Begleiterscheinungen
von Sinneselementen zu betrachten oder sie gar mit solchen
gleichzusetzen. Bei seiner Analyse des Wesens der Gefühle erkannte er
die Unzulänglichkeit der zu dieser Zeit vorherrschenden Tendenz, Gefühle
nur als Lust- oder Unlustgefühle anzusehen. Er postulierte drei
bipolare Hauptrichtungen der Gefühle: Lust-Unlust, Erregung-Hemmung und
Spannung-Lösung. Damit hatte Wundt das Kontrast- oder Polaritätsprinzip
der Gefühle geschaffen. Mithilfe der introspektiv-phänomenologische
Methode wurden u. a. folgende Kriterien für Gefühlserlebnisse -
vornehmlich zu ihrer Abhebung von anderen Erlebniseinheiten,
insbesondere Empfindungen, erarbeitet (siehe dazu Bottenberg 1972. 35
ff.):
- Besondere Ichzugehörigkeit, Ichzuständlichkeit oder Subjektivität (Wundt 1896; Lipps 1906; Krüger 1928)
- Gegensätzlichkeit (Wundt 1896; Ebbinghaus 1905; Lipps 1907; Krüger 1918; Külpe 1922)
- Universalität (Külpe 1922: Krüger 1928)
- Aktualität (Wundt 1896: Lipps 1907)
- Wandelbarkeit und Labilität (Krüger 1928)
- Qualitätenreichtum (Krüger 1928)
- Unlokalisierbarkeit (Lipps 1906; Stumpf 1907; Külpe 1922).
William McDougall (1923) hat darauf verwiesen, dass die Begriffe Gefühl und Emotion zu unterscheiden wären, da eine Vermengung für Verwirrungen sorgt. Ein Gefühl bezieht sich auf das Erleben, etwa wenn jemand sagt, er habe Angst, eine Emotion aber ist globaler und schließt neben dem Gefühl auch einen körperlichen Zustand und den "Ausdruck" ein.
Überblick über den Hypertext  Die menschlichen Emotionen
Die menschlichen Emotionen
Le coeur a ses raisons
que la raison ne connaît pas.
Blaise Pascal
Plutchiks Emotionsmodell
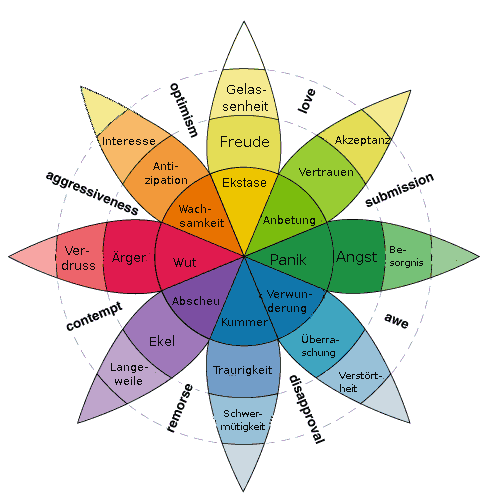 Robert Plutchik
entwickelte die Grundzüge seiner Emotionstheorie 1958 und modifizierte
sie später öfter, wobei diese der Instinkttheorie von McDougall ähnelt,
nur dass Plutchik die Kognition stärker betont und andere
Primäremotionen annimmt (Furcht, Ärger, Freude, Traurigkeit,
Akzeptieren, Ekel, Erwartung und Überraschung). Plutchik ordnete die
Emotionen auf einem zweidimensionalen Kreis an (siehe unten) wobei
qualitativ ähnliche Emotionen nebeneinander liegen und entgegengesetzte
Emotionen gegenüberliegen. Mit der dritten Dimension Intensität baute er
dieses Modell zu einem dreidimensionalen strukturellen Modell aus.
Primäremotionen sind nach seiner Meinung durch genetische Selektion
entstanden (also auf ererbten Mechanismen beruhen) und zwar durch
grundlegende Anpassungsprobleme, deren Lösung das Überleben
sicherstellen. Plutchik sieht Emotionen als Reaktionskette mit
Rückmeldeschleifen, wobei der Reiz nicht Bestandteil der Emotion ist,
sondern nur ihr Auslöser. Zuerst wird der Reiz bewertet (gut oder
schlecht, nützlich oder schädlich), was die Gefühle auslöst, die von der
kognitiven Einschätzung und den physiologischen Reaktionen determiniert
werden. Der sich daraus ergebende Handlungsimpuls führt zu einer
Handlung, die schließlich Auswirkungen auf die Situation hat. Sekundäre
Emotionen sind Mischungen zwischen primären Emotionen, die auftreten,
wenn ein Reiz bei der Bewertung mehr als eine primäre Emotion auslöst.
Dies kann bei unähnlichen Primäremotionen einen Konflikt auslösen, der
um so größer ist je unähnlicher die Primäremotionen sind. Die
Primäremotionen mischen sich und eine komplexe Emotion entsteht. So
entstehen Dyaden oder Triaden, wobei bei zwei benachbarten
Primäremotionen von einer primären Dyade gesprochen wird und wenn eine
Emotion zwischen den beiden liegt von einer sekundären Dyade. Wenn zwei
entgegengesetzte Primäremotionen auftreten und gleich stark sind führt
dies zur gegenseitigen Hemmung.
Robert Plutchik
entwickelte die Grundzüge seiner Emotionstheorie 1958 und modifizierte
sie später öfter, wobei diese der Instinkttheorie von McDougall ähnelt,
nur dass Plutchik die Kognition stärker betont und andere
Primäremotionen annimmt (Furcht, Ärger, Freude, Traurigkeit,
Akzeptieren, Ekel, Erwartung und Überraschung). Plutchik ordnete die
Emotionen auf einem zweidimensionalen Kreis an (siehe unten) wobei
qualitativ ähnliche Emotionen nebeneinander liegen und entgegengesetzte
Emotionen gegenüberliegen. Mit der dritten Dimension Intensität baute er
dieses Modell zu einem dreidimensionalen strukturellen Modell aus.
Primäremotionen sind nach seiner Meinung durch genetische Selektion
entstanden (also auf ererbten Mechanismen beruhen) und zwar durch
grundlegende Anpassungsprobleme, deren Lösung das Überleben
sicherstellen. Plutchik sieht Emotionen als Reaktionskette mit
Rückmeldeschleifen, wobei der Reiz nicht Bestandteil der Emotion ist,
sondern nur ihr Auslöser. Zuerst wird der Reiz bewertet (gut oder
schlecht, nützlich oder schädlich), was die Gefühle auslöst, die von der
kognitiven Einschätzung und den physiologischen Reaktionen determiniert
werden. Der sich daraus ergebende Handlungsimpuls führt zu einer
Handlung, die schließlich Auswirkungen auf die Situation hat. Sekundäre
Emotionen sind Mischungen zwischen primären Emotionen, die auftreten,
wenn ein Reiz bei der Bewertung mehr als eine primäre Emotion auslöst.
Dies kann bei unähnlichen Primäremotionen einen Konflikt auslösen, der
um so größer ist je unähnlicher die Primäremotionen sind. Die
Primäremotionen mischen sich und eine komplexe Emotion entsteht. So
entstehen Dyaden oder Triaden, wobei bei zwei benachbarten
Primäremotionen von einer primären Dyade gesprochen wird und wenn eine
Emotion zwischen den beiden liegt von einer sekundären Dyade. Wenn zwei
entgegengesetzte Primäremotionen auftreten und gleich stark sind führt
dies zur gegenseitigen Hemmung.
Die grafische Darstellung bzw. Übertragung des Modells von Plutchik stammt von Maria Helena Oestreicher, die sie mir freundlicher Weise zur Veröffentlichung überlassen hat.
Der Neid
Interessanterweise fehlt in den meisten Modellen der primären Emotionen der Neid, der wohl zu den vielschichtigsten und auch den am meisten geleugneten Affekten zählt und daher in den seltensten Fällen offen geäußert wird - auch in der psychologischen Literatur ;-) Der Neid kann sich inhaltlich auf Besitz, Eigenschaften oder auf etwas beziehen, was einen anderen in seiner Individualität auszeichnet.
In Studien hatte sich gezeigt, dass es zwei Arten von Neid
gibt: Zum einen kann Neid auf die Leistungen einer anderen Person dazu
anspornen, sich selbst zu verbessern, in diesem Fall handelt es sich um
eine Art konstruktiven Neid. Andererseits die
Eifersucht auch dazu führen, die Leistungen des Besseren zu schmälern
und ihn niedermachen zu wollen – der Neid ist hier also destruktiv.
Neid wird übrigens häufig in der Werbung eingesetzt. Ferreira & Botelho (2021) haben in einer Studie herausgefunden, dass Neid als Werbestrategie auch sehr negative Markenassoziationen bei KonsumentInnen auslösen kann, wobei Verdientheit ein Schlüsselfaktor bei der Unterscheidung zwischen bösartigem und gutartigem Neid ist. Vor allem internationale Marken wie BMW oder Calvin Klein nutzen den Neid-Faktor in großem Ausmaß kalkuliert in ihren Werbekampagnen, um ihre Produkte begehrenswerter erscheinen zu lassen und das Bedürfnis danach zu steigern. Neid dient dabei als Taktik, um KundInnen anzuregen, persönliche Ziele durch den Kauf von Produkten zu erreichen, sei es mehr Schönheit, Gesundheit oder Status. Für diese Studien hatte man drei Settings erstellt: ein Berufsauswahl-Verfahren, einen Promotions-Wettbewerb und ein akademisches Austauschprogramm. Dabei wurde untersucht, welchen Einfluss persönliche Verdienste und Kontrollierbarkeit auf böswilligen Neid haben, bzw. welche Auswirkung die Abneigung gegenüber einem Mitbewerber auf das Ausmaß des gefühlten Neids hat. Böswiliger Neid trat bei den TeilnehmerInnen immer dann auf, wenn ein Mitbewerber aus ihrer Sicht etwas bekam, das er nicht verdient hatte, also etwa wenn er als faul angesehen wurde und trotzdem einen Studienplatz erhielt. Die Ergebnisse zeigen also, dass die Art und Weise, wie neidische Menschen Ursachen für die unverdienten Vorteile anderer zuschreiben, die Stärke des bösartigen Neides beeinflusst. In der bisherigen Forschung hatte man angenommen, dass gutartiger Neid auftritt, wenn der Vorteil des beneideten Individuums als verdient wahrgenommen wird. Allerdings können Menschen selbst in Fällen, in denen der Vorteil als verdient wahrgenommen wird, bösartigen Neid empfinden, wenn sie den Beneideten nicht sympathisch finden. Um also Neid erfolgreich im Marketing-Kampagnen einzusetzen, ist daher ein hohes Verständnis dafür notwendig, ob die Kampagne harmlosen oder böswilligen Neid auslösen wird. Daher sollte man beim Einsatz von Neid als Marketing-Instrument vorsichtig sein und ihn nur dann einsetzen, wenn man sicher davon ausgehen kann, dass Konsumenten zwar gutartigen,aber keinen bösartigen Neid empfinden werden. Auch sollte man in solchen Anzeigen stets auf sympathisch wirkende Identifikationsfiguren setzen statt auf doch eher umstrittene Prominente.
Neid ist ein Affekt, der eine Beziehung zur Scham aufweist, wobei der Neid etwas anderes ist als der Wunsch nach Gerechtigkeit, sondern er kann sogar das Gerechtigkeitsgefühl verletzen. Der Psychoanalytiker Günter Seidler hat sich sehr eingehend mit der Verbindung von Neid und Scham beschäftigt und unterscheidet im Prozess den Neider als Neidsubjekt, den Beneideten als Neidobjekt und den Inhalt des Neides als Neidgegenstand, während er als Neidziel als das Gefühl beschreibt, das erstrebte Gut zu besitzen, da es zusteht und man damit machen kann, was man will.
Sigmund Freud spricht dem Neid keine Motivationskraft in der Entstehung neurotischer Störungen zu, während Melanie Klein den Neidgefühlen beim Kleinkind eine herausragende Bedeutung zuweist. Darauf bezieht sich auch Kernberg, wenn er die zentrale des Neides bei der Entstehung und Dynamik der narzisstischen Störung betont, denn der abgewehrte Neid stellt eine zentrale Komponente einer narzisstischen Störung dar. Um dem unangenehmen Gefühl wie Neid zu entgehen, stellt sich als Abwehr eine Form der Idealisierung ein. Grund dafür ist meist ein tiefsitzender Minderwertigkeitskomplex, der auf persönlichen Vorstellungen gegenüber Teilen der eigenen Person beruht, die von Gefühlen starker Unzufriedenheit und Selbsthass begleitet werden. Neid ist auch ein Vergleichsaffekt, bei dem man sich in Relation zu anderen setzt.
Was ist Neid? Neid ist ein ganz normales, im Grunde kern- und strunzgesundes Gefühl in einer Gesellschaft, in der Güter und Lebenschancen ungleich verteilt sind. Wer seinen eigenen Wert kennt, der fragt sich: Warum hat der andere, was ich nicht habe? Es sind gerade die Leute mit geringem Selbstwertgefühl, die den Neid in sich unterdrücken. Sie meinen, andere hätten Erfolg und Besitz eher verdient, seien besser und müssten deswegen vom Leben bevorzugt werden. Wer ehrgeizig ist, wer was will, wer im Leben steht und nach vorne drängt, der ist in aller Regel auch neidisch und will andere neidisch machen. Das ist ganz normal. Nur wer schon alles hat, was er braucht, muss und wird nicht neidisch sein. Wer sich den dicksten Schlitten leisten kann, wird nicht neidisch werden, wenn der Nachbar schon wieder mit einem neuen, sündhaft teuren Wagen vorfährt. Man muss ja schon etwas meschugge sein, nicht zu erkennen, wem die Anti-Neid-Ideologie nützt - klar! - den Besitzenden, die natürlich die Begehrlichkeiten der Habenichtse beunruhigen.
H.U.G in de.sci.psychologie am 8.5.2006
Eifersucht kann zwar die Beziehung zwischen Individuen einer Gruppe belasten, ist aber vermutlich evolutionär bedingt, denn unter dieser Perspektive betrachtet ist dieses Gefühl durchaus sinnvoll und ist bei sozial lebenden Tieren nachgewiesen. Ähnlich wie bei Menschen geht es Tieren in erster Linie darum, die eigene Stellung innerhalb einer Gruppe und damit den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen zu sichern. Der Aufbau und die Sicherung von Kontakten und Partnerschaften ist eine gängige Strategie sozial lebender Tiere, der Gefahr von Angriffen durch Feinde zu begegnen oder um Konflikte um die Hierarchie innerhalb der eigenen Gruppe zu reduzieren.
Das Urbild des Neides ist die Geschwisterrivalität in der Familie, bei der es um frühe Verteilungskämpfe geht, in denen meist um die Liebe der Eltern gerungen wird. Der Neid ist ein Phänomen der sozialen Nähe und entsteht daher oft unter Geschwistern, KollegInnen oder Nachbarn. Hinzu kommt der paradoxe Umstand, dass der Neid an sich sinnlos ist, weil der beneidete Gegenstand, die Eigenschaft oder der soziale Status durch das Neiden selbst gar nicht gewonnen werden kann. Der "Leerlauf" dieser Emotion ist daher vorprogrammiert. Entgegen der landläufigen Auffassung, dass sich das Neid meist auf Materielles bezieht, bezieht sich das Neidgefühl selber meist gar nicht direkt auf Gegenstände, sondern es geht vielmehr um das Gefühl, das man bei demjenigen vermutet, der ein Objekt besitzt, das man auch gerne selber hätte. Dabei ist es durchaus fraglich, ob derjenige tatsächlich dieses positive Besitzgefühl hat, das man ihm in seiner Vorstellung zuschreibt. Meist geht der Neid mit einem lückenhaften, fragmentierten Selbst einher, sodass es, um diesem selbstzerstörerischen Gefühl zu entkommen, gilt, das Selbstbewusstsein zu stärken, die eigene Leistungen und Fähigkeiten bewusst zu machen. Jedoch lässt sich auch im Neid eine konstruktive Seite entdecken, wenn man ihn als Antrieb versteht, den Ehrgeiz anzustacheln, um genauso gut zu werden wie die Beneideten. Viele Menschen sehen den Neid durchaus als berechtigtes Gefühl, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. In einer neueren experimentellen Untersuchung zeigte sich auch, dass Beneidete eine gesteigerte Hilfsbereitschaft in Form eines Beschwichtigungsverhalten zeigen, denn die Angst vor dem Neid ermutigt dazu, sich so zu verhalten, dass das soziale Gefüge innerhalb einer Gruppe gestärkt wird, wobei eine zuvorkommende Haltung der Beneideten offensichtlich die zerstörerische Wirkung des Neids reduziert.
Das ist das Ärgerliche am Ärgern: dass man sich damit selbst bestraft
Ernst Ferstl
Emotionen spielen auch für die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung durch andere und die Regulation von Beziehungen zwischen Menschen eine häufig unterschätzte Rolle. Paradoxerweise fehlt den meisten Menschen eine Kultur des differenzierten Umgangs mit Emotionen, andererseits besteht aber ein ausgeprägtes Interesse an Emotionen, ihrem Ausdruck und der Teilnahme an Emotionen anderer Personen, das sich etwa in der "exhibitionistischen" Zurschaustellung im Rahmen von eigens für diesen "affektiven Austausch" entworfenen Talkshows zeigt. Durch diese wird das voyeuristisches Interesse der Zuschauer befriedigt, indem man am Schicksal von Menschen Anteil nehmen kann, zu denen aber keine unmittelbare, sondern nur eine medial vermittelte Beziehung besteht (Fernsehsendungen, Yellow Press).
Nach der Auffassung von Damasio (2000) sind Emotionen komplizierte Kombinationen von chemischen und neuralen Reaktionen des Gehirns, die eine regulatorische Rolle spielen mit dem ursprünglichen biologischen Zweck, günstige Umstände für das Überleben des Organismus zu schaffen. Emotionen benutzen den Körper (Eingeweide, Muskel-Sklett-System) als ihr Theater, haben aber auch einen Einfluss auf diverse Gehirnfunktionen. Emotionen beruhen auf angeborenen Gehirnfunktionen, die einer langen evolutionären Entwicklung entstammen. Individuelle Lernprozesse und kulturelle Einflüsse verändern jedoch die Emotionen hinsichtlich ihrer Auslöser und ihres Ausdrucks (Pohl 2001).
Literatur:
Plutchik, R. (1962). The emotions: Facts, theories, and a new model. New York: Random House.
Pohl, Wolf (2001). Antonio R. Damasio: "Ich fühle, also
bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins". Eine Rezension.
Aufklärung und Kritik, Heft 1.
Dieses System beginnt seine Arbeit bereits im Mutterleib und setzt sie verstärkt in den ersten Wochen, Monaten und Jahren unseres Lebens fort, - in einer Zeit also, in der die für uns wichtigsten Dinge passieren. In dieser Weise formt sich das, was man Charakter oder Persönlichkeit nennt, sehr früh und weitestgehend vorbewußt und wird zunehmend resistent gegen spätere Erfahrungen. Das Ich, welches sich in seinen typisch menschlichen Erscheinungsformen erst vom dritten oder gar vierten Lebensjahr an zu entwickeln beginnt, wird in diese "limbische" Persönlichkeit hineingestellt und von ihr getragen. Das bedeutet nicht, dass unser Charakter bereits mit drei Jahren völlig festgelegt ist, aber der Aufwand, ihn zu ändern, wird mit zunehmendem Alter größer; im Erwachsenenalter erfordert es "emotionale Revolutionen" (etwa die berühmten Lebenskrisen oder eine stark fordernde neue Partnerschaft), damit sich an unserer Persönlichkeit noch etwas ändert.
Viele Psychotherapeuten und insbesondere Psychoanalytiker stehen der Parallelität oder gar Identifizierung von psychischen Vorgängen und Hirnfunktionen nach wie vor ablehnend gegenüber. Sie betonen dabei eine fundamentale Verschiedenheit der Erforschung psychischer Vorgänge einerseits und neurobiologischer Strukturen und Funktionen andererseits, ganz im Einklang mit dem klassischen Gegensatz von geisteswissenschaftlicher Hermeneutik und naturwissenschaftlicher Analytik. Entsprechend sehen sie einen grundlegenden Gegensatz zwischen einer Behandlung, die auf dem therapeutischen Gespräch beruht, und der Verabreichung von Psychopharmaka. Die moderne Hirnforschung geht hingegen davon aus, dass Worte über das Hörsystem und seine Verbindungen zum limbischen System genauso auf dieses System eingreifen können wie Psychopharmaka.
Unter philosophischer Perspektive ist der aktuelle Stand der Forschung, dass bisher niemand wirklich befriedigend erklären kann, wie aus einem biochemischen Prozeß eine subjektiv empfundende Emotion werden kann. Wirklich überzeugende Belege für einen reinen Physikalismus gibt es bisher nicht. Ein Dualismus à la Descartes ist nach dem aktuellen Forschungsstand ebenso ausgeschlossen, da die Wissenschaften inzwischen genug über die Rolle wissen, die das Gehirn bei bestimmten Prozessen spielt. Daher ist ein "methodischer" Dualismus wohl derzeit die einzig sinnvolle Option, da psychische Prozesse nicht auf die Neurobiologie und schon gar nicht auf Physik reduzierbar sind, wobei erkenntnistheoretisch ein "ontologischer" Dualismus aber nicht zwingend ist, womit wir beim Versuch einer philosophischen Grundlegung auf eine Glaubensüberzeugung verwiesen bleiben (btw: der Physikalismus ist letztlich auch nichts anderes). Einige Phänomene in psychologischen Grenzbereichen (z.B. Todesnähe-Erfahrungen) könnten als Hinweis auf die Gültigkeit eines Interaktionismus genommen werden.
Neuropsychology 17, 1, 2003.
Quelle: http://www.rostock.igd.fraunhofer.de (05-12-20)
Traurigkeit ist etwas Natürliches. Es ist wohl ein Atemholen zur Freude, ein Vorbereiten der Seele dazu.
Paula Modersohn-Becker
Aus früheren Studien weiß man, dass Menschen die Zukunft überwiegend optimistischer beurteilen als sie tatsächlich ist. So überschätzen sie etwa ihren Gesundheitsstatus und glauben, dass sie länger leben als sie es tatsächlich tun, wobei das Risiko einer Scheidung vom Partner oder ein berufliches Scheitern wieder eher geringer eingeschätzt wird. Die Psychologin Tali Sharot (New York University) lokalisierte nun zwei Arreale im Gehirn, deren Aktivität mit einer optimistischen Lebenseinstellung in Verbindung steht. Depressive Menschen, die eher pessimistisch veranlagt sind, zeigen früheren Untersuchungen zufolge Auffälligkeiten in genau diesen Hirnregionen.
Versuchspersonen wurden in den Versuchen gebeten, sich entweder an ein intensives emotionales Erlebnis der Vergangenheit zu erinnern oder sich ein zukünftiges Ereignis in den schönsten Farben auszumalen. Dabei zeichneten die Wissenschaftler die Aktivität des Gehirns auf. Auch in diesem Experiment beurteilten wurden die positiven Ereignisse positiver als solche der Vergangenheit beurteilt, negative Zukunftsvorstellungen hingegen wurden eher distanziert bewertet und wenig mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung gebracht. Bei positiven Vorstellungen stieg die Aktivität in der der Amygdala und im rostralen anterioren cingulären Cortex (rACC).
Quelle: Neural mechanisms mediating optimism bias". "Nature" (doi:10.1038/nature06280; 25.10.07)
Emotion und Persönlichkeit
Die Arousal-Theorie nimmt an, dass die Unterschiede zwischen Extravertierten und Introvertierten durch unterschiedliche Grade an Erregung (Arousal) des Neocortex zustande kommen. Introvertierte sollen chronisch erregter sein als Extravertierte, weil eine im Hirnstamm befindliche Struktur, das aufsteigende retikuläre Aktivationssystem (ARAS), den Neocortex stärker erregt, als dies bei den Extravertierten der Fall ist. Man nimmt an, dass Menschen bestrebt sind, auf den für sie optimalen Erregungsniveau zu sein: nach dem Yerkes-Dodson-Gesetz führt eine optimale Erregung auch zu einer optimalen Leistung. Zu große, aber auch zu geringe Erregung im Vergleich zu "typischen" Optimalstatus wirkt unangenehm.
Da Introvertierte bereits chronisch relativ hochgradig erregt sind, streben sie keine weitere Erregung an und beschäftigen sich lieber mit wenig anregenden Tätigkeiten. Extravertierte befinden sich dagegen chronisch auf einem relativ niedrigen Erregungsniveau und streben daher weitere Erregung an, so dass sie aktiv und unternehmungsfreudig sind. Der Extravertierte benötigt infolgedessen, um zu einem optimalen Erregungsniveau zu gelangen, stärkere äußere Stimulation als der normal ambivertierte Mensch, während der Introvertierte weniger äußere Stimulation benötigt als der Normale (Ambivertierte) (Eysenck 1976, S. 22).
Aufgrund ihrer chronisch höheren Erregung sind Introvertierte dagegen leichter konditionierbar und lernten daher leichter soziale Regeln. Extravertiere reagierten stattdessen eher sozial unangemessen und weisen extremere soziale Einstellungen auf. Sie tendieren eher zu körperlichen Strafen und zur Todesstrafe, führten tendenziell ein abwechslungsreicheres und riskanteres Sexualleben und befürworten daher liberale Ehe- und Abtreibungsgesetze. Aufgrund ihrer niedrigeren Erregung und ihres Bedürfnisses nach einer Erregungssteigerung sollen Extravertierte eher stimulierende Drogen verwenden und auch häufiger rauchen als Introvertierte.
Neben der Erklärung der Unterschiede zwischen Extravertierten und Introvertierten bietet die Arousal-Theorie auch eine Erklärung für den Neurotizismus an: Kortikale Erregung kommt nicht nur durch die Aktivierung des ARAS zustande, sondern auch durch die Erregung (Aktivation) des Limbischen Systems. Menschen mit hochgradigem Neurotizismus zeichnen sich durch eine hohe Aktivation, Menschen mit gering ausgeprägten Neurotizismus durch eine niedrige Aktivation aus. Da Aktivation v.a. in Stresssituationen entsteht, übt sie allerdings keinen andauernden Einfluß auf das Verhalten aus. Erst unter Streß kann man daher Unterschiede zwischen Menschen mit hoch und niedrig ausgeprägtem Neurotizismus in ihrer Aktivation finden.
Quelle:Walter, Oliver (2005). Persönlichkeit. http://people.freenet.de/oliverwalter/Psychologie/Personlichkeit/personlichkeit.htm (05-11-11)
Siehe auch Perspektiven der Erforschung
Literatur
Mees, Ulrich (1991). Die Struktur der Emotionen. Göttingen: Hogrefe.
Ekman, P. (1973). Darwin and facial expression: A century of research in review. New York: Academic Press.
Averill, J.R. & Nunley, E.P. (1992). Die Entdeckung der Gefühle. Ursprung und Entwicklung unserer Emotionen. Hamburg: Kabel.
Ekman, P., Friesen, W.V. & Tomkins, S.S. (1971). Facial affect scoring technique: A first validity study. Semiotica, 1, 37-53.
Ferreira, Kirla & Botelho, Delane (2021).
(Un)deservingness distinctions impact envy subtypes: Implications for
brand attitude and choice. Journal of Business Research, 125, 89-102.
Schmidt-Atzert, Lothar (1996). Lehrbuch der Emotionspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Plutchik, R. (1962). The emotions: Facts, theories, and a new model. New York: Random House.
Kleinginna, P.R. Jr. & Kleinginna, A.M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and Emotion, 5, S. 345-355.
Petri, H.L. (1996). Motivation: Theory, Research, and Application. Belmont, CA: Wadsworth.
Weitere Quellen
http://www.stud.uni-wuppertal.de/~ya0023/phys_psy/emotion.htm (01-12-24)
Sponsel, Rudolf (2002). Gefühle als Grundelemente des Psychischen. Ein Reader aus: Keller, Josef A. (1981). Grundlagen der Motivation. IP-GIPT. Erlangen: http://www.sgipt.org/gipt/allpsy/fuehl/reader/keller.htm (02-06-29)
Bildquellen: http://www.voll-psychologisch.de/2002/Studium&Beruf/hoersaal/Emotionen/1-ekman.jpg (03-11-30)
http://seminarserver.fb14.uni-dortmund.de/boehm/SS_2003/SE_EmoMot/02_Gesichtsausdruck_Basisemotionen.pdf (03-06-28)
http://www.teachsam.de/psy/psy_emotion/psy_emotion_1.htm (05-05-02)