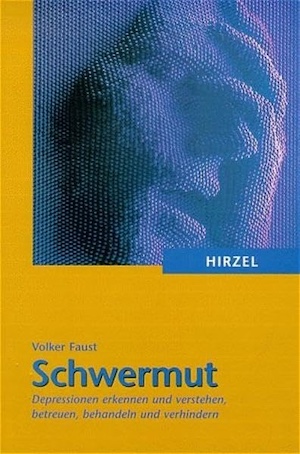Formen der Depression

[Foto: Werner Stangl, 2009]
Literatur: www.wikipedia.de
dw-online.de/de/news492260 (12-08-17)
Tokuda, Tomoki, Yoshimoto, Junichiro, Shimizu, Yu, Okada, Go, Takamura, Masahiro, Okamoto, Yasumasa, Yamawaki, Shigeto & Doya, Kenji (2018). Identification of depression subtypes and relevant brain regions using a data-driven approach. Scientific Reports, 8, doi: 10.1038/s41598-018-32521-z.
Neue, eher deskriptiv (beschreibend) ausgerichtete Diagnose-Schemata, wie die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) unterscheiden zwischen Episoden (einzelnen Vorkommen von Depression beziehungsweise Manie) und rezidivierenden Störungen (wiederholtes Vorkommen von Episoden). Die Schwere der Depression wird mit leicht, mittelgradig oder schwer bezeichnet, hinzukommen können psychotische Störungen.
Die in den letzten Jahren verstärkte Medienberichterstattung über depressiv Erkrankte sowie die Statistiken erwecken den Eindruck, dass Depressionen deutlich häufiger werden. Eine Ursache für diese postulierte Häufigkeitszunahme sind die erhöhten Anforderungen an Flexibilität und Erreichbarkeit in der modernen Arbeitswelt. Hinter der Zunahme in den Statistiken dürfte jedoch eher die sehr wünschenswerte Entwicklung stehen, dass sich mehr Erkrankte professionelle Hilfe holen, Ärzte Depressionen besser erkennen und behandeln, und Depressionen auch Depressionen genannt und nicht hinter weniger negativ besetzten Ausweichdiagnosen wie chronischer Rückenschmerz, Tinnitus, Fibromyalgie, Kopfschmerz, Chronic Fatigue etc. versteckt werden. Der eher Verwirrung stiftende Begriff Burnout ist allerdings neuerdings als Ausweichdiagnose in Mode gekommen.
Bei der seltener anzutreffenden bipolaren affektiven Störung kommen Depressionen und Manien (die sich durch unkontrollierte Hyperaktivität, übernormal gehobene oder gereizte Stimmung oder getriebene Missmutigkeit und durch mangelnde Kritikfähigkeit auszeichnen) in zeitlich unterschiedlich langen Phasen vor, daher auch die ältere Bezeichnung manisch-depressive Erkrankung. In leichter, aber über Jahre andauernder Form wird sie als Zyklothymie bezeichnet.
Das langandauernde Pendant zur (nicht manischen) Depression ist die Dysthymie. Statt Manien können bei der bipolaren Störung auch Hypomanien vorkommen, die nicht so stark ausgeprägt sind, und die oft übersehen werden oder bei Ärzten nicht geschildert werden (der Betroffene fühlt sich ja dabei gut). So stecken hinter einer rezidivierenden Depression oft bipolare Störungen, die anders behandelt werden sollten.
Es ist bekannt, dass depressive Störungen heterogen sind, aber über ihre neurophysiologisch unterschiedlichen Formen ist wenig bekannt. In einer neuen Studie haben Tokuda et al. (2018) neurophysiologische Subtypen von Depressionen identifiziert, die mit spezifischen neuronalen Substraten zusammenhängen. Durch Clusteranalysenwurden drei Subtypen von Depressionen identifiziert, von denen eine nicht auf die üblichen Medikamente anspricht. Bekanntlich ist bei depressiven Menschen der Stoffwechsel im Gehirn durcheinander geraten ist. Mindestens einer der beiden Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin liegt nicht in der optimalen Konzentration vor, sodass die Nervenzellen nicht mehr richtig miteinander kommunizieren und Impulse zwischen Hirnzellen nicht mehr richtig übertragen werden können. Neben Psychotherapien kommen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zum Einsatz, die am meisten verschriebenen Antidepressiva, die den Botenstoff Serotonin im Gehirn wieder ins Lot bringen sollen, wobei aber bei etwa dreißig Prozent der Betroffenen die Medikamente keine Besserung herbeiführen. Nach Tokuda et al. (2018) gibt es eine Gruppe von depressiven Menschen mit einem Trauma aus ihrer Kindheit, bei denen die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer keinerlei Wirkung zeigen.
Selbstmord und präsuizidales Syndrom
Quelle: https://lexikon.stangl.eu/294/depression/ (08.09-09
Wochenbettdepression
Nach neuesten Forschungen ist ein Enzym die Ursache für die Wochenbettdepression bei Frauen einige Tage nach der Geburt, die etwas mehr als 10 Prozent der Mütter betrifft, wobei diese Wochenbettdepression in der Regel nach einigen Tagen von selbst verschwindet. Bekanntlich fällt in den ersten drei bis vier Tagen nach der Geburt der Östrogenspiegel sehr stark, woraufhin die Konzentration der Monoamin-Oxidase A ansteigt. Die Monoamin-Oxidase A sammelt sich vier bis sechs Tage nach der Entbindung im Gehirn der Mütter an und baut dort Botenstoffe für das positive emotionale Erleben wie Serotonin ab.
Nach einer australischen Studie von Jan Nicholson (Parenting Research Centre in Melbourne) ist übrigens auch fast jeder zehnte Vater nach der Geburt eines Kindes voller Sorgen und sieht oft das Ende des Tunnels nicht mehr. Die Symptome sind dabei ähnlich wie bei der Wochenbettdepression junger Mütter. Die WissenschaftlerInnen hatten 5000 junge Mütter und 3471 Väter befragt, in denen von jungen Vätern Angstzustände, Sorgen sowie Gefühle, es nicht zu schaffen, beschrieben wurden.
Altersdepression
Eine weitere Sonderform ist die Altersdepression: bei den 70- bis 74-jährigen sind 14 % depressiv, bei über 80-jährigen sind es 42 %, auch hier Frauen doppelt so häufig wie Männer. Diese Zahlen belegen, dass ältere Menschen häufiger an Depression erkranken als jüngere. Allerdings gehen die Alterspsychiater heute davon aus, dass es keine spezielle Altersdepression gibt, sondern alle Formen der Depression auch im höheren Lebensalter vorkommen können.
Bei etwa 10 % der Frauen kommt es nach einer Geburt zu einer postpartalen Depression, für die hormonelle Ursachen vermutet werden.
Siehe auch Herbstblues, Winterdepression
Depression als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen
Verschiedene körperliche Zustände oder Erkrankungen können die Ursache einer symptomatischen Depression sein. Dazu zählen viele Hormonstörungen, beziehungsweise Veränderungen im Regelkreis der Hormone, zum Beispiel Umstellung der Sexualhormone nach der Schwangerschaft oder während der Pubertät, bei Schilddrüsenfunktionsstörungen und Hypophysen- oder Nebennierenerkrankungen. Ebenso stehen bestimmte Viren wie z. B. das Borna Virus in Verdacht zu funktionellen Störungen des Gehirns beizutragen, welche letztendlich zu Depressionen führen. Auch können medikamentöse Therapien Depressionen auslösen, so etwa Betablocker aber auch viele andere Medikamente, etwa die Therapie mit gewissen Immunmodulatoren bei Hepatitis.
Bei korrekter Anamnese und fachgerechter Behandlung der Grunderkrankung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch die Depression verschwindet. Beispielsweise leiden Personen mit stark schwankenden Blutzucker häufig unter depressiver Verstimmung. Wenn durch geeignete Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, Sport oder ggf. Diabetesbehandlung der auslösende Zustand Blutzuckerschwankung beseitigt wird, mildert sich auch die vermeintlich psychisch bedingte Depression ab.
Auch Umweltgifte wie z. B. Schwermetalle oder Holzschutzmittel stehen in Verdacht, eine Depression verursachen zu können.
Posttraumatische Folgen eines Unfalls
Manche Unfälle sind aber nicht nur traumatisierende Erlebnisse, da sie mit akuter Lebensgefährdung einhergingen, sondern ziehen oft schmerzhafte und zum Teil langwierige Behandlungen nach sich. Durch den intensivmedizinischen Fortschritt sind die Überlebenschancen auch bei sehr schweren Verletzungen deutlich gestiegen, wobei viele Verletzte langfristig unter funktionalen oder ästhetischen Einschränkungen leiden. So können einfache Tätigkeiten im Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe durchgeführt werden.
Die psychische Befindlichkeit spielt aber eine bedeutende Rolle im Heilungsverlauf, bei der Rehabilitation und im sozialen bzw. beruflichen Reintegrationsprozess. So hängt etwa die Dauer einer Arbeitsunfähigkeit neben der Verletzungsschwere eng mit psychischen Faktoren wie etwa der häufig anzutreffenden Depressivität kurz nach einem Unfallereignis zusammen.
Viele Verletzte leiden unmittelbar nach dem Unfall unter Schlafstörungen, Ängsten, Alpträumen und anderen Symptomen akuter Belastungsreaktionen, die üblicherweise nach einiger Zeit wieder von selbst abklingen. Die Prävalenzraten psychischer Störungen bei Verletzten sind deutlich erhöht, wobei als häufigste Folgen Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Alkohol- und Suchterkrankungen auftreten, die oft mit sozialem Rückzug und verminderter Lebensqualität einhergehen. Hier besteht die Gefahr einer Chronifizierung, etwa bei Verletzten, die ihr aufgrund einer Narbenbildung ihr verändertes Aussehen ablehnen und ein negatives Körperbild entwickeln.
Siehe auch Depressionen und Suizidalität im Kindes- und Jugendalter
Kulturelle Einflüsse auf die Suizidgefährdung und Risikofaktoren
Ein Suizidversuch oder ein Suizid wird meist nur als persönliche Tragödie wahrgenommen, weshalb manchmal auch der gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhang ausgeblendet wird, der aber nachweislich von großer Bedeutung ist. Beim Wechsel von einem kulturellen Kontext in einen anderen, wie es bei vielen MigrantInnen der Fall ist, haben viele Menschen in der neuen Umgebung Probleme, sich einzufinden. Einsamkeit, Heimweh und auch der Statusverlust führen bei einigen zu Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken, wobei die Warnzeichen meist unerkannt bleiben, was unter anderem daran liegt, dass MigrantInnen nur selten offen von ihren Beschwerden erzählten. Der Weg zu einem Therapeuten ist für MigrantInnen oft deshalb problematisch, da diese Menschen Angst vor einer Stigmatisierung in ihrer eigenen kulturellen Subkultur haben. Migration kann daher in manchen Fällen eine gewichtige Rolle spielen, denn sowohl der Anpassungsprozess an ein Einwanderungsland als auch dortige Diskriminierung können in einen Suizidversuch münden. Jedoch haben nicht alle Migranten ein höheres Risiko, denn z.B. unterscheidet sich die Sellbsttötungsrate von türkischen Männern in der BRD nicht von der im Herkunftsland, während die Häufigkeit von vollendeten Suiziden bei Mädchen und jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund ungefähr doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen Frauen aus deutschen Familien ist. Auch übersteigt diese Rate an Suizidversuchen bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund sogar um das Fünffache, wobei Frauen mit türkischem Migrationshintergrund zudem bei ihrem Suizidversuch deutlich jünger sind als deutsche. Die höchste Suizidversuchsrate zeigte sich bei Migrantinnen der zweiten Generation. Als eine wichtige Ursache für Suizidgedanken und Suizide bei jungen türkischen Frauen wurde die große Spannung zwischen traditionellen Rollenerwartungen in der Familie und modernen Lebensformen im Aufnahmeland gefunden. Eine niederländische Studie zeigte, dass ein großer Teil der türkischen Migrantinnen Suizidversuche vornahmen, weil sie ihr Leben als zu kontrolliert empfanden und ihre Angehörigen sie mit einer "Verletzung der Familienehre" konfrontierten. Auch der Zugang zum psychosozialen Versorgungssystem ist für Menschen mit Migrationshintergrund erschwert. Migration bedeutet insbesondere dann eine psychische Belastung, wenn unter anderem niedriger sozialer Status, soziale Isolierung, weiblicher Rollenkonflikt oder auch vorbestehende seelische Krankheiten hinzu kommen. Für manche stellt Migration aber eine Chance für eine positive persönliche Entwicklung dar, wofür es nach Ansicht von WissenschaftlerInnen so etwas wie "Schutzfaktoren" gegen seelischen Stress durch Migration geben muss, etwa den Grad der sozialen Unterstützung, also ein positives und die eigene Lebensplanung förderndes persönliches Umfeld, das eben anders ist als eine starke soziale Kontrolle, die sich an überkommenden Maßstäben orientiert. Als zweiter Faktor ist vermutlich die "Selbstwirksamkeitserwartung", also der Glaube daran, aufgrund der eigenen Fähigkeiten sein Leben erfolgreich gestalten zu können. Auch sind extrovertierte Menschen, die sich nach Außen öffnen können eher in der Lage, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die mit einer neuen Lebensumgebung verbunden sind.
Depression und Gangmuster
Die Gangmuster depressiver Menschen sind unter anderem durch eine langsamere Gehgeschwindigkeit und durch weniger starke Auf- und Abbewegungen des Oberkörpers gekennzeichnet. Diese Menschen neigen auch zum Schlurfen, während sich gesunde Menschen beim Gehen eher abstoßen. Außerdem hat man bei depressiven Menschen eine zusammengesunkene Körperhaltung, weniger Armschwingungen, dafür aber stärkere seitliche Schwankungen festgestellt. Diese gehen also weniger zentriert, sondern schwanken eher nach rechts und links. Man hat auch untersucht, wie sich Gangbilder auf das Gedächtnis auswirken. Depressive neigen dazu, sich negative Informationen zu merken, nicht-depressive dagegen positive Informationen. Bei einer Studie mit psychisch gesunden Menschen hat man gefunden: Menschen, die sozusagen depressiv gehen, behalten eher negative Informationen als Menschen, die sich fröhlicher bewegen. Wenn man gezielt dynamischer geht, behält man also eher positive Dinge im Gedächtnis.
Literatur
Razum Oliver & Zeeb Hajo (2004). Suizidsterblichkeit unter Türkinnen und Türken in Deutschland. Nervenarzt,
1092-1098.
Bhui Kamaldeep S., McKenzie Kwame & Rasul Farhat (2007). Rates, risk factors & methods of self harm among
minority ethnic groups in the UK: a systematic review. BMC Public Health;19, 7, 336.
De Leo, D., Burgis, S., Bertolote, J.M., Kerkhof, A.J.F.M. & Bille-Brahe, U. (2006). Definitions of Suicidal
Behaviour: Lessons Learned from the WHO/EURO Multicentre Study. Crisis, 27, 4-15.
Yilmaz, A.T. & Riecher-Rössler, A. (2008). Suizidversuche in der ersten und zweiten Generation der ImmigrantInnen
aus der Türkei. Neuropsychiatrie, 22: 261-267.
Koch, E. & Pfeiffer, W. (2000). Migration und transkulturelle Psychiatrie. Curare 23, 133–139.
van Bergen, D.D., Smit, J.H., van Balkom, A.J., van Ameijden, E. & Saharso, S. (2008). Suicidal ideation in ethnic
minority and majority adolescents in Utrecht, the Netherlands. Crisis, 29(4): 202-208.
Schouler-Ocak, M. (2008). Psychiatrische Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund. In: Rentrop M,
Müller R, Bäuml J (Hrsg.). Klinikleitfaden Psychiatrie und Psychotherapie. 4. Auflage, München: Urban & Fischer.
Goodwin, R.D., Gotlib I.H. (2004). Gender differences in depression: the role of personality factors. Psychiatry
Research, 135-142.
Schwarzer, R. (1994). Optimistische Kompetenzerwartung: Zur Erfassung einer personellen
Bewältigungsressource. Diagnostica, 40, 105-123.
Cukrowicz, K.C., Franzese, A.T., Thorp, S.R., Cheavens, J.S. & Lynch, T.R.. (2008). Personality traits and
perceived social support among depressed older adults. Aging & Mental Health, 12, 662-669.
Johannes Michalak in einem Interview in der Augsburger Allgemeinen vom 8. September 2020.
Zusammengefasst nach http://www.idw-online.de/pages/de/attachment5253 (10-10-10)
Literatur zum Thema Depression
Behandlung der Depression
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::