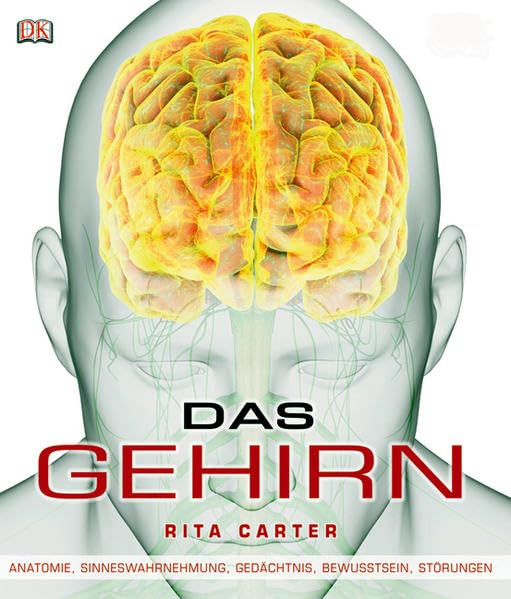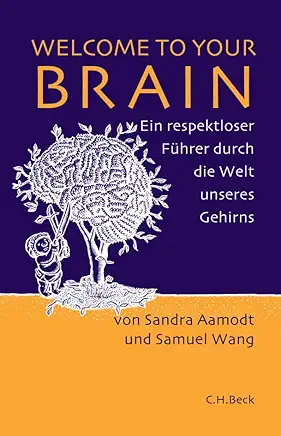Das menschliche Gehirn
zum ersten Welttag des Gehirns erklärt.
Der Welttag des Gehirns soll zu mehr Aufmerksamkeit
für die Bedeutung der Gehirngesundheit
und zur Prävention beitragen.
Das menschliche Gehirn dient nicht der Wahrheit, sondern dem Überleben.
Stefan Klein in Wie wir die Welt verändern: Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes
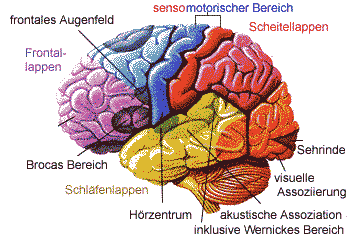 Mehr als 650 Millionen Jahre brauchte die Evolution,
um die anfangs sehr einfachen Nervensysteme in der Tierwelt zum
menschlichen Gehirn weiterzuentwickeln. Das menschliche Gehirn in all
seiner Komplexität basiert jedoch auf jenen Bausteinen (Nervenzellen)
und Kommunikationsmitteln (elektrische und chemische Signale), die schon
bei einfachen Lebewesen zu finden sind. Auch das Darmbakterium
Escherichia coli ist fähig, auf Reize in seiner Umgebung sinnvoll zu
reagieren, wobei ihm spezielle Empfangsmoleküle in der Zellwand helfen,
Nahrungsquellen oder Giftstoffe wahrzunehmen. Werden diese Rezeptoren
gereizt, erzeugen sie chemische Signale, die den Einzeller
veranlassen, sich mit seinen propellerartigen Geißeln in die günstigste
Richtung zu bewegen. Diese Form des Signalverkehrs hat die Natur auf
dem Weg zum Menschenhirn beibehalten. Komplexere Lebewesen brauchten
aber eine Instanz, die die Informationen aus unterschiedlichen
Körperregionen zusammenführt, ein Ergebnis daraus ableitet und die
Reaktion steuert: die Nervenzellen (Neurone). Sie bildeten sich aus
Zellen der äußeren Hautschicht, die unmittelbar der Umgebung ausgesetzt
waren und spezialisierten sich darauf, Reize zu empfangen, zu
verarbeiten und weiterzuleiten. Quallen gehören zu den ältesten heute
noch existierenden Organismen, die über ein solches einfaches
Nervensystem verfügen, das aus einem Netz miteinander verbundener Neurone
besteht, das den ganzen Körper durchzieht. Doch ein Gehirn wie beim
Menschen findet sich beiihnen noch nicht. Erst bei den Würmern - im
Gegensatz zu radialsymmetrischen Tieren wie Quallen oder Seesternen-
lassen sich vorn und hinten unterscheiden – und das bedeutete einen
gewaltigen Sprung bei der Evolution des Gehirns. Schlägt ein Tier
bevorzugt eine Richtung ein, also vorwärts, ist es sinnvoll, wenn sich
ein Großteil seiner Nerven und Sinneszellen am vorderen Ende
konzentriert. Schließlich kommt dieser Teil meist als Erster mit den
Verheißungen und Gefahren einer neuen Umgebung in Berührung. Dieser
Bauplan wurde von der Evolution beibehalten: Vorn sitzt ein Kopf und
darin ruht das Gehirn als zentrale Schaltstelle. Mit der Zeit prägte
sich dadurch der Kopf stärker aus, denn das Gehirn legte an Volumen zu.
Nach und nach wurde es immer leistungsfähiger, weil die Zahl der Neurone
und ihrer Verknüpfungen untereinander zunahm. Ursache dieser
Entwicklung waren Mutationen, die sich als vorteilhaft für den Organismus erwiesen.
Wichtige Gene wurden doppelt an die nächste Generation weitergegeben,
wobei die Gen-Kopie nun ihrerseits mutieren konnte, ohne die
Lebensfähigkeit des Organismus aufs Spiel zu setzen.
Dank solcher Gene wuchsen zusätzliche Neurone, die sich dann für neue
Aufgaben nutzen ließen. Natürlich konnte das Hinterteil des Wurms nicht
ganz auf Nervenzellen verzichten, deshalb durchzieht ein Nervenstrang
der Länge nach seinen Leib – wie bei Menschen das Rückenmark.
Die später entstandenen Insekten besitzen hingegen in Segmente
gegliederte Körper, bei denen jeder Abschnitt zwei Nervenknoten
(Ganglien) besitzt, die wie Minihirne das jeweilige Segment steuern. Die
Ganglien sind zu einer strickleiterartigen Struktur verknüpft, die in
den Kopf führt. Dort sitzt ihr größeres Pendant, das eigentliche Gehirn,
und koordiniert die Signale der Nervenzellen.
Mehr als 650 Millionen Jahre brauchte die Evolution,
um die anfangs sehr einfachen Nervensysteme in der Tierwelt zum
menschlichen Gehirn weiterzuentwickeln. Das menschliche Gehirn in all
seiner Komplexität basiert jedoch auf jenen Bausteinen (Nervenzellen)
und Kommunikationsmitteln (elektrische und chemische Signale), die schon
bei einfachen Lebewesen zu finden sind. Auch das Darmbakterium
Escherichia coli ist fähig, auf Reize in seiner Umgebung sinnvoll zu
reagieren, wobei ihm spezielle Empfangsmoleküle in der Zellwand helfen,
Nahrungsquellen oder Giftstoffe wahrzunehmen. Werden diese Rezeptoren
gereizt, erzeugen sie chemische Signale, die den Einzeller
veranlassen, sich mit seinen propellerartigen Geißeln in die günstigste
Richtung zu bewegen. Diese Form des Signalverkehrs hat die Natur auf
dem Weg zum Menschenhirn beibehalten. Komplexere Lebewesen brauchten
aber eine Instanz, die die Informationen aus unterschiedlichen
Körperregionen zusammenführt, ein Ergebnis daraus ableitet und die
Reaktion steuert: die Nervenzellen (Neurone). Sie bildeten sich aus
Zellen der äußeren Hautschicht, die unmittelbar der Umgebung ausgesetzt
waren und spezialisierten sich darauf, Reize zu empfangen, zu
verarbeiten und weiterzuleiten. Quallen gehören zu den ältesten heute
noch existierenden Organismen, die über ein solches einfaches
Nervensystem verfügen, das aus einem Netz miteinander verbundener Neurone
besteht, das den ganzen Körper durchzieht. Doch ein Gehirn wie beim
Menschen findet sich beiihnen noch nicht. Erst bei den Würmern - im
Gegensatz zu radialsymmetrischen Tieren wie Quallen oder Seesternen-
lassen sich vorn und hinten unterscheiden – und das bedeutete einen
gewaltigen Sprung bei der Evolution des Gehirns. Schlägt ein Tier
bevorzugt eine Richtung ein, also vorwärts, ist es sinnvoll, wenn sich
ein Großteil seiner Nerven und Sinneszellen am vorderen Ende
konzentriert. Schließlich kommt dieser Teil meist als Erster mit den
Verheißungen und Gefahren einer neuen Umgebung in Berührung. Dieser
Bauplan wurde von der Evolution beibehalten: Vorn sitzt ein Kopf und
darin ruht das Gehirn als zentrale Schaltstelle. Mit der Zeit prägte
sich dadurch der Kopf stärker aus, denn das Gehirn legte an Volumen zu.
Nach und nach wurde es immer leistungsfähiger, weil die Zahl der Neurone
und ihrer Verknüpfungen untereinander zunahm. Ursache dieser
Entwicklung waren Mutationen, die sich als vorteilhaft für den Organismus erwiesen.
Wichtige Gene wurden doppelt an die nächste Generation weitergegeben,
wobei die Gen-Kopie nun ihrerseits mutieren konnte, ohne die
Lebensfähigkeit des Organismus aufs Spiel zu setzen.
Dank solcher Gene wuchsen zusätzliche Neurone, die sich dann für neue
Aufgaben nutzen ließen. Natürlich konnte das Hinterteil des Wurms nicht
ganz auf Nervenzellen verzichten, deshalb durchzieht ein Nervenstrang
der Länge nach seinen Leib – wie bei Menschen das Rückenmark.
Die später entstandenen Insekten besitzen hingegen in Segmente
gegliederte Körper, bei denen jeder Abschnitt zwei Nervenknoten
(Ganglien) besitzt, die wie Minihirne das jeweilige Segment steuern. Die
Ganglien sind zu einer strickleiterartigen Struktur verknüpft, die in
den Kopf führt. Dort sitzt ihr größeres Pendant, das eigentliche Gehirn,
und koordiniert die Signale der Nervenzellen.
Das Wort Gehirn bzw. Hirn geht über das Mittelhochdeutsche hirn(e), das Althochdeutsche hirn(i) auf die germanische Wurzel hersnja zurück und beruht auf einem Wort, das noch in den nordischen Sprachen in der Bedeutung „Schädel, Schädeldecke“ erhalten ist, und bezeichnet demnach das im Schädel Befindliche.
Der heute in der Hochsprache gebräuchliche Begriff Gehirn ist dabei ein Kollektivum zu Hirn, also ein Sammelbegriff bzw. eine Sammelbezeichnung, womit eine unbestimmte Anzahl gleichartiger Dinge oder Sachverhalte in einer Klasse zusammengefasst werden. Gehirn ist übrigens ein im Gegensatz zum Wort Hirn relativ junges Wort, das vermutlich erst im 15. Jahrhundert entstanden ist, als viele kollektive Wortschöpfungen mit der Vorsilbe Ge- entstanden, z. B. Gesang, Geduld, Gebeine, Gebäude oder Gebilde.
Anders entwickelten sich die Gehirne der Wirbeltiere, denn sie sind dynamischer und auf individuelle Entwicklung und Veränderung angelegt, damit sie sich in einer variablen Umwelt besser behaupten können. Der Schaltplan der Neurone, also das Muster der Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen, wird in hohem Maße durch äußere Einflüsse während der Entwicklung des Embryos und in den frühen Lebensphasen bestimmt (s.u.). Während sich der Hirnstamm im Verlauf der Evolution relativ wenig veränderte, wurde das Vorderhirn ständig erweitert. Der Fortschritt hin zu immer mehr Leistung, Lernbereitschaft und zu komplexeren Fähigkeiten ist in erster Linie dem Aufblähen einer äußeren Schicht des Vorderhirns, der Großhirnrinde, zu verdanken. Ihr stammesgeschichtlich jüngster Teil, der Neokortex, existiert nur bei Säugetieren. Bei Menschen macht er knapp die Hälfte des Hirnvolumens aus. Je weiter entwickelt das Gehirn eines Wirbeltieres ist, desto größer sind die Areale seiner Großhirnrinde, die sich nicht mehr eindeutigen Funktionen wie etwa Sehen oder Hören zuordnen lassen. Diese assoziativen Areale ermöglichen Wirbeltieren erst ein flexibles Reagieren, also auf einen Reiz nicht nur mit einem festgelegten Verhalten zu antworten. Obwohl der Bau der Gehirns zur Zeit der Geburt in seinen Grundzügen längst abgeschlossen ist, ändert sich im Verlauf der folgenden Jahre die Dichte der Synapsen rasant, um sich später wieder zu halbieren. Übrigens war das Gehirn des Menschen nicht immer so kugelförmig wie heute, denn vor mehr als fünfunddreißigtausend Jahren war die Gehirnform des Homo sapiens noch eher länglich, d. h., das menschliche Gehirn hat seine typische runde Form erst relativ spät in der Evolutionsgeschichte bekommen. Erst Fossilienfunde des Homo sapiens, die jünger sind, besitzen die gleiche runde Form wie die Menschen heute. Das hängt damit zusammen, dass sich die moderne Gehirnorganisation offenbar bis zu diese Zeit herausbildete, und zwar unabhängig von der Gehirngröße, denn schon die ältesten Fossilien, die auf ein Alter von etwas dreihunderttausend Jahren datiert wurden, besaßen eine ähnliche Gehirngröße wie heute lebende Menschen. Heute entwickelt sich die charakteristische runde Form des Gehirns und des Gehirnschädels innerhalb weniger Monate um den Zeitpunkt der Geburt herum, wobei vermutlich evolutionäre Veränderungen der frühen Hirnentwicklung für komplexe Denkprozesse beim Menschen entscheidend waren.
Literatur
http://www.idw-online.de/
pages/de/news354989 (10-02-10)
Andras Jakab, Ernst Schwartz, Gregor Kasprian, Gerlinde M. Gruber, Daniela Prayer, Veronika Schöpf & Georg Langs (2014). Fetal functional imaging portrays heterogeneous development of emerging human brain networks. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 852.
V Schöpf, T Schlegl, A Jakab, G Kasprian, R Woitek, D Prayer, G Langs (2014). The Relationship Between Eye Movement and Vision Develops Before Birth. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 775.
In der vorgeburtlichen Gehirnentwicklung gibt es im Gehirn kurzzeitig richtige Straßen, auf denen sich bestimmte Zelltypen bewegen, wobei diese von kleinen Signalproteinen, den Chemokinen, an ihren Einsatzort gelockt werden. Man kennt etwa 50 Chemokine. Das Zusammenspiel dieser kleinen Neuropeptide mit hochspezifischen Rezeptoren in den Zellmembranen wirkt wie ein Navigationssystem für die Zellwanderung. Ist das Gehirn einmal herausgebildet, hat nach der Geburt das Zusammenspiel eines Chemokins und seines Rezeptors kaum noch Bedeutung. Wenn allerdings eine Hirnregion geschädigt wird, etwa durch einen Schlaganfall, dann werden plötzlich große Mengen des Chemokins produziert, um Zellen an die Unglücksstelle zu beordern. Und die Nervenzellen, die in wenigen Hirnregionen auch bei Erwachsenen noch gebildet werden, reagieren auf diesen Ruf. Bedauerlicherweise lockt dieses System auch Immunzellen an, die den aufgetretenen Schaden verschlimmern.
Nach neueren Untersuchungen wird besonders im mittleren Zeitraum der Schwangerschaft die Architektur des Gehirns entwickelt, wobei sich vor allem im Zeitraum der 26. bis 29. Schwangerschaftswoche sich neuronale Verbindungen von kurzer Reichweite besonders aktiv entwickeln, während im Gegensatz dazu Langstreckenverbindungen eher ein lineares Wachstum während der Schwangerschaft anzeigten. Es zeigte sich, dass im Gehirn zuerst die Bereiche für die Sinneswahrnehmungen entwickelt werden und dann erst etwa vier Wochen später die Bereiche für komplexere, kognitive Fähigkeiten. So beginnen Ungeborene bereits in den Schwangerschaftswochen 30 bis 36 Netzwerke des Gehirns, die später für das Sehen verantwortlich sind, zu nutzen, obwohl Neugeborene die Verarbeitung der optischen Reize nach der Geburt erst lernen müssen. Bereits in diesem Stadium der Entwicklung verknüpfen sich motorische Sehbewegungen mit den für die Verarbeitung der optischen Signale zuständigen Bereiche im Sehzentrum des Gehirns.
Übrigens verändert sich in dieser Zeit auch das Gehirn der Mutter: Während der Schwangerschaft steigen der Progesteron- und der Östrogenspiegel um das zehn- bis fünfzehnfache, und das hat heftige Auswirkungen auf den weiblichen Organismus, wie zum Beispiel das Herz oder auch den Stoffwechsel, aber auch spezifische Auswirkungen auf das Gehirn. Dieser erhöhte Hormonspiegel bewirkt auch beim schwangeren Frauen Neuverschaltungen in gewissen Arealen, wobei bestimme kognitive Fähigkeiten dabei heruntergefahren werden, gleichzeitig werden Areale, die Emotionen auslösen und verarbeiten, deutlich aktiver. Das Gehirn wird so vermutlich auf eine möglichst große emotionale Bindung zum Nachwuchs vorbereitet. Siehe dazu Baby Brain – gibt es das wirklich?
Neuere Forschungen (Schöpf et al., 2014), bei denen man in utero den Zusammenhang von Augenbewegungen des Fötus mit den Gehirnaktivitäten untersuchte, zeigen, dass das Sehzentrum im Gehirn schon beim Fötus äußerst aktiv ist, obwohl dieser noch gar nichts sieht, allerdings müssen Neugeborene die Verarbeitung des Gesehenen erst erlernen. Neugeborene sehen nach der Geburt noch sehr verschwommen und nur in einem Abstand von 20 bis 25 Zentimetern einigermaßen genau, dennoch beginnt das für das Sehen zuständige Gehirnareal bereits ab der 30. Schwangerschaftswoche im Fötus zu arbeiten. Im Detail: Zwischen der 30. und 36. Schwangerschaftswoche verknüpfen sich motorische Sehbewegungen mit den für die Verarbeitung der optischen Signale verantwortlichen Hirnregionen. Die Entwicklung der funktionellen Netzwerke folgt dabei der evolutiven Entwicklung, wobei primäre Areale, die für die basalen Grundlagen des Lebens wie das Sehen arbeiten und die bereits bei Primaten zu finden sind, früher in der Individualentwicklung ausgebaut werden als sekundäre Regionen, die evolutiv erst später ausgebildet wurden, wie etwa das logische Denken. Die primären Bereiche sind bei den einzelnen Menschen sehr ähnlich aufgebaut, während die jüngeren Regionen der Individuen sehr variabel gestaltet sind.
Das menschliche Gehirn wächst dabei unmittelbar nach der Geburt am schnellsten und erreicht innerhalb von drei Monaten die Hälfte der Größe im Erwachsenenalter, wobei das männliche Gehirn in diesem Alter schneller wächst als das weibliche. Die Gehirne von Neugeborenen wachsen dabei pro Tag im Durchschnitt um ein Prozent, wobei sich am Ende der neunzig Tage dieser Wert auf 0,4 Prozent am Tag verlangsamte. Das rascheste Wachstum zeigt das Cerebellum, jener Bereich des Gehirns, der mit der Kontrolle von Bewegungen in Zusammenhang steht, d. h., die Grösse dieses Bereiches verdoppelt sich innerhalb dieser Zeitspanne. Am langsamsten entwickelt sich der Hippocampus, jener Bereich, der für Erinnerungen steht, wobei dies einen Hinweis auf die relative Bedeutung dieser Areale für Kleinkinder darstellen dürfte.
Besonders groß ist die Veränderung der Hirnrinde, denn deren Oberfläche verdreifacht sich zwischen Geburt und dem 20. Lebensjahr, wobei sich ein Viertel des Cortex überproportional ausdehnt und wächst rund zwei Mal so schnell wie seine Umgebung. Von diesem Wachstumsschub betroffen sind vor allem Regionen im seitlichen, präfrontalen und medialen Cortex, die allgemein mit höheren geistigen Leistungen wie Sprache und logisches Denken verknüpft werden. Aus Vergleichen zwischen Menschen und Primaten weiß man, dass diese unmittelbar nach der Geburt wachsenden Gehirnregionen einem starken evolutionären Wandel unterworfen waren, der das menschliche Gehirn und insbesondere jene Teile größer gemacht hat als bei jedem anderen Primatengehirn. Untersuchungen zeigten auch, dass diese sich übermäßig ausdehnenden Regionen langsamer als der Rest des Hirns ausreifen, wobei man dahinter das gestalterische Prinzip der Evolution vermutet, mit der lokal verzögerten Reifung die Lernfähigkeit des Gehirn zu verbessern und diesem stärker die formende Kraft der Umwelt einzuschreiben. Allerdings handelt es sich dabei eher nicht um eine Wiederholung der Stammesgeschichte in der Individualentwicklung, wie Ernst Haeckel noch vermutet hatte.
Die Bewegungen des ungeborenen Kindes bzw. die Häufigkeit dieser Bewegungen des Kindes sind eng mit der körperlichen Fitness des Kindes nach der Geburt verknüpft ist. Minlebaev et al. (2011) vermuten, dass diese Bewegungen eine funktionelle Bedeutung durch die dabei ablaufenden neuronalen Prozesse für die Entwicklung des Gehirns haben. Die spontanen Zuckungen und die Rückmeldungen dienen dazu, allmählich eine neuronale topographische Karte der einzelnen Körperteile im Gehirn auszubilden bzw. den Aufbau einer funktionellen topographischen Repräsentation des Körpers im Gehirn. Jede Wiederholung der Bewegung verknüpft so immer mehr die Neurone des Cortex und des Thalamus zu einer topographischen funktionellen Einheit.
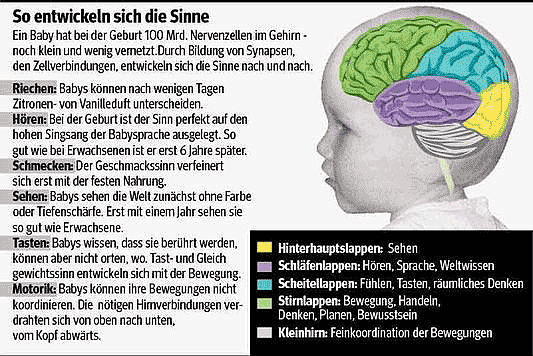
Das Gehirn eines neugeborenen Kindes verfügt nach Schätzungen bereits über etwa 125 Milliarden Nervenzellen - etwa die gleiche Anzahl wie bei Erwachsenen -, die aber noch kleiner und wenig miteinander vernetzt sind. Daher beträgt das Gewicht des Gehirns bei der Geburt etwa nur ein Viertel des eines Erwachsenen. Die Verknüpfungen der Nervenzellen untereinander entstehen zum größten Teil erst nach der Geburt, d.h., die Gehirnzellen bilden nach und nach Synapsen aus, wobei erst die Verknüpfungen untereinander die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ausmachen. Das Gehirn eines neugeborenen Kindes ist daher im Vergleich zu Tiergehirnen relativ frei in seinen Entwicklungsmöglichkeiten, aber zugleich zur weiteren Entwicklung auf Stimulation und Reize von außen angewiesen. Jeder Impuls aus seiner Umgebung in den ersten Lebenstagen und Monaten wie Lächeln, Streicheln, Worte, Wiegen oder das Vorsingen von Liedern sorgt für mehr Verbindungen zwischen den Neuronen (siehe dazu Hospitalismus). Nach neueren Untersuchungen (Rathborn, et al. 2011) ist die Phase unmittelbar vor Ende der Schwangerschaft kritisch für die Gehirnentwicklung, denn in dieser Zeit wächst vor allem die Großhirnrinde, also der für das Denken und Bewusstsein wichtige Bereich des Gehirns. In einer Studie wurden Frühgeborene vom Zeitpunkt ihrer Geburt bis zum Alter von sechs Jahren untersucht, wobei man von der Geburt bis zum regulären Geburtstermin mittels bildgebendem Verfahren regelmäßig die Größe der Großhirnrinde maß. Zwei und sechs Jahre später überprüfte man die geistigen Leistungen der Kinder mit Hilfe mehrerer gängiger Tests, wobei die mit der Großhirnrindengröße zusammenhängenden Unterschiede in den geistigen Fähigkeiten groß, konsistent und spezifisch waren, denn waren die Oberflächen der Großhirnrinde in der 44. Woche fünf bis elf Prozent kleiner als die von normal geborenen Säuglingen, dann schnitten diese Kinder mit sechs Jahren in den Tests um eine Stufe schlechter ab.
Das Gehirn eines Menschen hat bei der Geburt erst knapp dreißig Prozent der Gehirngröße eines Erwachsenen, bei Schimpansenbabys liegt dieser Wert bei vierzig Prozent. Beim Menschen ist das Gehirn eines Neugeborenen an die fünfzig Prozent größer als bei Gorillas, doch das menschliche Neugeborene wiegt etwa doppelt so viel.
Nach einer Studie von Simon-Areces et al. (2012) macht es für das Gehirn eines Neugeborenen einen Unterschied, ob es in einer normalen Geburt oder durch einen Kaiserschnitt entbunden wird, denn Vaginalgeburten sorgen für die Ausschüttung eines Proteins, das die Entwicklung des Hippocampus beeinflusst, während eine Sektio-Geburt diese Ausschüttung nur abgeschwächt stattfindet. Bisher ist vor allem die nachteilige Wirkung der Schnittgeburt auf die Atmung und für die Lunge nachgewiesen.
Viele Spuren im Gehirn entstehen erst dann, wenn der Säugling ein hohes Maß an Zuwendung und Zuneigung erhält, wenn ihm seine Eltern die Welt der Gefühle, Gerüche, Töne, Dinge und Bewegungen eröffnen, wodurch neuronale Schaltkreise entstehen, die Gedanken, Muster, Bilder und Fakten widerspiegeln. Bei Babys vermehrt sich die Zahl der Synapsen während mancher Zeiträume geradezu explosionsartig, wobei die ersten drei Lebensmonate vor allem der Entwicklung der Sinne gewidmet sind.
Wenn das Gehirn einen bestimmten Entwicklungszustand erreicht hat, lernen nach einer schwedischen Untersuchung alle jungen Säugetiere, also auch der Mensch, zur gleichen Zeit das Gehen bzw. Laufen, wobei der Zustand, der für das Gehen notwendig ist umso später erreicht wird, je größer das Gehirn eines erwachsenen Tieres am Ende sein wird. Neben dem Stand der Gehirnentwicklung spielen aber auch die Form und Funktion der Gliedmaßen eine wichtige Rolle.
Forscher stellten übrigens in Experimenten an Mäusen fest, dass jene Gene, die für das Funktionieren des Gehirns durch die Sythetisierung von benötigten Substanzen wichtig sind, mehrheitlich auf stabilen Genabschnitten zu finden sind. Das deutet darauf hin, dass das Gehirn evolutionär betrachtet ein Organ ist, bei dem keine Experimente "erwünscht" sind. Wenn von einem Stoff im Gehirn eines Individuums plötzlich zu viel oder zu wenig hergestellt wird, könnte dies nämlich verheerende Folgen haben. Übrigens entscheidet ein einziges Gen (GSK-3) zumindest bei genmanipulierten Mäusen während der Entwicklung des Embryos darüber, wie viele Hirnzellen später zur Bildung des Gehirns zur Verfügung stehen, denn es bestimmt, wie oft sich die Zellen teilen, die sich dann im weiteren Verlauf der Entwicklung in Nervenzellen verwandeln. Ob das aber Auswirkungen auf die kognitiven Leistungen eines Tiers hat, ist noch unklar, da diese bekanntlich nicht nur von der Zahl der Nervenzellen, sondern auch von deren Vernetzung abhängt.
Historisches
Um zu verstehen, was die Funktionsweise des menschlichen Geistes bzw. des Gehirns ausmacht, sind seit jeher zeitgemäße Vergleiche herangezogen worden. Erst nahm man an, der Mensch werde aus Lehm geformt und ein Gott hauche ihm seinen Geist ein. Später fand man an einem hydraulischen Modell Gefallen, etwa der Vorstellung, dass der Fluss der Säfte im Körper für das körperliche und geistige Geschehen verantwortlich sei. Als im 16. Jahrhundert Automaten aus Federn, Zahnrädern und Getrieben gebaut wurden, kamen Denker wie der französische Philosoph René Descartes zu der Ansicht, Menschen seien komplexe Maschinen. Die Entdeckung der Elektrizität gab der Geistesmetaphorik neuen Schwung, denn Mitte des 19. Jahrhunderts verglich der deutsche Physiker Hermann von Helmholtz das Gehirn mit einem Telegrafen. Der Mathematiker John von Neumann konstatierte, dass die Funktion des menschlichen Nervensystems digital sei und zog immer neue Parallelen zwischen den Bestandteilen der damaligen Rechenmaschinen und den Komponenten des menschlichen Gehirns. Nun ist die Vorstellung, das Gehirn arbeite wie ein Computer, die aktuellste Metapher, die in jeder Debatte über Künstliche Intelligenz auftaucht, doch der Vergleich hat weder etwas mit dem aktuellen Wissen über das Gehirn zu tun noch mit der menschlichen Intelligenz oder einem persönlichen Selbst, denn es gibt einen unüberbrückbaren Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Das zentrale Problem der Künstlichen Intelligenz ist die Komplexität der Welt, denn um damit umzugehen, ist ein neugeborener Mensch bereits mit evolutionär weitergereichten Potenzialen ausgestattet, etwa mit seinen Sinnen, einer Handvoll Reflexen, die für sein Überleben wichtig sind und mit leistungsfähigen Lernmechanismen, die es ihm ermöglichen, sich schnell zu verändern, so dass er mit seiner Welt immer besser interagieren kann, auch wenn diese Welt sich permanent verändert.
Der Neurologe Magnus Heier über das Gehirn
"Sie müssen sich Ihr Gehirn wie ein unfassbar einsames Organ vorstellen. In Ihrem Gehirn entsteht zwar eine Welt, in der sich mich hören und sehen. Und wenn Sie Pech haben, riechen Sie mich auch. Sie haben also eine präzise Vorstellung von Ihrer Umgebung. Das ist natürlich alles Quatsch. Ihr Gehirn liegt in einer dunklen Höhle ohne jeden Kontakt nach außen. Das Gehirn hört nicht, sieht nicht, riecht nicht, fühlt nicht. Sie können es streicheln oder sogar operieren, es merkt es gar nicht. Es bekommt lediglich elektrische Signale von außen. Aus dem Auge, aus dem Ohr, von der Zunge. Und aus diesen elektrischen Signalen konstruiert es eine Welt, in der oder mit der es leben kann. Ob das irgendetwas mit der objektiven Welt da draußen zu tun hat, ist stark zu bezweifeln. Es gibt da draußen keine Farben. Was sie als „blau“ und schön empfinden ist keine Farbe, das ist eine Wellenlänge des Lichts. Im Grunde haben Sie ein wahnhafte Vorstellung Ihres Äußeren. (…) Ich nehme Ihnen damit auch die Illusion, dass Sie irgendwelche Dinge sachlich, nüchtern, objektiv, nachvollziehbar verarbeiten. Das tun Sie alles nicht. Sie sind geprägt von Eindrücken, Emotionen und Irrationalitäten. Ihre Partner-, Handy- oder Autowahl steht zum Beispiel auf ganz anderen Füßen, als Sie glauben. Wir können sogar beweisen, dass Ihre Entscheidungen umso klüger werden, je mehr Ihr Bewusstsein abgelenkt wird. Je besser und aktiver Ihr Unterbewusstsein vor Entscheidungen arbeiten kann, umso besser werden diese ausfallen."
Den Aufbau des Gehirns läßt sich am besten über das Konzept der Funktionsniveaus beschreiben: im Laufe der Evolution haben immer wieder neue Hirnstrukturen auf schon vorhandenen aufgebaut. Erst diese Überlagerungen brachten höher entwickelte Gehirnniveaus wie die der Primaten oder der Mesnchen mit sich, die zu immer komplexeren Funktionen fähig waren. Der Mensch ist mental enorm anpassungsfähig durch seine Fähigkeit, die Welt zu interpretieren, implizite wie explizite Vorhersagen über die Zukunft zu treffen und so die Folgen seines eigenen Handelns abzuschätzen. Die unerschöpfliche Flexibilität der menschlichen Hirnorganisation zeigt sich auch daran, dass es hirnbiologisch und -anatomisch keinerlei Unterschied zwischen den Menschen der Gegenwart und denen gibt, die vor 200000 Jahren gelebt haben. Schon bei der Geburt besitzt das Gehirn daher potentiell alle Voraussetzungen zum Denken und Lernen, wobei beim Menschen etwa 70 Prozent der Gehirnkapazität dem Lernen zur Verfügung stehen, etwa 30% von vornherein für bestimmte Funktionen festgelegt sind. In den ersten fünf bis sechs Lebensjahren wird das menschliche Gehirn massiv umgestaltet. Dass es keine Gehirn-Zentren für spezielle Funktionen wie Neugier, Angst oder Sehnsucht gibt, sondern dass diese durch Vernetzung entstehen, wird durch neueste neurologische Forschungen bestätigt. Heute glaubt kein Forscher mehr an einen modularen Aufbau des Gehirns, vielmehr hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Vernetzung der Hirnregionen der entscheidende Faktor für ein spezielles Persönlichkeitsmerkmal ist. Auch dürfte der Einfluss der Gene auf die Struktur des Gehirnaufbaus bzw. der Vernetzung während der Entwickung relativ hoch sein. Ein Netzwerk von Milliarden Nervenzellen reagiert auf jede Art von Eindrücken, Bildern und Informationen, indem es die Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen (Synapsen) verändert. Während solcher prägungsähnlicher Lernprozesse, werden mit Hilfe von chemischen Botenstoffen (Neurotransmitter) die elektrischen Impulse von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen. Jede Nervenzelle verfügt über einen Sender und eine Vielzahl von Empfängern, mit denen sie die Informationen der anderen Nervenzellen aufnimmt. Das Gehirn verarbeitet diese Informationen zu neuen Strukturen, oder vernetzt diese mit anderen, schon vorhandenen Strukturen. Dabei werden bestimmte neuronale Verbindungen verstärkt, andere abgeschwächt, andere verschwinden ganz. In den verschiedenen Phasen der frühkindlichen Entwicklung gibt es bestimmte Zeitfenster oder "sensitive Phasen", in denen Informationen mit viel höherer Geschwindigkeit und Wirksamkeit als in späteren Phasen aufgenommen werden. So entwickeln sich die Bereiche, die z.B. für Musik oder Sprache zuständig sind im Vergleich mit anderen deutlich stärker, wenn das Kind von früher Kindheit an mit Musik konfrontiert wird oder zweisprachig aufwächst. Im Alter von vier bis sechs Monaten wird das Baby zum ersten Mals auf seinen Namen reagieren, den es immer wieder hört, mit sieben Monaten beginnt es dann, Grammatik zu lernen, obwohl es noch gar nicht sprechen kann, doch es werden schon alle Strukturen der Muttersprache gespeichert, um dann mit sechs Jahren die Sprache wirklich zu beherrschen.
Allerdings entwickelt der Mensch seit einigen Jahrzehnten ein äußerliches, globales Gehirn: "Während unsere Gehirne seit 40.000 Jahren mehr oder weniger gleich geblieben, also von den Cro-Magnon-Höhlenmalern bis zu Quentin Tarantino evolutionär auf der Stelle getreten sind, entwickelt sich unser externes Gehirn sprunghaft. In den letzten ein, zwei Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hat es gelernt, wie man etwas sucht. Mit dem Wachstum der sozialen Netzwerke fing es anschließend an, Freundschaften zu studieren. Während Sie diesen Text lesen, bringen ihm Computerwissenschaftler bei, wie man liest und Gesichter in einer Menschenmenge identifiziert. Jahr für Jahr verdoppelt dieses globale Gehirn die Zahl seiner Transistoren. Es wird stärker. Und während es stärker wird, türmt es nicht nur Berge, sondern ganze Gebirgsketten von Daten auf. Unlängst las ich, dass die Menge der im vergangenen Jahr gesammelten biologischen Informationen die Gesamtmenge der Daten übertraf, die in diesem Feld zusammengetragen wurden, ungefähr seit die alten Chinesen oder Ägypter ihren ersten Frosch zergliederten. (…) Dieses Gehirn, das von allem genährt wird, womit wir die Netzwerke füttern, jedem Chat, jedem Klick, jeder Änderung in Wikipedia, wird immer klüger. Und je klüger es wird, desto häufiger nutzen wir es. Wir zitieren es mittels neuer Erfindungen und Dienste herbei und halten so diese sagenhafte Ressource in jedem unserer wachen Momente in permanenter Bereitschaft" (Baker, 2010).
Inhaltsübersicht des Hypertexts zum menschlichen Gehirn
- Netzwerk Gehirn
- Die drei Gehirne
- Anatomische Einteilung des Gehirns
- Gehorcht auch die Gehirnentwicklung der Darwinschen Selektion?
- Größe des menschlichen Gehirns
- Gehirn und Geschlecht
- Erstmals erfolgreich frische Gehirnzellen transplantiert
- Methoden der Erforschung des Gehirns
- Bildgebende Verfahren
- Die Neuronen
- Neuronen und Gehirn in der Computersimulation
- Energieverbrauch des Gehirns
- Funktion des Gehirns
- Rechte versus linke Gehirnhälfte?
- Einige Grundprinzipien der Wahrnehmung am Beispiel des optischen Systems
- Lokalisten vs Holisten
- Theorie der dualen Codierung
- Medien- und Werbewirkungsforschung
- Menschliche Vorliebe für die rechte Seite?
- Geschlechtsunterschiede in der Gehirnlateralisation
- Linkshändigkeit
- Kognitive Leistung und Händigkeit
- Alter und Lateralität
- Die Fangfrage: Warum vertauscht ein Spiegel rechts-links und nicht oben-unten?
- Konzentrationsübung
- Gehirn, Gefühle und Empfindungen
- Das Bauchhirn
- Gehirn und Zeit
- Gehirn und Sprache
- Gehirn und Lernen
- Gehirnforschung & Freiheit
- Ergebnisse neuerer Gehirnforschung
- Gehirn und Persönlichkeit
- Gehirn und Bewusstsein
- Psychopharmaka als Gehirndoping
- Gehirn-Jogging - was man unter diesem Titel so findet ;-)
- Übungen für das Gehirn
- Haben Pflanzen ein Gehirn?
- Kurioses zum Gehirn ;-)
- Wie funktioniert unser Gedächtnis?
- Inhaltsabhängige Gedächtnisformen
- Speicherabhängige Gedächtnisformen
- Gedächtnistest
- Das Vergessen
- Aufmerksamkeit
- Störungen der Aufmerksamkeit
- Biologische Rhythmen
- Negatives wird automatisch im Gedächtnis gespeichert
- Kommunikation als "Fenster" zu den mentalen Welten anderer Lebewesen
 Der Duft von Schokolade
kann die Hirnaktivität beeinflussen, das ergab ein Experiment des
Londoner Neuropsychologen Neil Martin. "Kein anderer Geruch, den wir
testeten, hatte derart starke Effekte wie der von Schokolade". Zusammen
mit Kollegen hatte er in einer Studie die Wirkung verschiedener Düfte
auf den Menschen untersucht. Die Probanden saßen dabei in speziellen
Räumen mit geruchsneutraler Luft, trugen Augenklappen und Ohrenschützer,
sodass sie sich voll auf das Riechen konzentrieren konnten. Während sie
mit diversen Aromen konfrontiert wurden, wurden ihre Gehirnaktivitäten
gemessen. "Schokolade stellte sich in unserem Geruchsexperiment als Star
heraus", betont Martin. Weder Kaffeeduft noch Knoblauchgeruch, weder
das Aroma von Pfefferminze noch das von gebackenen Bohnen konnten im
Gehirn derartige Wirkungen auslösen wie Schokolade. Als "wohltuend,
angenehm und sehr entspannend" empfanden die "Riecher" den
Schokoladeduft. "Er scheint das Gehirn gleichzeitig zu entspannen und zu
erregen, aber auch geistig wach zu machen", schildert Martin.
Der Duft von Schokolade
kann die Hirnaktivität beeinflussen, das ergab ein Experiment des
Londoner Neuropsychologen Neil Martin. "Kein anderer Geruch, den wir
testeten, hatte derart starke Effekte wie der von Schokolade". Zusammen
mit Kollegen hatte er in einer Studie die Wirkung verschiedener Düfte
auf den Menschen untersucht. Die Probanden saßen dabei in speziellen
Räumen mit geruchsneutraler Luft, trugen Augenklappen und Ohrenschützer,
sodass sie sich voll auf das Riechen konzentrieren konnten. Während sie
mit diversen Aromen konfrontiert wurden, wurden ihre Gehirnaktivitäten
gemessen. "Schokolade stellte sich in unserem Geruchsexperiment als Star
heraus", betont Martin. Weder Kaffeeduft noch Knoblauchgeruch, weder
das Aroma von Pfefferminze noch das von gebackenen Bohnen konnten im
Gehirn derartige Wirkungen auslösen wie Schokolade. Als "wohltuend,
angenehm und sehr entspannend" empfanden die "Riecher" den
Schokoladeduft. "Er scheint das Gehirn gleichzeitig zu entspannen und zu
erregen, aber auch geistig wach zu machen", schildert Martin.
Das Schokoladearoma erhöhte gleichzeitig die Alpha- und die Beta-Aktivität der Hirnströme (siehe dazu: Frequenzbereiche eines EEGs). "Alpha wird häufig bei entspannten, aber wachsamen Erwachsenen gefunden, Beta wiederum bei Menschen, die eine Art mentaler Arithmetik betreiben", erklärt Martin, der sich erwähnte Wirkungen der Schokolade nicht erklären kann. Vielleicht wird das emotionale Zentrum im Gehirn aktiviert. Aber das wiederum ließe die Frage offen, warum nicht auch andere angenehme Düfte derlei Effekte auslösen.
Ein Rätsel bleibt auch, warum der Geruch von Kaffee und faulendem Fleisch keinerlei Wirkungen gezeigt hatte. "Gerade von diesen beiden Gerüchen hatten wir erwartet, dass sie einiges bewirken können", meint Martin.
Amerikanische Neuropsychologen fanden schließlich heraus, dass bei einigen Menschen der Genuß von Schokolade sogar zur Sucht führen kann. Bei Versuchspersonen, die sich schnell mit Schokolade vollstopfen, fanden die Forscher vermehrte Gehirnaktivität in den Bereichen, die mit Sucht in Verbindung gebracht werden. Bei den Probanden, die nur genußvoll Schokolade verzehrten, zeigte die Gehirnregion keine Aktivität.
Kakao enthält folgende psychoaktive Substanzen (pro 100 g): Koffein: 68 Milligramm; Theobromin (ähnliche Wirkung wie Koffein, Blutgefäße werden erweitert und der Herzmuskel angeregt): 200 Milligramm. Kleinsten Mengen biogene Amine steigern den Blutdruck gesteigert und beeinflussen die Gehirnfunktionen. Ferner 1 Milligramm Phenylethylamin verursacht die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn. Anandamid kommt nur in geringsten Mengen vor und ist ein dem in Hanfpflanzen vorkommenden THC ähnlicher Rauschstoff, der auch vom Körper selbst produziert wird. Die Freisetzung von Anandamid erfolgt bei Stress und Schmerzen, steigert somit das Wohlempfinden. Es sind jedoch nur geringe Mengen in der Schokolade nachzuweisen. An Antioxidantien enthält Schokolade Polyphenole, die unter anderem entzündungshemmend und krebsvorbeugend wirken.
Amerikanische Wissenschafter haben jüngst entdeckt, dass gemahlener Kakao und ungesüßte Backschokolade hohe Mengen an Resveratrol (auch in Rotwein und Traubensaft) enthalten, einen hoch aktiver, sekundärer Pflanzenstoff, der die Zellen schützt und die Bildung von freien Radikalen verhindert.
Flavanole sind eine Untergruppe pflanzlicher Flavonoide, die in Kakao, Trauben, Äpfeln, Tee, Beeren und anderen Lebensmitteln enthalten sind, wobei bekannt ist, dass sie sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken. Gratton et al. (2020) haben in einer Untersuchung nun gezeigt, dass Flavanole auch die geistige Beweglichkeit bei komplexen Denkaufgaben steigern kann. In einer Studie wurde bei jungen Probanden die Durchblutung des Gehirns künstlich reduziert, indem man die Atemluft mit Kohlendioxid angereichert hat. Bei jener Gruppe, die zuvor Kakao getrunken hatten, stellte sich nicht nur bis zu eine Minute schneller wieder ein hoher Sauerstoffgehalt im Blut ein, sondern der Anstieg war auch deutlich stärker als bei denen, die ein anderes Getränk eingenommen hatten. Allerdings zeigte sich dies nur, wenn die Aufgaben ausreichend kompliziert waren, denn nur wenn Menschen bei Aufgaben stärker gefordert werden, benötigte ihr Gehirn einen höheren Blutsauerstoffgehalt, um die Herausforderung dann zu bewältigen. Dies lässt vermuten, dass Flavanole bei anspruchsvollen Denkaufgaben nützlich sein könnten.
Schokolade beeinflußt die Gehirnaktivität und kann süchtig machen
 Die
Heimat der Schokolade ist Mexiko. Beide Begriffe, sowohl Schokolade wie
auch Kakao, stammen vom gleichen altmexikanischen Wort "Xocoatl" oder
"Kakuatl" ab, von "xococ" = "herb" und "latl" = "Wasser". Nach
aztekischen Vorstellungen war die Schokolade ein Getränk der Götter, das
diese den Menschen geschenkt hatten. Bei ihren Eroberungen lernten die
Spanier auch dieses Schokoladengetränk der Maya und Azteken kennen. Sie
übernahmen das Wort "cacao" von den Maya und die aztekische Bezeichnung für das Schokoladengetränk "cacahu-atl"
("Kakaowasser"). Da sie große Schwierigkeiten mit dem Erlernen der
einheimischen Sprachen hatten, glichen sie Wörter an ihre Sprechweise
an. Die Maya nannten das Schokoladengetränk "chocol haa" ("heißes Wasser"). Die spanische Bezeichnung "chocolate" entstand vermutlich, indem sie das Maya-Wort "chocol" (heiß) mit dem aztekischen Wort "atl"
(Wasser) verbanden. Da die Endung auf "tl" den Spaniern aber große
Schwierigkeiten bereitete, sprachen sie immer "te", wenn bei den Azteken
ein "tl" vorkam. So wurde aus "chocolatl" schließlich "chocolate".
Für europäische Geschmacksempfindungen war dieses Göttergetränk anfangs
äußerst fremd: Sie schmeckte bitter und scharf. Der Mailänder Girolamo
Benzoni, der von 1542 bis 1556 in Mittelamerika weilte, berichtete in
seinem 1565 erschienenen Reisebericht von der nach Eingeborenenart
angerichteten Schokolade, die ihn viel mehr ein "Säugetränk", eine
Tränke für Schweine, denn "eines Menschen Getränk" dünkte. Er ergänzte
aber, dass er sich wohl oder übel habe daran gewöhnen müssen, wollte er
doch nicht das erbärmliche Wasser trinken.
Die
Heimat der Schokolade ist Mexiko. Beide Begriffe, sowohl Schokolade wie
auch Kakao, stammen vom gleichen altmexikanischen Wort "Xocoatl" oder
"Kakuatl" ab, von "xococ" = "herb" und "latl" = "Wasser". Nach
aztekischen Vorstellungen war die Schokolade ein Getränk der Götter, das
diese den Menschen geschenkt hatten. Bei ihren Eroberungen lernten die
Spanier auch dieses Schokoladengetränk der Maya und Azteken kennen. Sie
übernahmen das Wort "cacao" von den Maya und die aztekische Bezeichnung für das Schokoladengetränk "cacahu-atl"
("Kakaowasser"). Da sie große Schwierigkeiten mit dem Erlernen der
einheimischen Sprachen hatten, glichen sie Wörter an ihre Sprechweise
an. Die Maya nannten das Schokoladengetränk "chocol haa" ("heißes Wasser"). Die spanische Bezeichnung "chocolate" entstand vermutlich, indem sie das Maya-Wort "chocol" (heiß) mit dem aztekischen Wort "atl"
(Wasser) verbanden. Da die Endung auf "tl" den Spaniern aber große
Schwierigkeiten bereitete, sprachen sie immer "te", wenn bei den Azteken
ein "tl" vorkam. So wurde aus "chocolatl" schließlich "chocolate".
Für europäische Geschmacksempfindungen war dieses Göttergetränk anfangs
äußerst fremd: Sie schmeckte bitter und scharf. Der Mailänder Girolamo
Benzoni, der von 1542 bis 1556 in Mittelamerika weilte, berichtete in
seinem 1565 erschienenen Reisebericht von der nach Eingeborenenart
angerichteten Schokolade, die ihn viel mehr ein "Säugetränk", eine
Tränke für Schweine, denn "eines Menschen Getränk" dünkte. Er ergänzte
aber, dass er sich wohl oder übel habe daran gewöhnen müssen, wollte er
doch nicht das erbärmliche Wasser trinken.
Tipps zu Aufbewahrung: Auch bei Hitze sollte man Schokolade nicht im Kühlschrank aufbewahren, denn dort bröckelt sie und verliert ihren Glanz. Die optimale Temperatur für Schokolade liegt zwischen 12 und 18 Grad. Bei der Aufbewahrung ist darauf zu achten, Schokolade trocken und geruchsneutral zu lagern, denn in der Nähe stark riechender Lebensmittel nimmt sie deren Gerüche an, wobei das vor allem für weiße Schokolade gilt. Auch Luft und Licht schaden der Schokolade, denn dadurch oxidieren die Fette, was den Geschmack verändert und die Schokolade unangenehm riechen lässt. Allerdings ist der Fettreif, der sich bei höheren Temperaturen bildet, nur ein kosmetisches Problem, der sich auf den Geschmack nicht aus wirkt.
Quellen
Presse, Wien Donnerstag, 12. Juni 1997
Oberösterreichische Nachrichten, 7. Jänner 2002
Oberösterreichische Nachrichten, 5. Oktober 2002 http://www.stub.unibe.ch/extern/hv/1_01/sandgruber.pdf (02-01-18)
Bildquellen
http://www-x.nzz.ch/format/broadcasts/img/126.gif http://www.chocoland.ch/images/Briefmarke.gif
Psychologen der Universität Würzburg sind nach einem neuen Experiment aber der Meinung, dass Schokolade und anderes Süßes dann am besten schmeckt, wenn man ohnehin gut gelaunt ist. Schokolade würde also nicht zur Frustbekämpfung eingesetzt werden. In dem Versuch wurden Probanden verschiedene Filmausschnitte gezeigt, um bestimmte Emotionen zu wecken. Eine Szene aus der Komödie "Harry und Sally", bei der die Hauptdarstellerin in einem gut besuchten Restaurant einen Orgasmus nachspielt, sorgte für Heiterkeit. Mit einem Ausschnitt aus dem Boxerfilm "The Champ" wurde dagegen Trauer erzeugt: Ein kleiner Bub erlebt den Tod seines Vaters, der in einem Kampf verletzt wird.
Nach den Filmen mußten die Versuchspersonen Schokolade essen. Ihr Kauverhalten wurde für Analysen mit Video aufgezeichnet und sie mußten den Geschmack der Schokolade bewerten. Die Ergebnisse des Experiments waren eindeutig: Bei trauriger Stimmung schmeckt die Schokolade deutlich weniger gut als bei fröhlicher und auch die Lust nach mehr war deutlich geringer ausgeprägt.
Was braucht das Gehirn zum Funktionieren?
Wie alle anderen Körperzellen müssen auch Gehirnzellen "atmen". Ist Sauerstoff knapp, wird zunächst die Leistung des Zellstoffwechsels gedrosselt, um die Nervenzelle zumindest am Leben zu erhalten. Erhält die Zelle keinen Sauerstoff mehr, geht sie zugrunde. Eine vollständige Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr ist für das Gehirn innerhalb weniger Minuten tödlich. Als Energielieferant dient dem Gehirn Traubenzucker - pro Stunde benötigt es durchschnittlich 4 g davon. Sinkt die Konzentration des Traubenzuckers, verspüren wir zunächst einmal Hunger. Werden die Zuckerdepots dann nicht wieder aufgefüllt, kann eine Ohnmacht auftreten. Unter den Vitaminen sind vor allem jene der Gruppe B für das Gehirn von großer Bedeutung, denn ein Mangel kann die Verarbeitung des energieliefernden Traubenzuckers behindern und damit den Stoffwechsel des Gehirns lahmlegen. Ddaneben ist auch eine ausreichende Zufuhr der Vitamine A, C und E ist unerlässlich. Spurenelemente sind für die elektrischen Vorgänge bei der Signalübertragung zwischen den Nervenzellen ebenso notwendig wie Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium). Da im Körper nur gelöste Stoffe weitergeleitet werden, spielt Wasser als Transportmittel eine zentrale Rolle. Alle Stoffe erhält das Gehirn mit dem Blut, sodass eine ausreichende Blutversorgung die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Gehirn ist. Bereits geringe Störungen der Blutzufuhr können zu Vergesslichkeit und Konzentrationsschwäche führen. Massivere Behinderungen des Blutflusses lösen Beschwerden von Kopfweh über Schwindel und Ohrensausen bis hin zu Ohnmachten aus.
Wenn Nervenzellen im Ruhezustand sind, dann sind sie voll aufgeladen und bei einem Nervenimpuls wird dieses Potenzial entladen. Danach müssen sie sich wieder aufladen und für dieses Aufladen benötigen sie Energie. Das geschieht dadurch, indem sie Zucker in elektrische Ladung umwandeln, wobei Nervenzellen dabei Wärme erzeugen, sodass sie zum Wiederaufladen mehr Energie verbrauchen als in der Nervenzelle selber gespeichert ist. Zwar ist die Ladung jeder Nervenzelle nicht sehr hoch, aber da Menschen Milliarden davon besitzen und permanent Millionen davon in Aktion sind, benötigt das Gehirn eine beachtliche Menge an Energie. Allerdings verbraucht das Gehirn nicht viel mehr Energie, wenn man viel nachdenkt, denn dabei sind immer nur wenige Areale aktiv, da ohnehin jeder Teil des Gehirns auch in Ruhe ständig aktiv ist, etwa zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen. In Gehirnscans sieht man daher nur ganz minimale Aktivitätsanstiege, doch würde man die Grundaktivität und die gesteigerte Aktivität auf einem Bild in den richtigen Beziehungen darstellen, wäre diese gesteigerte Aktivität in der Regel überhaupt nicht zu sehen.
Angeblich richtige Ernährung für das Gehirn
Gute Lebensmittel
- Lachs, Makrelen, Leinöl, Walnüsse
- Eine gute Eisenversorgung (z. B. durch Rindfleisch, Rote Bete) erhöht den Anteil roter Blutkörperchen, verbessert die Sauerstoffzufuhr
- Mediterrane Kost u. gelegentlich ein Glas Rotwein (enthält Zellschutz Polyphenole) senken das Alzheimer-Risiko um 40 Prozent
Schlechte Lebensmittel
- Fast Food (hoher Fett- und Zuckeranteil, Glutamat)
- »schnelle Kohlenhydrate«, in Mais, Reis, Weißmehl mit hohem glykämischem Index, die den Blutzucker schnell und hoch ansteigen lassen
- gehärtete Fette (in Margarine, Schmalz, Frittier-Fetten, Keksen)
- tierische Fette (Wurst, Fleisch)
Quelle:
http://www.guter-rat.de/gesundheit/artikel_gesundheit_useite_1503466.html (09-11-11)
Für alle, die das Gehirn eher nicht erforschen wollen ;-)
Übrigens: Ein Ei enthält etwa 7g Eiweiß und 7g Fett. Spuren von Kohlenhydraten und Mineralstoffen. Das wichtigste Vitamin ist das Vitamin A (Retinol) und die Vorstufe Pro-Vitamin A (Carotin). Eier enthalten auch Lecithin, das chemisch betrachtet identisch mit Lipamin ist, das träge Gehirnzellen mobilisiert und die allgemeine geistige Fitness steigert, die Konzentrationsfähigkeit fördert und die Gehirnleistung im Alter erhöht.
Hirn mit Ei
- 50 dag Kalbs- oder Schweinshirn
- 1 EL Butter
- 1 kleine Zwiebel
- 4 Eier
- Petersilie kleingehackt
- Salz, Peffer
Das Hirn einige Stunden in Wasser einlegen. Danach zieht man die feine Haut ab und entfernt die Blutgefäße und mögliche Knochensplitter. Das Gehirn sollte man dann nochmals kurz in warmes Wasser legen.
Die kleingehackte Zwiebel in der Butter anschwitzen, das vorbehandelte Gehirn in kleine Stückchen schneiden und zur Butter dazugeben. Ständig rühren, damit das Hirn nicht anbrennt. Die Eier aufschlagen und zum Hirn beigeben. Wenn die Eier stocken mit Salz, Pfeffer und etwas Petersilie würzen und heiß servieren.
Als Beilage empfehlen sich Kartoffel oder Weißbrot.
Apropos Gehirn als Nahrungsmittel
Das Gehirn ist übrigens auch ein Grundnahrungsmittel für Zombies und auch für deren Kinder, denn schließlich sollen die einmal groß und stark werden. "A Brain is for Eating" heißt ein via Crowdfunding finanziertes Bilderbuch für den untoten Nachwuchs von Dan und Amelia Jacobs.
Vor allem vom Verzehr menschlichen Gehirns sei abgeraten!
Kannibalismus, also der Verzehr von Menschenfleisch, ist zwar heute
eher selten geworden, und aus der Sicht der Psychologie interessiert
ohnehin vor allem der Verzehr des Gehirns. Ein letztes Beispiel von
Kannibalismus und seinen belegten Folgen stammt aus Papua-Neuguinea,
denn dort lebte der Stamm der Fore, bei dem es von
jeher üblich war, aus rituellen Gründen das Fleisch verstorbener
Angehöriger zu verspeisen. Sobald ein Angehöriger verstarb, organisierte
sein Stamm ein rituelles Festmahl, um den Toten zu verspeisen. Er wurde
zubereitet und gänzlich verspeist, einschließlich seiner Organe, wie
dem Gehirn und seiner Genitalien. Ab den fünfziger Jahren beobachteten
Mediziner eine seltsame Krankheit bei den Fore, die Kuru-Krankheit,
die sich in Form von neurologischen Störungen wie
Gleichgewichtsverlust, Gangstörungen, mangelnder Bewegungskoordination
und Demenz äußert. Sie führt innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach
Auftreten der ersten Symptome zum Tod. Bei Kuru handelt es sich um
eine Transmissible Spongiforme Enzephalopathie, ähnlich der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, einer durch atypische Eiweiße oder Prionen
ausgelösten Erkrankung, die das Gehirn befällt und dort biochemische
Prozesse auslöst, die die Funktion der Nervenzellen stören und in der
Folge eine schwammartig durchlöcherte Struktur verursachen.
Etymologie des Begriffes Gehirn
Der Begriff „Gehirn“ ist etymologisch ein vergleichsweise junges
Wort, das erst im 15. Jahrhundert entstanden ist, in einer Zeit, aus der
viele Wortschöpfungen mit der Vorsilbe „Ge-“ stammen, etwa „Gebeine“,
„Gebäude“ oder „Gebilde“, wobei man vermutet, dass das zu dieser Zeit
als besonders gute Sprache galt. Älter ist die kürzere Variante „Hirn“,
die heute noch in anatomischen Bezeichnungen üblich ist, aber auch in
Wörtern wie „Hirngespinst“ oder „hirnrissig“ vorkommt. Dieses Wort
stammt ursprünglich aus der urindoeuropäischen Sprache, jener gemeinsame
Vorstufe aller Sprachen, die heute von Island im Westen über den Iran
bis Indien im Osten gesprochen werden, aus der 400 unterschiedliche
Sprachen stammen,, sodass „Gehirn“, die englische Bezeichnung „brain“
oder das schwedische „hjärna“ alle aus demselben Wort entstanden.
Möglicherweise ist es auch mit „Horn“ verwandt, also etwas, das am Kopf
getragen wird, wobei Horn etwas bezeichnet, das sich oben am Kopf
befindet und Hirn für das steht, was im Kopf drinnen ist.
Literatur
Baker. Stephen (2010). Was lassen wir in unsere Köpfe? FAZ.NET vom 6. Februar 2010.
Bruchhausen, W. (2008). Von der Bakteriologie zur molekularen Virologie und Prionenforschung. Die Entwicklung der Infektionslehre (S. 6–25). In Dominik Gross, H. J. Winkelmann (Hrsg.), Medizin im 20. Jahrhundert. Fortschritte und Grenzen. München: Ärztliche Praxis.
Van Essen, David (2010). Similar patterns of cortical
expansion during human development and evolution. Proceedings of the
National Academy of Sciences" (doi: 10.1073/pnas.1001229107).
WWW: http://www.netdoktor.de/News/Gehirn-Einzelnes-Gen-entsch-1131501.html (09-10-06)
Glaser, Peter (2018). Was Menschen der Künstlichen Intelligenz voraus haben.
WWW:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kolumne-glasers-perlen-was-menschen-der-kuenstlichen-intelligenz-voraus-haben.8603ac79-09ff-4a8c-b406-5237ee2b06fb.html
(18-08-30)
Gratton, Gabriele, Weaver, Samuel R., Burley, Claire V.,
Low, Kathy A., Maclin, Edward L., Johns, Paul W., Pham, Quang S.,
Lucas, Samuel J. E., Fabiani, Monica & Rendeiro, Catarina (2020).
Dietary flavanols improve cerebral cortical oxygenation and cognition in
healthy adults. Scientific Reports, 10, doi10.1038/s41598-020-76160-9.
Held, Werner (o.J.). Bindungsprozesse im Gehirn (Temporal Binding) - besteht ein Zusammenhang mit dem Bewußtsein?
WWW: http://people.freenet.de/soleil7/Binding.htm (01-12-10)
Kawabe, H., Neeb, A., Dimova, K., Young, S.M.Jr. Takeda, M., Katsurabayashi, S., Mitkovski, M., Malakhova, O.A., Zhang, D.-E., Umikawa, M., Kariya, K., Goebbels, S., Nave, K.-A., Rosenmund, C., Jahn, O., Rhee, J.-S. and Brose, N. (2010). Regulation of Rap2A by the ubiquitin ligase Nedd4-1 controls neurite development in cortical neurons. Neuron, 65, 358-372.
Köhler, Bertram (2001). Nachdenken über Evolution.
WWW: http://home.t-online.de/home/Bertram.Koehler/Denken.htm
http://home.t-online.de/home/Bertram.Koehler/gehirn.htm
http://home.t-online.de/home/Bertram.Koehler/Bew1.htm
Minlebaev, Marat, Colonnese, Matthew, Tsintsadze, Timur, Sirota, Anton & Roustem Khazipov (2011). Early Gamma Oscillations Synchronize Developing Thalamus and Cortex. Science, 334, 226-229.
Nikolic, D., Häusler,S., Singer, W. & Maass, W. (2009). Distributed Fading Memory for Stimulus Properties in the Primary Visual Cortex. PLoS, Vol. 7, 12.
Pohl, Wolf (2001). Antonio R. Damasio: "Ich fühle,
also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewußtseins". Eine Rezension.
Aufklärung und Kritik 1/2001 (S. 168 ff.).
WWW: http://members.aol.com/GKP2/pohl3.htm (01-07-10)
Rathbone, R., Counsell, S.J., Kapellou, O., Dyet, L., Kennea, N., Hajnal, J., Allsop, J.M., Cowan, F. & Edwards, A.D. (2011). Perinatal cortical growth and childhood neurocognitive abilities. Neurology, 77.
Rigos, Alexandra (2008). Evolution des Gehirns. GEOkompakt Nr. 15 - 06/08.
WWW: http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geokompakt/57363.html (08-06-21)
Schöpf, V., Schlegl, T., Jakab, A., Kasprian, G., Woitek, R., Prayer, D. & Langs, G. (2014). The Relationship Between Eye Movement and Vision Develops Before Birth. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 775.
Simon-Areces, J., Dietrich, M.O., Hermes, G., Garcia-Segura, L.M., Arevalo M-A., et al. (2012). Induced by Natural Birth Regulates Neuronal Differentiation of the Hippocampus and Related Adult Behavior. PLoS ONE 7(8): e42911. doi:10.1371/journal.pone.0042911.
Singer, Wolf (2001). Was kann ein Mensch wann
lernen? Werkstattgespräches der Initiative McKinsey bildet in der
Deutschen Bibliothek, Frankfurt /Main am 12. Juni 2001.
http://www.earlytechnicaleducation.org/1Kap2D.htm (05-12-12)
Welsch, W. (2009). Wenn du wüsstest, was ich denke. Die Biowissenschaften und ihre Herausforderung: Wie Jürgen Habermas Geist und Natur versöhnt. WWW: http://www.tagesspiegel.de/kultur/art772,2824956 (09-06-16)
http://www.tebonin.de/tebonin/gehirn/gehirn_3_1.php (05-11-22)
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-12080-2010-08-10.html (10-08-10)
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/Gedaechtnis.html
http://www.quarks.de/ (04-01-27)
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/Neurologie (04-01-24)
http://www.uni-wuerzburg.de/sopaed1/breitenbach/neuropsycho/lurija/grund.htm (01-12-10)
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/5924/1.html (02-01-14)
https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/warum-heisst-das-gehirn-gehirn (16-04-23)
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4664&Alias=wzo&cob=391906¤tpage=0 (09-01-17)
https://www.ikz-online.de/staedte/iserlohn/das-gehirn-ist-ein-unfassbar-einsames-organ-id228689147.html (20-03-14)
Bildquellen und verwendete Bildgrundlagen
http://www.geo.de/themen/medizin_psychologie/gedaechtnis/ (01-12-08)
http://www.getiq.at/ (08-09-09)
Sinnesentwicklung beim Kleinkind: http://kurier.at/nachrichten/4272740.php (11-10-02)
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::