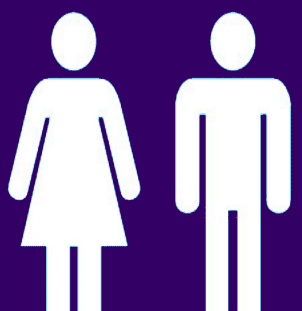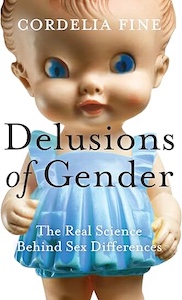Geschlecht und Gehirn
Diese dem weiblichen Geschlecht verliehene eigentümliche Schläue
ist ein sehr gerechter Ausgleich für seine geringere Kraft;
sonst wäre die Frau nicht die Gefährtin des Mannes, sondern seine Sklavin.
Jean Jacques Rousseau
Nach Maurer (2002) war in der Hirnforschung des 19. Jahrhunderts das weibliche Gehirn als Forschungsgegenstand ein zentrales Thema, um dessen Minderwertigkeit und mangelnde geistige Leistungs- und Bildungsfähigkeit naturwissenschaftlich objektiv unter Beweis zu stellen, etwa im Sinne einer daraus folgenden naturgegebenen weiblichen Bestimmung. Dadurch sollte u. a. den Forderungen nach dem Zugang von Frauen zu höherer Bildung oder zum Wahlrecht entgegengetreten werden. Zu dieser Zeit hat es sich unter den Naturforschern und Ärzten die „cephalozentrische These immer mehr durchgesetzt, dass das Gehirn der Sitz von Verstand, Vernunft und Intellekt sei. Vor dem Hintergrund des Glaubens an eine Stufenleiter der Vervollkommnung in der Evolution bestand die international betriebene Forschungsaufgabe darin, Rangordnungen entlang einer allmählich aufsteigenden Skala aufzustellen, deren Norm der weiße Mann war, wobei alle tieferstehenden Gruppen wie Rassen, Geschlechter und Schichten mit den Kindern weißer Männer verglichen wurden. Das normale Standardgehirn des 19. Jahrhunderts war also das männliche Gehirn, das weibliche Gehirn bedeutete vor allem eine Abweichung davon. Mit sorgfältig ausgearbeiteten wissenschaftlichen Arbeiten wurde eine hirnbiologische Geschlechter- und Rassenanthropologie begründet, die bestehende soziale Ungleichheiten legitimieren half.
Die Erforschung des menschlichen Gehirns im 19. Jahrhundert und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war demnach weniger mit dem Wunsch verknüpft, neurologische Gemeinsamkeiten unter den Menschen herauszuarbeiten, sondern war auf die Suche nach Unterschieden ausgerichtet, nämlich nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern und nach Unterschieden zwischen verschiedenen Ethnien. Zwar gilt die Geschlechter- und Rassenanthropologie heute als überholt, doch wird in der aktuellen Diskussion wieder vom „weiblichen Gehirn“ als einem vom „männlichen Gehirn“ unterschiedlichen gesprochen bzw. werden entsprechende Standardmodelle entwickelt. Zwar werden die Gehirne von Männern zumindest explizit nicht mehr als die zugrundegelegte Norm für alle Gehirne angesehen, sondern weibliches und männliches Gehirn werden nebeneinander gestellt. Zwar stellt die These vom fundamental unterschiedlichen „weiblichen“ und „männlichen“ Gehirn heute keine zentrale Thematik mehr dar, taucht aber immer wieder als Fokus von Forschungsarbeiten auf, und wird dann oft von Massenmedien publikumswirksam aufbereitet und im Sinne weiterer Polarisierungen angeblicher Geschlechtsunterschiede weiterverbreitet. Allerdings ist zu fragen, aufgrund welcher Befunde wird in der Hirnforschung von einem „weiblichen“ und „männlichen“ Gehirn gesprochen? Wie sind diese Befunde zu bewerten? Mit welchem Recht oder Unrecht kann dementsprechend überhaupt ein „Sexualdimorphismus“ hinsichtlich Struktur und Funktion des Zentralnervensystems behauptet werden, außer in dem trivialen Sinne, dass damit die Zugehörigkeit zu einer als „männlich“ bzw. „weiblich“ klassifizierten Person ausgesagt wird?Immer wieder findet man in den Medien daher mehr oder minder aufsehenerregende Berichte über Unterschiede in den Gehirnen von Männern und Frauen, die durch bildgebende Verfahren der Hirnforscher bestätigt worden sein sollen. So denken Frauen angeblich mehr mit beiden Gehirnhälften, bei Männern dominiert eine Hirnhälfte das Denken. Mittels zweier Verfahren werden derzeit in der Forschung Gehirne gescannt: Mit der Positronen-Emissions-Tomografie, lässt sich der Blutfluss, somit die Aktivierung, in Gehirnarealen darstellen, was auch für die zweite Methode der Magnetresonanz-Tomografie gilt. Zeigen diese bildgebenden Verfahren Unterschiede zwischen den Geschlechtern, dann ist meist die Probandenanzahl für allgemeine Aussagen einfach viel zu gering und statistisch meist auch nicht signifikant. Auch sind die Testpersonen aus Gründen der Einfachheit der Durchführung schlicht und einfach StudentInnen, meinst PsychologiestudentInnen, aus deren Befunden dann Rückschlüsse gezogen werden. Meist stellen die Hirnforscher Unterschiede durch eine Subtraktion von Bildmustern dar, also durch einen Vergleich von zwei Probandengruppen, und interpretieren diese Differenzen als bedeutsam. Bei dieser Datenreduktion schaut man aber nicht, welche Gehirnzentren wann miteinander verknüpft sind, was auf Grund der Funktionsweise des Gehirns mit verteilten Zentren wichtig wäre bzw. welche Hirnareale bei bestimmten Aufgaben bei beiden Geschlechtern aktiviert sind, sondern registriert nur vermeintliche Unterschiede. Zwar sind Bilder aus dem Gehirn wichtig für die individuelle Diagnose und Therapie, zum Beispiel in der Neurochirurgie, aber jedes Gehirn ist einzigartig und in ständiger Veränderung, sodass alle Befunde zur Hirnstruktur oder zu Hirnfunktionen nur eine Momentaufnahme darstellen. Geschlechtsdifferenzen sind in vielen Untersuchungen gar nicht der Untersuchungsgegenstand, sondern das Geschlecht wird in fast allen Untersuchungen routinemäßig nebenbei registriert. Wenn dann in vielen Untersuchungen auch die Geschlechterdifferenzen auf Signifikanz geprüft werden, wird aus rein statistischen Gründen schon der eine oder andere davon ein statistisch signifikantes Ergebnis liefern, auch ohne dass es einen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Solche falsch positiven Befunde halten sich dann oft mit bemerkenswert großer Hartnäckigkeit, was nicht zuletzt auf die Verbreitung in den Onlinemedien zurückzuführen ist. Dass sich dann die meisten Ergebnisse in Folgestudien nicht replizieren lassen, ist auf Grund der viel selteneren Publikation solcher "negativen" Resultate unter der medialen Wahrnehmungsschwelle.
Nach Ansicht der britischen Psychologin Cordelia Fine ist es Unsinn, dass Männer aufgrund ihrer Biologie angeblich "so" und Frauen "anders" sind. Der Fehler liegt dabei schon in der Annahme, dass biologisch bedeutet, etwas sei fix und damit unveränderlich. Zwar gibt es Studien zu Unterschieden zwischen Gehirnen von Männern und Frauen, aber ein Gehirn entwickelt sich durch die Erfahrungen, die der Mensch macht und diese Erfahrungen sind es, die für Männer und Frauen oft unterschiedlich sind. Zwar gibt es einige Persönlichkeitsmerkmale und Charakteristika, die im Durchschnitt bei Männern und Frauen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, aber zum einen sind diese Unterschiede relativ klein, und zum anderen addieren sie sich nicht zu einem großen Mann-Frau-Unterschied, sondern es ist eher ein "Geschlechts-Mosaik", d. h., jedes Gehirn hat seine individuelle Kombination aus eher männlichen und eher weiblichen Anteilen. Diese Kombinationen sind so unterschiedlich, wie alle Menschen als Individuen unterschiedlich und einzigartig sind. Zwar beeinflusst Testosteron das Verhalten, doch reagiert Testosteron nur auf das, was mit dem Menschen gerade in einer Situation geschieht, d. h., es hilft den Betroffenen, mit einer bestimmten Situation klarzukommen. Doch sowohl bei Frauen als auch bei Männern scheint es jede Menge an Faktoren zu geben, wann und ob das passiert.
Darüber hinaus muss man beachten, dass sich das menschliche Gehirn permanent unter den an es herangetragenen Aufgaben verändert und eine enorme Plastizität aufweist. Viele der in den Medien verbreiteten Ergebnisse sind objektiv betrachtet keine Geschlechtsunterschiede, sondern schlicht einer unscharfen Methodik geschuldet. Daher gilt: Die von neurowissenschaftliche Studien aufgewiesenen Unterschiede im Gehirn zwischen Männern und Frauen betonen häufig geringe statistische Effekte und weisen methodische Fehlerauf. Häufig dienen die Resultate solcher neurowissenschaftlicher Studien als Projektionsfläche für altbekannte Geschlechterklischees, was man leicht anhand von Zeitungs- und Onlineartikeln überprüfen kann. Viele Medien beschränken sich auf überzogene Metaphern und stellten die Differenzen zwischen Männern und Frauen als gravierender dar, als sie tatsächlich auf Grund der Faktenlage sind. Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind daher allesamt mit Vorsicht zu betrachten bzw. deren allgemeine Aussagekraft zu hinterfragen.
Zusammengefasst nach einem Interview mit Sigrid Schmitz in den OÖN vom 31. Mai 2014.
Im Gehirn sind Menschen erstaunlich bisexuell wie generell die Gehirnarchitektur von Säugetieren eher bisexuell angelegt ist. Im Gehirn sind bekanntlich alle Teile des Körpers repräsentiert, wobei sich die Größenverhältnisse nach der Bedeutung für den Organismus richten, d. h., bei Ratten sind die Barthaare im Gehirn großflächig abgebildet, bei Menschen etwa die Hände oder die Zunge. Obwohl die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane sehr verschieden sind, sind diese auf der Körperkarte des Gehirns sehr ähnlich repräsentiert, wobei Unterschiede erst durch Hormone bedingt sind. Zwar bestimmen die Gene das Geschlecht eines Embryos, doch ausschlaggebend für die Entwicklung zu Mann oder Frau sind letztlich die Geschlechtshormone. Zunächst kann ein Embryo männlich wie weiblich werden, d. h., er besitzt sowohl den Müllerschen Gang, der sich zu weiblichen Geschlechtsorganen entwickeln kann wie das Wolffsche System, das den Vorläufer zu männlichen Geschlechtsorganen darstellt. Nach etwa zwei Wochen entwickeln sich entweder Eierstöcke oder Hoden: sind es Hoden, so entwickelt sich das Wolffsche System aufgrund der männlichen Geschlechtshormone (Androgene) aus, die von den Hoden produziert werden. Zudem setzen die Hoden das Anti-Müller-Hormon frei, das die Entwicklung des Müllerschen Ganges verhindert. Sind keine Hoden vorhanden oder produzieren diese keine männlichen Hormone, wird der Müllersche Gang zu Eileiter und Gebärmutter. Auch die Entwicklung der äußeren Geschlechtsorgane, die im fünften bis sechsten Monat stattfindet, verläuft unter dem Einfluss der Geschlechtshormone. Aber nicht nur die Geschlechtsorgane, sondern auch Differenzierungen im Gehirn, die in der Folge für männliche bzw. weibliche Verhaltensweisen wichtig sind, entstehen durch hormonalen Einfluss.
Die Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden sich dabei nicht nur durch mehr oder weniger Anteil von weißer und grauer Gehirnsubstanz, sondern sind nach neuesten Erkenntnissen auch stark unterschiedlich vernetzt. Während es in weiten Teilen des weiblichen Gehirns besonders viele Kontakte zwischen den beiden Hirnhälften gibt, bestehen bei Männern mehr Verknüpfungen innerhalb der beiden Gehirnhälften, wobei sich vor allem die Gehirnverbindungen von Mann und Frau ab der Pubertät recht unterschiedlich entwickeln. Möglicherweise können manche der oft beschriebenen unterschiedlichen Eigenschaften von Männern und Frauen damit erklärt werden, denn Männer sind dank ihrer Hirnarchitektur besser in der Lage, ihre Wahrnehmungen in koordinierte Handlungen umzusetzen, während Frauen besser analytische und intuitive Informationen miteinander verbinden können.
Es ist auch bekannt, dass Männer und Frauen Emotionen unterschiedlich erleben, d. h., jeder bzw. jede fühlt auf seine bzw. ihre Weise. Die Lebenserfahrung lehrt auch, dass in gefühlsbeladenen Situationen Frauen oft redselig werden oder sich auch in emotionalen Ausnahmesituationen wortreich an ihren Bekanntenkreis um Hilfe wenden, während Männer eher schweigen sind und sich häufig abreagieren, wenn sie mit starken Gefühlen nicht fertig werden. In vielen Lebenssituationen scheinen Frauen besser mit Gefühlen umzugehen zu können als Männer, obwohl sie mehr von diesen gesteuert zu sein scheinen. Das Spannungsfeld männlichen und weiblichen Gefühlslebens entfaltet sich letztlich vor einem biologischen Hintergrund und der individuellen Erfahrung, wobei Phasen der Sensibilität in der Kindheit, in denen die Fähigkeit mit Gefühlen umzugehen durch soziales Lernen erworben werden muss, dazu ebenso beitragen wie soziale Einflüsse, indem Rollenbilder und Wertvorstellungen das typisch männliche und weibliche Verhalten beeinflussen und daher sekundär stammesgeschichtlich altes Erbgut zusätzlich verstärken. Viele Alltagsprobleme zwischen Mann und Frau in Bereichen wie Liebe, Partnerschaft, Familie, Mutter- und Vaterschaft, Kindheit, Schule, medizinische Vorsorge, Altern, Kriminalität und Berufswelt nehmen hier erst Gestalt an. Ein typisches Beispiel ist die Anbindung des Stammhirns, des entwicklungsgeschichtlich ältesten Teils des Gehirns, an das Großhirn, wo höhere Gehirnfunktionen wie das Sprachzentrum beheimatet sind, denn Männer verarbeiten Emotionen eher mit dem älteren Teil, der mit Sexualität, Flucht und Aggression in Verbindung steht, während Frauen eher den jüngeren Teil des Stammhirns nutzen, der stärker mit dem Sprachzentrum verknüpft ist. Männer sind daher bei emotionalen Herausforderungen evolutionär bedingt eher auf das Prinzip fight or flight konditioniert, während Frauen auf tend and befriend eingestellt sind, wobei gesellschaftliche Wertvorstellungen und Rollenbilder diese urzeitlichen Verhaltensmuster zusätzlich verstärken. Zwar ist das menschliche Gehirn flexibel und es sind in jedem Menschen männliche und weibliche Muster mehr oder weniger vorhanden, dennoch sollte man diese Ungleichheiten nicht ignorieren, vor allem im Hinblick auf die Gleichberechtigung. Die Gehirnforschung hat aber auch gezeigt, dass bei Frauen und Männern etwa bei der Objekterkennung zwar verschiedene Gehirnareale aktiv sind, sich aber die Ergebnisse oft gleichen, wobei diese auf unterschiedlichem Weg erzielt werden.
Ingalhalikar et al. (2013) haben die Verbindungen innerhalb des Gehirns bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersucht, wobei männliche Gehirne für eine Kommunikation innerhalb der Hirnhälften optimiert sind, denn einzelne Unterbereiche des Gehirns zeigten lokale Verbindungen von kurzer Reichweite mit ihren direkten Nachbarbereichen, während bei Frauen viele längere Nervenverbindungen vor allem zwischen den beiden Gehirnhälften zu finden waren. Nur im Kleinhirn war es umgekehrt, denn dort gab es bei den Männern viele Verbindungen zwischen den Gehirnhälften, bei Frauen innerhalb der beiden Hälften. In diesem Areal wird die Motorik gesteuert wird, sodass bei Männern im Kleinhirn die relativ weit voneinander entfernt liegenden Bereiche für Motorik und Handlung besser miteinander verknüpft sind als bei Frauen. Schon in früheren Verhaltensstudie hatte man festgestellt, dass sich Frauen besser Wörter und Gesichter merken können, aufmerksamer sind und ein besseres soziales Erkenntnisvermögen haben als Männer, während diese räumliche Informationen besser verarbeiten können und in der Bewegungskoordination besser abschneiden. Es zeigte sich auch, dass sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Laufe der Altersentwicklung verstärken. Die gefundenen differenten Ausprägungen dieser Connectome war bei den Studienteilnehmern unter 13 Jahren nicht nachweisbar, was darauf verweist, dass sich die Verbindungen im Gehirn letztendlich deshalb so unterschiedlich ausprägen, weil Männer und Frauen ihr Gehirn ab einem gewissen Alter auch unterschiedlich nutzen. Auch könnte die unterschiedliche Verdrahtung mit dem natürlichen Reifeprozess in der Pubertät einhergehen, bei der es zu einer großen Veränderung der Gehirnstrukturen kommt.
In eine Vielzahl körperlicher und psychischer Veränderungen, die mit einer erhöhten Emotionalität einhergehen, wobei es wichtig ist, für das soziale Funktionieren im Alltag, aber auch für das eigene körperliche und mentale Wohlbefinden, diese Gefühle erkennen, verarbeiten und kontrollieren zu können. Jugendlichen, die an einer Störung des Sozialverhaltens leiden, fällt dieser Prozess schwer, was zu antisozialen, oft aggressivem und klar von der Alternsnorm abweichenden Reaktionen führt, etwa zu Fluchen, Zuschlagen, Stehlen oder Lügen. Im Rahmen des FemNAT-CD-Projekts, einem europaweiten Forschungsprojekt, das sich mit den Ursachen und der Therapie von regelverletzendem und aggressivem Verhalten bei Mädchen mit Störungen des Sozialverhaltens befasst, geht es auch um die Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede im Verhalten. In dieser Studie werden insgesamt bei 1840 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 18 Jahren aus ganz Europa (Großbritannien, Deutschland, Irland, Schweiz, Niederlande, Spanien, Griechenland und Ungarn) Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Buben und Mädchen in Bezug auf Gehirnstruktur und -funktion, Hormonspiegel, Genetik, Emotionserkennung und -regulation sowie physiologische Aktivität verglichen. Dabei zeigte sich, dass Mädchen mit problematischem Sozialverhalten eine reduzierte Hirnaktivität und eine schwächere Vernetzung zwischen Hirnregionen zeigen, die für die Emotionsregulation relevant sind, und zwar in den präfrontalen und temporalen Gehirnarealen, die die kognitiven Kontrollprozesse steuern. Diese Resultate bieten erstmals einen neuronalen Erklärungsansatz für Emotionsregulationsschwierigkeiten von Mädchen mit auffälligem Sozialverhalten. Die unterschiedliche neuronale Aktivität in den beiden Versuchsgruppen kann auf fundamentale Differenzen bei der Gefühlsregulation hinweisen. Sie ist möglicherweise aber auch auf eine verzögerte Hirnentwicklung bei den Versuchsteilnehmerinnen mit problematischem Sozialverhalten zurückzuführen. Offen bleibt, ob männliche Teenager mit einer Störung des Sozialverhaltens ähnliche Hirnaktivitäten während der Emotionsregulation zeigen (Raschle, N. M. et al., 2019).
Die Gehirne von Frauen sind gemessen am Stoffwechsel übrigens im Durchschnitt deutlich jünger als die von gleichaltrigen Männern, was auch erklärt, warum das Gedächtnis von Frauen im Alter besser funktioniert als das von Männern. Allerdings altert das Gehirn bei Männern nicht schneller, denn schon zu Beginn des Erwachsenenalters ist das Gehirn von Männern drei Jahre älter als das von Frauen, und das ändert sich im weiteren Leben nicht mehr. Ursache dafür ist, dass Hormone in jungen Jahren starken Einfluss auf die Gehirnentwicklung haben (Goyal et al., 2019). Im Detail: Nach dieser Studie sind Frauengehirne im Schnitt um 3,8 Jahre jünger als ihre Trägerinnen, Männergehirne aber um rund 2,4 Jahre älter als ihre Träger. Ermittelt wurde das, indem man untersucht hat, wie viel Zucker und Sauerstoff das jeweilige Gehirn verbraucht, woraus sich ableiten, lässt wie die Energie verwendet wird bzw. welche Stoffwechselprozesse aktiver sind, was Rückschlüsse auf das Alter ermöglicht. Die Männergehirne altern also nicht schneller, sie beginnen das Erwachsenenleben mit einem drei Jahre älteren Gehirn als ihre weiblichen Altersgenossinnen, und dieser Unterschied bleibt offenbar bis zum Lebensende erhalten, wobei man vermutet, dass Geschlechtshormone dafür verantwortlich sind. Hormone haben daher offenbar einen größeren Einfluss auf das Gehirn als bisher gedacht, denn man hat festgestellt, dass sich in verschiedenen Zyklusphasen der Frau nicht nur die Verarbeitung im Gehirn, sondern sogar die Dicke der grauen Substanz verändert. Hormone spielen aber auch eine Rolle bei der Gedächtnisleistung, denn eine Studie des Brigham and Women’s Hospital in Boston hat sich mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf die Gedächtnisleistung im mittleren Alter befasst, und da schnitten Frauen in allen getesteten Kategorien besser ab als Männer, nur ab der Menopause weisen Frauen die gleiche Lernfähigkeit und das gleiche Erinnerungsvermögen auf wie Männer, schneiden also schlechter ab als ihre jüngeren Geschlechtsgenossinnen. Offenbar machen die weiblichen Geschlechtshormone den entscheidenden Unterschied aus und bevorteilen Frauen in dieser Beziehung, den je höher bei den weiblichen Probanden die Konzentration des Östradiol war, desto besser schnitten sie in den Tests ab. Von den hormonellen Veränderungen sind demnach insbesondere Bereiche in frontalen Regionen des Hirns betroffen, die unter anderem für das Kurzzeitgedächtnis eine Rolle spielen. Siehe dazu im Detail das Arbeitsblatt zu den Veränderungen des Gehirns während der Pubertät.
Anatomische Unterschiede teilweise angeboren
Geschlechtsunterschiede in der Gehirnorganisation sind theoretisch wichtig für das Verständnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der menschlichen Kognition und im menschlichen Verhalten, allerdings waren bisher neurobiologische Geschlechtsunterschiede bei Mäusen leichter zu charakterisieren als bei Menschen. Nun belegt eine umfangreiche Vergleichsstudien von Liu et al.(2020) neuroanatomische Unterschiede wonach haben Frauen mehr graue Hirnsubstanz unter anderem im Stirnhirn und den Scheitellappen aufweisen, Männer hingegen haben mehr Volumen in einigen hinteren und seitlichen Arealen des Cortex, darunter auch dem primären Sehzentrum, wobei diese Unterschiede vermutlich mit der Aktivität der Geschlechtschromosomen zusammenhängen. Die Areale, in denen das Volumen der grauen Hirnsubstanz bei Männern größer ist, sind meist an der Objekterkennung und der Verarbeitung von Gesichtern beteiligt, die bei Frauen ausgeprägteren cortikalen Regionen sind higegen mit der Kontrolle von Aufgaben, der Impulskontrolle und der Verarbeitung von Konflikten verknüpft. Die gefunden Übereinstimmung zwischen den Mustern der Volumenunterschiede und der Genaktivität betrachten die ForscherInnen als Indiz dafür, dass diese Unterschiede von weiblichem und männlichem Gehirn wahrscheinlich angeboren sind, und dass nicht Umweltfaktoren für diese hochgradig reproduzierbaren Muster im Volumen der grauen Hirnsubstanz verantwortlich sind. In welchem Maße diese beobachteten Unterschiede mit geschlechtsspezifischen Differenzen im Verhalten, der Kognition oder der mentalen Gesundheit verknüpft sind, ist aus diesen Ergebnissen nicht abzulesen.
Eine aktuelle Studie des Autism Research Centres der Universität
Cambridge kommt zu dem Schluss, dass es bereits bei der Geburt
signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnstruktur
von Neugeborenen gibt. Diese Ergebnisse basieren auf der Analyse von
MRT-Gehirnscans von über 500 Säuglingen und stellen die bisher größte
Untersuchung dieser Art dar. Die Ergebnisse der Studie werfen neue
Fragen zu den biologischen Grundlagen der Gehirnentwicklung und deren
Einfluss auf die Neurodiversität auf. So wurde festgestellt, dass
männliche Neugeborene tendenziell ein größeres Gesamtvolumen im Gehirn
aufweisen als weibliche. Gleichzeitig zeigte sich bei weiblichen
Säuglingen ein relativ höherer Anteil an grauer Substanz, während
männliche Neugeborene einen größeren Anteil an weißer Substanz
aufwiesen. Die graue Substanz ist für die Informationsverarbeitung und
-interpretation verantwortlich, während die weiße Substanz für die
Vernetzung verschiedener Gehirnregionen zuständig ist.Diese Ergebnisse
untermauern die Hypothese, dass solche Differenzen bereits in den ersten
Lebenswochen vorhanden sind, was auf biologische Faktoren während der
pränatalen Entwicklung hindeutet. Spätere Umwelteinflüsse können dazu
beitragen, dass sich diese Unterschiede weiter ausprägen. Es konnte
festgestellt werden, dass männliche Säuglinge im Durchschnitt ein
größeres Gehirnvolumen aufwiesen, selbst nach Berücksichtigung des
Geburtsgewichts. Bei weiblichen Babys wurden hingegen größere Volumina
in den Bereichen der grauen Substanz beobachtet, die mit Gedächtnis und
emotionaler Regulation in Verbindung stehen. Bei männlichen Säuglingen
wurden größere Volumina in den Regionen der grauen Substanz
festgestellt, die für sensorische Verarbeitung und motorische Steuerung
zuständig sind. Die Aussagekraft dieser Ergebnisse wird durch die große
Stichprobe und die Berücksichtigung von Faktoren wie Geburtsgewicht
gestärkt, wodurch sichergestellt wird, dass die Unterschiede wirklich
auf das Gehirn und nicht auf Größendifferenzen zwischen den
Geschlechtern zurückzuführen sind. Allerdings wäre es notwendig, die
Bedingungen der pränatalen Umgebung genauer zu untersuchen, um mögliche
biologische Einflussfaktoren wie Hormone oder Plazentafunktionen zu
identifizieren. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die
festgestellten Unterschiede in der Gehirnstruktur Durchschnittswerte
sind und nicht auf jedes Individuum übertragen werden können, da
innerhalb jeder Gruppe eine große Vielfalt besteht und Überschneidungen
zwischen den Geschlechtern auftreten.Diese Unterschiede sind demnach
kein Beleg für die Überlegenheit oder Unterlegenheit eines Gehirns,
sondern vielmehr ein Beispiel für Neurodiversität, ein Konzept, das die
biologischen Unterschiede zwischen Gehirnen als Vielfalt anerkennt.
Die Gehirngrößee von Frauen wird von der Ungleichheit der Lebenswelten beeinflusst
Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wird weltweit mit einem
höheren Risiko für psychische Gesundheitsprobleme und schlechteren
schulischen Leistungen bei Frauen im Vergleich zu Männern in Verbindung
gebracht. In vielen Ländern der Welt werden Frauen in zahlreichen
Bereichen diskriminiert, etwa im Bildungswesen, am Arbeitsplatz, bei der
politischen Vertretung und in der Gesundheitsversorgung, wobei diese
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern mit Indizes wie dem Gender Gap
Index des Weltwirtschaftsforums und dem Gender Inequality Index der
Vereinten Nationen gemessen wird. Man weiß auch, dass das Gehirn
durch nährende und ungünstige soziale und umweltbedingte Erfahrungen
geformt wird, wodurch sich die ungleiche Belastung von Frauen im
Vergleich zu Männern in geschlechtsungleichen Ländern in Unterschieden
in ihrer Gehirnstruktur widerspiegeln könnte, und dies der neuronale
Mechanismus sein könnte, der die schlechteren Ergebnisse von Frauen in
geschlechtsungleichen Ländern teilweise erklärt. Zugman et al. (2023)
untersuchten dies anhand einer Meta-Analyse mit zufälligen Effekten zu
den Unterschieden in der kortikalen Dicke und Oberfläche zwischen
erwachsenen gesunden Männern und Frauen, einschließlich einer
Meta-Regression, bei der die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auf
Länderebene als erklärende Variable für die beobachteten Unterschiede
diente. Insgesamt wurden 139 Stichproben aus 29 verschiedenen Ländern
mit insgesamt 7.876 MRT-Scans einbezogen. Es zeigte sich, dass die Dicke
der rechten Hemisphäre, insbesondere des rechten kaudalen anterioren
cingulären, des rechten medialen orbitofrontalen und des linken
lateralen okzipitalen Kortex, bei Frauen im Vergleich zu Männern in
Ländern mit gleichem Geschlechterverhältnis keine Unterschiede oder
sogar dickere regionale Cortices aufwies, die sich in Ländern mit
größerer Geschlechterungleichheit zu dünneren Cortices umkehrten. Diese
Ergebnisse weisen auf die potenziell gefährlichen Auswirkungen der
Geschlechterungleichheit auf die Gehirne von Frauen hin und liefern
Anhaltspunkte für neurowissenschaftlich fundierte Maßnahmen zur
Gleichstellung der Geschlechter.
Künstliche Intelligenz kann Frauen und Männer allein auf Grund von Gehirnscans unterscheiden
Bisher hat man in Gruppenstudien versucht, die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen sowohl in Bezug auf die kognitive Leistung
als auch auf die strukturelle und funktionelle Gehirnorganisation zu
beschreiben. Eine neue Studie (Weis et al., 2019) hat mit Hilfe eines
maschinellen lernenden System untersucht, wie genau das Geschlecht der
Teilnehmer basierend auf dem räumlich spezifischen Ruhezustand
klassifiziert werden kann, wobei Proben aus mehreren Studien verwendet
wurden. Der Klassifikator, der an einer Probe geschult und an den
anderen beiden getestet wurde, war in der Lage, das Geschlecht sowohl
innerhalb der Probe als auch zwischen unabhängigen Proben zuverlässig zu
klassifizieren, wobei er sich sowohl in Bezug auf die
Abbildungsparameter als auch auf die Probenmerkmale unterschied.
Hirnregionen mit höchster Genauigkeit bei der Geschlechtsklassifizierung
befanden sich hauptsächlich entlang des cingulären Cortex, des medialen und lateralen frontalen Cortex, der temporoparietalen Regionen, der Insula und des Präkuneus.
Diese Bereiche waren bei allen Proben stabil und passen gut zu den
zuvor beschriebenen Geschlechtsunterschieden in der funktionellen
Gehirnorganisation. Die Studienergebnisse zeigen, dass Bereiche im
Gehirn bei Frauen anders vernetzt und verknüpft sind als bei Männern,
doch erlauben diese Resultate jedoch keine Bewertung dieser Unterschiede
im Sinne von "Frauen können besser mit Gefühlen umgehen". Das bedeutet,
dass diese Daten zwar einen klaren Zusammenhang zwischen Geschlecht und
regionalspezifischer Gehirnvernetzung zeigen, jedoch keinen eindeutigen
Dimorphismus in der funktionellen Gehirnorganisation
unterstützen, der allein durch das Geschlecht bestimmt wird. Offen
bleibt daher auch die Frage, welche Ursachen es für diese Unterschiede
im Gehirn gibt, denn denkbar sind neben biologischen auch erworbene
Ursachen etwa durch die Erziehung. ionellen Gehirnorganisation
unterstützen, der allein durch das Geschlecht bestimmt wird. Offen
bleibt daher auch die Frage, welche Ursachen es für diese Unterschiede
im Gehirn gibt, denn denkbar sind neben biologischen auch erworbene
Ursachen etwa durch die Erziehung.
Knop et al. (2021) haben zwanzig Frauen mit einem speziell dafür
entwickelten Apparat stimuliert und deren Gehirn gleichzeitig mit
Magnetresonanztomographie beobachtet, um die genaue Lage des weiblichen
Genitalrepräsentationsfeldes bei Stimulation der Klitoris im primären
somatosensorischen Cortex zu finden. Neurale Reaktionen auf taktile
Stimulation der Klitorisregion im Vergleich zur rechten Hand ergaben individuell unterschiedliche fokale bilaterale Aktivierungen in dorsolateralen Bereichen,
die mit der anatomischen Lage übereinstimmten. Als nächstes wurden
cortikale Oberflächenanalysen durchgeführt, um die strukturelle Dicke
der zehn individuell am stärksten aktivierten Scheitelpunkte pro
Hemisphäre für jede Frau zu bewerten. Man konnte zeigen, dass die
Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs innerhalb eines Jahres mit der
strukturellen Dicke des individuell kartierten linken Genitalfeldes
korreliert ist. Diese Ergebnisse liefern trotz der geringen
Probandinnenzahl eine präzise funktionelle Lokalisierung des weiblichen
Genitalfeldes und erbringen auch zum ersten Mal Beweise für eine
strukturelle Variation des menschlichen Genitalfeldes in Verbindung mit
der Häufigkeit von Genitalkontakten.
In männlichen Gehirnen weniger Oxytocin und Serotonin
In der Studie "Was könnte er gerade denken? - Wie der Verstand des Mannes wirklich funktioniert" versuchte der Sozialphilosoph Michael Gurian zwei Jahrzehnte neurobiologischer Forschung mit Geschichten aus den täglichen Leben und seinen Erfahrungen als Familientherapeut zu vereinen, um folgendes Bild der männlichen Psyche zu zeichnen: Da sich in männlichen Gehirnen weniger Oxytocin und Serotonin befindet, wünscht sich das männliche Hirn am Ende eines langen Tages abzuschalten und hirnlos in Action- und Sportsendungen herumzuzappen, während sich Frauen eher mit gefühlsintensiven Gesprächen entspannen können. Das männliche Gehirn nimmt daher auch weniger Details wahr, so dass Staub und Unordnung zu Hause unbemerkt bleiben. Männliche Hormone wie Testosteron und Vasopressin verursachen, dass er sich ständig beweisen will. Das verstärkt sich noch, wenn die Familien Kinder haben.
Während des Menstruationszyklus verändert sich das weibliche Gehirn
Sexualhormone entfalten als Botenstoffe im Gehirn eine eindrucksvolle Wirkung, denn so kann eine frühe Menopause mit einem erhöhten Risiko für eine beschleunigte Gehirnalterung und Demenz im späteren Leben einhergehen. Zsido et al. (2023) konnten zeigen, dass Schwankungen der Eierstockhormone die strukturelle Plastizität des Gehirns während der reproduktiven Jahre beeinflussen. Man untersuchte dabei das Gehirn von Frauen zu sechs verschiedenen Zeitpunkten während des Menstruationszyklus, um die Morphologie von Unterregionen des medialen Temporallappens bei den Probandinnen zu kartieren. Unter Kontrolle des Wassergehalts und des Blutflusses zeigten die Ergebnisse, dass bestimmte Regionen des medialen Temporallappens, die für das episodische Gedächtnis und die räumliche Wahrnehmung bedeutsam sind, unter hohen Östradiol- und niedrigen Progesteronspiegeln an Volumen zunehmen, was also nichts anderes bedeutet, als dass sich diese Hirnareale synchron mit dem Menstruationszyklus umbauen und das weibliche Gehirn auf einen konstanten Hormonrhythmus eingestellt ist. Diese Forschungsarbeit bietet nun eine Grundlage für zukünftige Studien über die gemeinsame Dynamik von Gehirn und Eierstockfunktion und einen grundlegenden Schritt zur Entwicklung geschlechtsspezifischer Strategien zur Verbesserung der Gehirngesundheit und der psychischen Gesundheit.Frauen sind erstaunt, was Männer alles vergessen.
Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.
Peter Bamm
Geschlecht und Erinnerung
Asperholm et al. (2019) liefern deutliche Hinweise, dass Frauen sich an manche Ereignisse besser als Männer erinnern können, wobei das besonders für Unterhaltungen und die Zuordnung von Gesichtern gilt. Dabei wertete man zahlreiche frühere Studien aus, die sich mit der Erinnerung der unterschiedlichen Geschlechter an episodische Informationen befassten. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen einen leichten Vorteil haben, wenn es um das episodische Gedächtnis geht, wobei dieser Vorteil davon abhängt, an welche Ereignisse sich erinnert werden soll. Frauen schneiden besser ab, wenn es um die Erinnerung an verbale Informationen, wie Wörter, Sätze, Texte oder Gegenstände geht, aber auch im Hinblick auf die Ablageorte von Objekten oder Filminhalten. Männern hingegen fällt es leichter, sich abstrakte Informationen oder die Erinnerung an den Weg von einem Ort zum anderen ins Gedächtnis zu rufen. Zusätzlich ergab sich weiblichen Vorteil im Hinblick auf das Wiedererkennen von Gesichtern oder das sensorische Gedächtnis, also die Erinnerung an Gerüche.
Geschlechterabhängige Hirnreaktionen auf Humor
Männer sprechen im Durchschnitt um die 25.000 Wörter pro Tag
und Frauen etwa 30.000. Das Dumme ist nur, dass ich abends,
wenn ich nach Hause komme, meine 25.000 Wörter schon vergeben habe,
während meine Frau mit ihren 30.000 noch
anfängt.
Michael Collins
Allan Reiss et al. (University of Stanford) führte zehn Frauen und zehn Männern siebzig Schwarz-Weiß- Zeichentrickfilme vor und maß dabei die neuronale Aktivität verschiedener Hirnbereiche. Im Anschluss bewerteten die Teilnehmer die Filme auf einer Skala von eins bis zehn hinsichtlich der "Witzigkeit".
Den Ergebnissen zufolge ähneln sich beide Geschlechter im Gebrauch der Hirnareale, die für Sprachbedeutung und Wortbildung verantwortlich sind. Bei Frauen regen sich aber verstärkt Bereiche, die der analytischen Verarbeitung dienen: der präfrontale Cortex, der vermutlich auf eine stärkere Analyse von Sprache und Wahrnehmung verweist, und der Nucleus accumbens, ein Teil des Belohnungssystems. Vermutlich erwarten Frauen weniger eine Belohnung durch den Film als Männer. Dementsprechend reagiert ihr Belohnungssystem stärker, wenn der Zeichentrickstreifen sie tatsächlich zum Lachen bringt. Dies traf für Männer, die von Beginn an mit einem witzigen Film rechneten, nicht zu.
Mädchen haben einen feineren Geschmackssinn und Geruchssinn als Buben
Eine Studie der Universität Kopenhagen an 8900 Kindern ab dem Grundschulalter zum Geschmacksempfinden zeigte, dass Mädchen sowohl süße als auch saure Nuancen bei Lebensmitteln besser erkennen können als gleichaltrige Burschen. Deren Fähigkeit zum Differenzieren von Lebensmitteln ist bei Saurem um etwa zehn Prozent und bei Süßem sogar um 20 Prozent schwächer ausgeprägt. Die größere Sensibilität der Mädchen basiert vermutlich nicht auf der Zahl der Geschmacksknospen im Mundraum, sondern auf der Signalverarbeitung im Gehirn. Mit steigendem Alter verfeinert sich der Geschmackssinn bei Kindern geerell.
Mädchen reagieren nach der Pubertät sensibler auf Gerüche als zuvor. Das ergaben Versuche der Uni Dresden. Während Buben und Mädchen mit zehn Jahren Gerüche noch gleich wahrnehmen, geraten 17- bis 20-jährige Frauen bei Wohlgerüchen in Verzückung und rümpfen bei Gestank die Nase. Junge Männer interessieren sich kaum für Düfte.
Studien in Brasilien (Oliveira-Pinto et al., 2014) haben auch ergeben, dass Frauen eine deutlich sensiblere Nase haben, obwohl die Zahl der Riechrezeptoren etwa gleich und das Volumen des Riechkolbens sogar kleiner als bei Männern ist. Das liegt daran, dass es bei der Riechleistung nicht auf die Anzahl der Rezeptoren oder das Volumen des Riechkolbens im Gehirn ankommt, sondern konkret auf die Anzahl der Zellen im Riechkolben. Forscher haben Gehirne von Männern und Frauen seziert und die einzelnen Zellen gezählt, wobei weibliche Riechkolben im Schnitt aus über sechzehn Millionen Zellen bestehen, während männliche hingegen neun Millionen aufweisen, und auch bei den Neuronen, die für die Prozesse im Gehirn entscheiden sind, ist der Unterschied bei etwa sieben zu vier Millionen, d. h., die Zelldichte im Riechkolben ist bei Frauen signifikant höher. Zwar sind mehr Zellen in einem Organ nicht automatisch ein Beweis für eine komplexere Funktionalität, bei Gehirnzellen ist das aber sehr wahrscheinlich, allerdings müsste man auch die Anzahl der Synapsen bestimmen, um mit Sicherheit sagen zu können, dass Frauen ihren feineren Geruchssinn vor allem der Zellstruktur im Riechkolben zu verdanken haben.
Gehirndurchblutung bei Frauen stärker als bei Männern
Satterthwaite et al. (2014) fanden für bestimmte Gehirnareale besonders deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Gehirndurchblutung. Diese ist bekanntlich eine fundamentale Eigenschaft mancher Prozesse im Gehirn, und es ist bekannt, dass die Durchblutung im Erwachsenenalter bei Frauen stärker ist als bei Männern. Die Gehirne von Mädchen und Buben entwickeln sich bekanntlich in der Pubertät gegensätzlich, und etwa ab dieser Zeit wird das weibliche Gehirn insgesamt besser durchblutet als das männliche. Die Hirndurchblutung sinkt in der frühen Pubertät (im Alter von etwa zwölf Jahren) bei Mädchen und Buben noch gleichermaßen, doch ab der mittleren Phase der Pubertät (im Alter von etwa 16 Jahren) zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So nimmt die Durchblutung bei Buben immer weiter ab, während sie bei Mädchen leicht ansteigt, wobei sich dieser Trend in der späteren Pubertät noch verstärkt. Die Differenzen sind am deutlichsten im orbitofrontalen Kortex, also Regionen, die mit Sozialverhalten und der Regulierung von Emotionen verknüpft sind. Möglicherweise erklärt das, warum Frauen in vielen Tests zur sozialen Intelligenz besser abschneiden als Männer, gleichzeitig sind sie auch anfälliger für Depressionen und Angststörungen, während Männer eher unter Schizophrenie oder emotionale Blockaden leiden.
Unterschiedliche Reaktionen auf Fehler
Sobald jemand einen Fehler macht, reagiert das Gehirn im Bruchteil einer Sekunde und ermöglicht es, das Verhalten effektiv anzupassen. Eine mögliche Reaktion besteht etwa darin, nachfolgende Handlungen zu bremsen, um weitere Fehler zu vermeiden, oder einfach die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Reize zu richten und ablenkende Reize zu ignorieren. In einer internationalen Studie wurde nun über Gehirnströme gemessen, wie Männer und Frauen in einem Experiment auf gerade begangene Handlungsfehler reagieren. Die ProbandInnen erhielten eine Aufgabe, die sie trotz ablenkender Reize wiederholt korrekt ausführen mussten, wobei die dabei entstehenden Fehler mit Flüchtigkeitsfehlern etwa beim Bedienen technischer Geräte durch das Drücken der falschen Taste zu vergleichen waren. Es zeigte sich, dass Männer die Aufgaben etwas schneller bearbeiten konnten als Frauen, aber gleichzeitig reagierten ihre Gehirne stärker auf Handlungsfehler als die Gehirne der Frauen. Die Frauen hingegen passten ihr Verhalten nach begangenen Fehlern flexibler an und verlangsamten ihre Reaktionen deutlich stärker als Männer, sodass allein die Muster der fehlerbezogenen Gehirnströme ausreichten, um das Geschlecht vorherzusagen.
Frauen beim Teilen großzügiger als Männer
Soutschek et al. (2017) haben untersucht, ob Gehirne von Frauen und Männer unterschiedlich auf soziales und egoistisches Verhalten reagieren. In einer Untersuchung mit einem Kernspintomographen machten 21 Männern und 19 Frauen zunächst einen Verhaltenstest, bei dem sie entscheiden sollten, ob sie lieber eine größere Summe Geld für sich allein haben wollen oder eine kleinere Summe für jeweils sich selbst und einen anonymen Mitspieler. wobei das Geld dann beiden tatsächlich ausgezahlt wurde. Dabei beobachtete man die Aktivität des Striatums, eines Areals in der Mitte des Gehirns, das für die Bewertungs- und Belohnungsverarbeitung zuständig und bei jeder Entscheidung aktiv ist, indem es positive Gefühle bewirkt, wodurch die Ausschüttung von Endorphinen ausgelöst wird. Der Hirnbereich war dabei bei Frauen besonders aktiv, wenn sie teilten, bei Männern hingegen war er aktiver, wenn sie eine egoistische Entscheidung trafen. In einer weiteren Untersuchung überprüfte man, ob sich das Verhalten ändert, wenn die Aktivität des Striatums durch Medikamente unterdrückt wird, wobei eine Hälfte der Gruppe den Wirkstoff Amisulprid erhielt, der den Botenstoff Dopamin hemmt, der das Belohnungssystem aktiviert, während die andere Hälfte der Gruppe ein Placebo erhielt. In der Gruppe, die das unwirksame Medikament bekam, entschied sich die Mehrheit (51%) der Frauen weiterhin dafür, das Geld aufzuteilen, in der Gruppe mit dem Medikament taten das jedoch nur noch 45%. Bei den Männern verbesserte sich das soziale Verhalten, denn ohne den Wirkstoff bedachten 40 Prozent den Mitspieler, mit dem Medikament 44 Prozent. Auch wenn die Unterschiede nur minimal sind, konnte man neurologisch nachweisen, dass das männliche Gehirn eher egoistische Entscheidungen belohnt, das Gehirn der Frauen eher soziale Entscheidungen. Dieses Verhalten ist allerdings nicht angeboren, denn das Belohnungszentrum ist stark mit Lernprozessen im Gehirn verbunden, denn Frauen werden so erzogen, eher eine Belohnung für pro-soziales als für egoistisches Verhalten zu erwarten.
Literatur
Asperholm, Martin, Högman, Nadja, Rafi, Jonas & Herlitz, Agneta (2019). What did you do yesterday? A meta-analysis of sex differences in episodic memory. Psychological Bulletin, 145, 785-821.
Fischer, A. G., Danielmeier, C., Villringer, A., Klein, T. A. & Ullsperger, M. (2016). Gender influences on brain responses to errors and post-error adjustments. Scientific Reports (in press).
Goyal, Manu S., Blazey, Tyler M., Su, Yi, Couture, Lars E., Durbin, Tony J., Bateman, Randall J., Benzinger, Tammie L.-S., Morris, John C., Raichle, Marcus E., Vlassenko, Andrei G. (2019). Persistent metabolic youth in the aging female brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1815917116.
Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T. D.,
Elliott, M. A., Ruparel, K., Hakonarson, H., Gur, R. E., Gur, R., C.,
& Verma, R. (2013). Sex differences in the structural connectome of
the human brain. Doi:10.1073/pnas.1316909110.
Khan, Y. T., Tsompanidis, A., Radecki, M. A., Dorfschmidt, L., Adhya,
D., Ayeung, B., … & Baron-Cohen, S. (2024). Sex Differences in
Human Brain Structure at Birth. Biology of Sex Differences, 15, 81.
Knop, Andrea J.J., Spengler, Stephanie, Bogler, Carsten, Forster, Carina, Brecht, Michael, Haynes, John-Dylan & Heim, Christine (2021). Sensory-Tactile Functional Mapping and Use-Associated Structural Variation of the Human Female Genital Representation Field. The Journal of Neuroscience, doi:10.1523/JNEUROSCI.1081-21.2021.
Liu, Siyuan, Seidlitz, Jakob, Blumenthal, Jonathan D., Clasen, Liv S. & Raznahan, Armin (2020). Integrative structural, functional, and transcriptomic analyses of sex-biased brain organization in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1919091117.
Maurer, M. (2002). Sexualdimorphismus, Geschlechtskonstruktion und
Hirnforschung. In Ursula Pasero & Anja Gottburgsen (Hrsg.), Wie
natürlich ist Geschlecht? Gender und die Konstruktion von Natur und
Technik (S. 65-108). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Ana V. Oliveira-Pinto, Raquel M. Santos, Renan A. Coutinho, Lays M. Oliveira, Gláucia B. Santos, Ana T. L. Alho, Renata E. P. Leite, José M. Farfel, Claudia K. Suemoto, Lea T. Grinberg, Carlos A. Pasqualucci, Wilson Jacob-Filho & Roberto Lent (2014). Sexual Dimorphism in the Human Olfactory Bulb: Females Have More Neurons and Glia
OÖN vom 8.1.2009 und vom 17.4.2009
Raschle, N. M. et al. (2019). Atypical dorsolateral prefrontal activity in females with conduct disorder during effortful emotion regulation. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, doi:10.1016/j.bpsc.2019.05.003.
Theodore D. Satterthwaite, Russell T. Shinohara, Daniel H. Wolf, Ryan D. Hopson, Mark A. Elliott, Simon N. Vandekar, Kosha Ruparel, Monica E. Calkins, David R. Roalf, Efstathios D. Gennatas, Chad Jackson, Guray Erus, Karthik Prabhakaran, Christos Davatzikos, John A. Detre, Hakon Hakonarson, Ruben C. Gur, and Raquel E. Gur (2014). Impact of puberty on the evolution of cerebral perfusion during adolescence. Proceedings of the National Academy of Sciences. Doi:10.1073/pnas.1400178111
Soutschek, Alexander, Burke, Christopher J., Raja Beharelle, Anjali, Schreiber, Robert, Weber, Susanna C., Karipidis, Iliana I., ten Velden, Jolien, Weber, Bernd, Haker, Helene, Kalenscher, Tobias & Tobler, Philippe N. (2017). The dopaminergic reward system underpins gender differences in social preferences. Nature Human Behaviour, doi: 10.1038/s41562-017-0226-y.
Stangl, W. (2023, 10. Mai). Die Ungleichheit der Geschlechter zeigt sich auch im Gehirn. arbeitsblätter news.
Stangl, W. (2023, 17. Oktober). Während des Menstruationszyklus verändert sich das weibliche Gehirn. was stangl bemerkt ….
https://bemerkt.stangl-taller.at/waehrend-des-menstruationszyklus-veraendert-sich-das-weibliche-gehirn
https://psychologie-news.stangl.eu/5581/maennliche-und-weibliche-gehirn-unterscheiden-sich-schon-bei-der-geburt.
Zugman, André, Alliende, Luz María, Medel, Vicente, Bethlehem, Richard A.I., Seidlitz, Jakob, Ringlein, Grace, Arango, Celso, Arnatkevičiūtė, Aurina, Asmal, Laila, Bellgrove, Mark, Benegal, Vivek, Bernardo, Miquel, Billeke, Pablo, Bosch-Bayard, Jorge, Bressan, Rodrigo, Busatto, Geraldo F., Castro, Mariana N., Chaim-Avancini, Tiffany, Compte, Albert, Costanzi, Monise, Czepielewski, Leticia, Dazzan, Paola, de la Fuente-Sandoval, Camilo, Di Forti, Marta, Díaz-Caneja, Covadonga M., María Díaz-Zuluaga, Ana, Du Plessis, Stefan, Duran, Fabio L. S., Fittipaldi, Sol, Fornito, Alex, Freimer, Nelson B., Gadelha, Ary, Gama, Clarissa S., Garani, Ranjini, Garcia-Rizo, Clemente, Gonzalez Campo, Cecilia, Gonzalez-Valderrama, Alfonso, Guinjoan, Salvador, Holla, Bharath, Ibañez, Agustín, Ivanovic, Daniza, Jackowski, Andrea, Leon-Ortiz, Pablo, Lochner, Christine, López-Jaramillo, Carlos, Luckhoff, Hilmar, Massuda, Raffael, McGuire, Philip, Miyata, Jun, Mizrahi, Romina, Murray, Robin, Ozerdem, Aysegul, Pan, Pedro M., Parellada, Mara, Phahladira, Lebogan, Ramirez-Mahaluf, Juan P., Reckziegel, Ramiro, Reis Marques, Tiago, Reyes-Madrigal, Francisco, Roos, Annerine, Rosa, Pedro, Salum, Giovanni, Scheffler, Freda, Schumann, Gunter, Serpa, Mauricio, Stein, Dan J., Tepper, Angeles, Tiego, Jeggan, Ueno, Tsukasa, Undurraga, Juan, Undurraga, Eduardo A., Valdes-Sosa, Pedro, Valli, Isabel, Villarreal, Mirta, Winton-Brown, Toby T., Yalin, Nefize, Zamorano, Francisco, Zanetti, Marcus V., cVEDA, Winkler, Anderson M., Pine, Daniel S., Evans-Lacko, Sara, Crossley, Nicolas A., Murthy, Pratima, Chakrabarti, Amit, Basu, Debasish, Subodh, B.N., Singh, Lenin, Singh, Roshan, Kalyanram, Kartik, Kartik, Kamakshi, Kumaran, Kalyanaraman, Krishnaveni, Ghattu, Kuriyan, Rebecca, Kurpad, Sunita Simon, Barker, Gareth J., Bharath, Rose D., Desrivieres, Sylvane, Purushottam, Meera, Orfanos, Dimitri P., Sharma, Eesha, Hickman, Matthew, Heron, Jon, Toledano, Mireille B. & Vaidya, Nilakshi (). Country-level gender inequality is associated with structural differences in the brains of women and men. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120, doi:10.1073/pnas.2218782120.
Zsido, Rachel G., Williams, Angharad N., Barth, Claudia, Serio, Bianca, Kurth, Luisa, Mildner, Toralf, Trampel, Robert, Beyer, Frauke, Witte, A. Veronica, Villringer, Arno & Sacher, Julia (2023). Ultra-high-field 7T MRI reveals changes in human medial temporal lobe volume in female adults during menstrual cycle. Nature Mental Health, 1, 761-771.
Weis, Susanne, R Patil, Kaustubh, Hoffstaedter, Felix, Nostro, Alessandra, Yeo, B.T. Thomas & Eickhoff, Simon(2019). Sex Classification by Resting State Brain Connectivity. Cerebral cortex, doi:10.1093/cercor/bhz129.
http://ww.wissenschaft-online.de/09. November 2005
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsdetermination (14-11-21)
Überblick Arbeitsblätter "Geschlechtsunterschiede ;-)"
- Psychologie der Geschlechtsunterschiede
- Geschlecht: Emotion und Aggression
- Geschlecht und Beziehung
- Geschlecht und Depression
- Geschlecht und Gehirn
- Zusammenspiel zwischen Gehirnentwicklung und sozialem Verhalten
- Rotationstest Mann-Frau
- Geschlecht und mentale Erregung
- Frauen und Männer denken unterschiedlich oft an Sex
- Geschlecht und Hormone
- Geschlecht und Intelligenz
- Die Male Idiot Theory
- Geschlecht und Kunst
- Geschlecht und Karriere
- Weibliche Führungskräfte
- Geschlechtsrollenkonflikte
- Geschlecht und Körper
- Geschlecht und Sucht
- Geschlecht und Kommunikation
- Geschlecht-Schlaf
- Geschlecht-Schule-Leistung
- Geschlecht: Social-Media
- Spam: Unterschied im Umgang von Mann und Frau
- Geschlecht und Orientierungssinn
- Geschlecht-Stereotype
- Geschlecht: Kurioses aus der Geschlechterforschung
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::