Psychologische Theorien zur Entstehung der Geschlechtsunterschiede
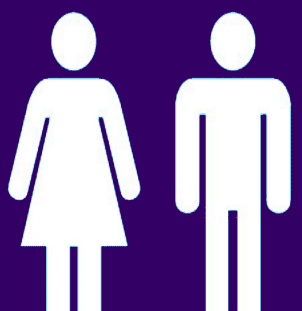
Es gibt verschiedene psychologische Theorieansätze, die zu
erklären versuchen, warum Buben und Mädchen schon im Kindergarten
unterschiedliche Verhaltensrepertoires, Interessen und
Beschäftigungsvorlieben haben, wobei das Schwergewicht dabei auf der
Entwicklung in der Kindheit und der Rolle der Eltern bei der
Geschlechtsrollenentwicklung liegt. Die Bekräftigungstheorie
postuliert, dass Buben und Mädchen schon ab dem Kleinkindalter für
Verhalten, dass ihrem Geschlecht angemessen erscheint, belohnt werden,
was durch Lob, Anerkennung und direkte Belohnung erfolgt, während ihrem
Geschlecht unangemessene Verhaltensweisen nicht verstärkt, sondern sogar
manchmal sogar bestraft, missbilligt oder einfach ignoriert werden. Die
Bekräftigungstheorie basiert also darauf, dass bestimmte dem Geschlecht
entsprechende Verhaltensstereotype existieren und Eltern ihre Kinder
diesen Stereotypen gemäß erziehen, d.h., dass Eltern ihre Kinder
unterschiedlich behandeln. Die Imitationstheorie
postuliert, dass Kinder geschlechtstypisches Verhalten durch die
Beobachtung gleichgeschlechtlicher Modelle bzw. die Nachahmung und
Übernahme deren geschlechtsangemessenen Verhaltens erwerben. Dabei sind
vor allem die Bezugspersonen im Hinblick auf erfolgreiches oder
erfolgloses Verhalten ihre Vorbilder, d.h., nachgeahmt wird vorwiegend
erfolgreiches Modellverhalten überwiegend am gleichgeschlechtlichen
Vorbild. Die der Imitationstheorie nahe Identifikationstheorie
nimmt an, dass durch die Primärbeziehungen geschlechtsspezifisches
Verhalten gefördert bzw. erlernt wird, also durch die Beziehungen zu den
wichtigsten Bezugspersonen gemeint, mit denen sich in den ersten
Lebensjahren eine intensive gefühlsmäßige Beziehung und Bindung
entwickelt hat, wodurch sich ein Kind mit dieser Person identifiziert,
also Mädchen mit der Mutter und Buben sich mit dem Vater identifizieren,
da Buben und Mädchen sich innerlich mit dem gleichgeschlechtlichen
Elternteil als ähnlich oder gar identisch erleben, wodurch auch
Einstellungen, Werthaltungen und äußere Verhaltensweisen übernommen
werden. Die kognitive Theorie knüpft an die allgemeine
Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget an, wonach sich die
geistige Entwicklung des Menschen von innen heraus und in mehreren
Stadien vollzieht. Das sich aktiv mit seiner physikalischen und sozialen
Umwelt auseinandersetzende Kind erwirbt demnach Wissen und ein immer
differenzierteres Urteilsvermögen auch über geschlechtsbezogene Merkmale
und Inhalte, die für seine Kultur typisch sind, wodurch ein Kind sich
selbst und andere Personen dem weiblichen oder männlichen Geschlecht
eindeutig zuzuordnet. Während in der früheren Kindheit diese Zuordnung
vor allem durch äußere Merkmale wie Frisur, Kleidung oder Körperbau
erfolgt, kommen später Verhaltensweisen, Beschäftigungsvorlieben oder
Einstellungen und Haltungen hinzu. In der psychoanalytischen Theorie
der Geschlechtsrollenentwicklung ist der anatomische Unterschied
zwischen Buben und Mädchen ausschlaggebend. Während Knaben einen Penis
besitzen und Mädchen nicht, sodass sie sich als verstümmelt und
minderwertig empfinden und das andere Geschlecht deshalb beneiden.
Mädchen fühlen sich daher sich zum Vater hingezogen, um ihren
kastrierten Zustand zu beenden, während Buben sich zur Mutter hingezogen
fühlen und den Vater als Rivalen erleben. Diese auf das andere
Geschlecht bezogenen Wünsche spielen sich unbewusst während der ödipalen
Phase ab. Zu diesen psychologischen Theorien kommen biologische,
kulturelle und soziologische Einflussfaktoren hinzu, die eine
zusätzliche Rolle bei der Herausbildung geschlechtstypischen Verhaltens
spielen.
Auswirkungen von psychosozialen Belastungsfaktoren
Psychosoziale Faktoren wirken sich auf komplexe Weise auf die psychische Gesundheit und die gesundheitsbezogene Lebensqualität aus, wobei es geschlechtsspezifischen Unterschiede in diesen Wechselwirkungen gibt. Weiß et al. (2023) haben untersucht, wie psychosoziale Faktoren wie soziale Unterstützung sowie persönliche und arbeitsbezogene Sorgen die psychische Gesundheit und die Lebensqualität von Frauen und Männern im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie unterschiedlich beeinflusst haben. Als stärkster Einflussfaktor auf das psychische Wohlbefinden stellten sich bei beiden Geschlechtern Ängste heraus, doch bei den Gründen der Angst gab es deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, denn bei Männern stieg die Angst in zunehmenden Maß mit der Sorge um den Arbeitsplatz, bei Frauen fand sich dieser Effekt nicht. Bei Frauen zeigte sich eine Zunahme der Angstwerte parallel mit einer Zunahme der Sorgen um Familie und Freunde. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit traditionellen Geschlechterrollenbildern, die sich wiederum darauf auswirken, welche Erwartungen die betreffenden Personen an sich selbst haben. Für Frauen ist die soziale Unterstützung ein bedeutender Faktor, der sie widerstandsfähiger gegenüber Stress und Ängsten macht, während bei Männern dagegen die Unterstützung durch ihr per sönliches Umfeld keine wichtige Rolle für ihre psychische Gesundheit spielte. Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, bei therapeutischen Maßnahmen soziale Aspekte zu berücksichtigen, um die psychische Gesundheit von Frauen und Männern zu verbessern.Literatur
https://psychologie-news.stangl.eu/4642/unterschiedliche-auswirkungen-von-psychosoziale-belastungsfaktoren-auf-die-geschlechter.
Weiß, Martin, Gründahl, Marthe, Deckert, Jürgen, Eichner, Felizitas A., Kohls, Mirjam, Störk, Stefan, Heuschmann, Peter U., Hein, Grit, Gelbrich, Götz, Weißbrich, Benedikt, Dölken, Lars, Kurzai, Oliver, Ertl, Georg, Barth, Maria & Morbach, Caroline (2023). Differential network interactions between psychosocial factors, mental health, and health-related quality of life in women and men. Scientific Reports, 13, doi:10.1038/s41598-023-38525-8.