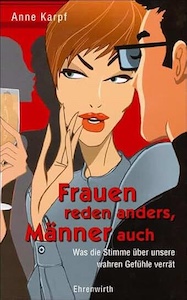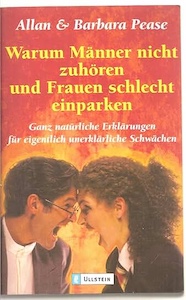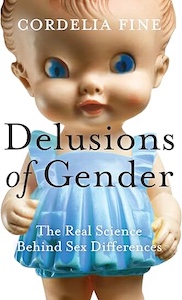Männliche Dummheit bereitet mir größtes Vergnügen,
Gott sei Dank ist das eine schier unerschöpfliche Quelle der Unterhaltung.
Mary Wortley Montagu
Frauen sind viel vernünftiger als Männer.
Oder haben Sie schon eine Frau erlebt, die einem Mann wegen seiner Beine nachrennt.
Marlene Dietrich
Geschlecht und Intelligenz
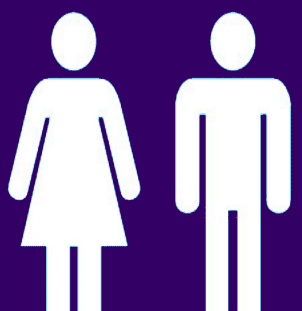
Unterschiede im intelligenten Denken und Gedächtnis
Frauen und Männer mit dem gleichen Intelligenzquotienten
aktivieren unterschiedliche Gehirnregionen. Besonders die graue und
weiße Gehirnsubstanz sind unterschiedlich verteilt: So verfügen Frauen
über zehn Mal mehr weiße Masse als Männer, in den Hirnen letzterer ist
hingegen sieben Mal mehr graue Substanz als in jenen von Frauen. Die
graue Substanz besteht überwiegend aus den Zellkörpern, die weiße
Substanz dagegen aus den Ausläufern der Nervenzellen. Auch räumlich sind
die Aktivitätszentren bei den beiden Geschlechtern unterschiedlich
verteilt: Frauen aktivieren hauptsächlich den Frontallappen, während
Männer neben dem Frontal- auch den Parietallappen beanspruchen. Es gibt
also nicht eine einzige neuro-anatomische Grundlage für Intelligenz.
Frauen lösen häufig sprachliche oder Gedächtnisaufgaben
besser, Männer sind dagegen im Schnitt bei der Raumvorstellung und bei
Rechenaufgaben leicht im Vorteil. Frauen mittleren Alters
haben im Durchschnitt ein besseres Erinnerungsvermögen als
gleichaltrige Männer, was sich einer Studie mit Frauen und Männern
zwischen 45 und 55 Jahren mit verschiedenen Gedächtnistests zeigte. Es
zeigte sich nämlich, dass ein Absinken des weiblichen Geschlechtshormons
Östradiol (eine Form des Östrogens) bei Frauen nach der Menopause mit
schlechteren Testergebnissen beim erstmaligen Erlernen sowie beim
Abrufen zuvor gelernter Informationen verbunden ist, doch waren
Probandinnen Probanden auch nach der Menopause noch in allen
Gedächtnistests überlegen. Vor allem neu Gelerntes konnten sich Frauen
mit einem niedrigen Östradiolspiegel schlechter merken, wobei von den
hormonellen Veränderungen insbesondere Bereiche in frontalen Regionen
des Hirns betroffen sein dürften, die für das Kurzzeitgedächtnis eine
wichtige Rolle spielen.
Die Male Idiot Theory
Die Male Idiot Theory - also die männliche Idiotentheorie - besagt nicht, dass alle Männer Idioten sind, sondern nur, dass fast alle Idioten Männer sind. Die Begründung liegt unter anderem in kleinen Unterschieden der Verteilung der Intelligenzquotienten bei Frauen und Männern, denn die Glockenkurven haben zwar annähernd den gleichen Mittelpunkt bei Frauen und Männern, aber bei Männern fällt die Kurve flacher aus, d. h., die Streuung ist größer, was bedeutet, dass im Durchschnitt Frauen und Männer zwar ungefähr gleich intelligent sind, aber bei Männern gibt es mehr Extremfälle im negativen wie im positiven Sinn, also mehr Idioten und mehr Genies. Eine Ursache für diese unterschiedliche Verteilungsbreite könnte nach Ansicht mancher im Y-Chromosom liegen. Offenbar sind Männer bereit, zahlreiche unnötige Risiken im Streben nach männlicher sozialer Wertschätzung einzugehen. Die Male Idiot Theory besagt vor allem aber, dass die Ursache dafür, dass Männer anfälliger für Verletzungen und tödliche Unfälle sind, einfach darin liegt, dass es unter ihnen mehr Idioten gibt und Idioten offenbar mehr dumme Dinge tun. Trotz zahlreicher anekdotischer Belege, die diese Theorie bestätigen, gab es bisher nie eine systematische Analyse der Geschlechtsunterschiede in idiotischm Risikoverhalten.
In einer Studie (Lendrem et al., 2014) hat man daher die Daten der Darwin Awards aus zwanzigJahren ausgewertet, um das Geschlecht der jährlichen Gewinner zu ermitteln. Die Darwin Awards werden an Menschen verliehen, die auf so erstaunlich dumme Weise sterben, dass ihr Handeln das langfristige Überleben der Spezies sichert, indem es selektiv weniger Idioten überleben lässt. Die Nominierungen dafür werden streng nach fünf Auswahlkriterien bewertet - Tod, Stil, Wahrhaftigkeit, Fähigkeit und Selbstauswahl - um sicherzustellen, dass nur die würdigsten Kandidaten diesen Preis erhalten. Dabei machten Männer in über dreihundert untersuchten Fällen erstaunliche 88,7 % der Darwin-Preisträger aus, was eindeutig einen Geschlechtsunterschied bei der Risikobereitschaft zeigt. Möglicherweise verschafft idiotisches Verhalten denjenigen, die ihm nicht zum Opfer fallen, einen noch nicht identifizierten selektiven Vorteil.
Lebensstandard und Bildungsniveau haben Einfluss auf Leistungsunterschiede zwischen Männern und Frauen
Daniela Weber et al. (2014) haben Daten von über 50-jährigen Männern und Frauen aus 13 europäischen Ländern ausgewertet, die an Tests zu Kurzzeitgedächtnis, Alltagsmathematik- und sprachlichen Fähigkeiten teilgenommen hatten. Es zeigte sich, dass unterschiedliche Fähigkeiten zwischen den Geschlechtern mit dem Alter, dem Herkunftsland, den Lebensumständen und den Bildungschancen im Jugendalter zusammenhängen. Wo sich die Bedingungen verbessert hatten, waren die Frauen den Männern in Gedächtnisfunktionen überlegen, während sich der Vorteil der Männer bei der Mathematik verringerte.
In den südlichen Ländern Griechenland, Spanien und Italien lagen beim Kurzzeitgedächtnis vor allem Männer älterer Jahrgänge vorn. In Nordeuropa (Dänemark und Schweden) hatte aber die Frauen aller Jahrgänge die Männer bereits überflügelt, und dieser Abstand hat sich bei den Jüngeren sogar noch vergrössert. In Mitteleuropa (Schweiz, Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Niederlande und Polen) waren bereits Frauen ab dem Jahrgang 1932 im Vorteil. Bei den mathematischen Fähigkeiten schnitten Männer über alle drei Grossregionen besser ab, doch dieser Vorteil verringerte sich, je jünger die Geburtenkohorten werden, doch gab es keinen Trend dahin, dass der Unterschied ganz verschwindet. Hingegen verschwanden die Unterschiede beim Arbeitsgedächtnis und der Antwortgeschwindigkeit, also wenn es etwa galt, in einer Minute möglichst viele Tiere zu nennen. Hatten im Süden die Männer noch die Nase vorn, lagen in Mitteleuropa die Jüngeren schon gleichauf und in Nordeuropa fand sich kein Unterschied.
Die Resultate dieser Metastudie legt nahe, dass Verschiebungen daher rühren, dass Frauen mehr als Männer davon profitieren, wenn sich Lebensstandard und Bildungsniveau verbessern und damit ihre kognitiven Fähigkeiten stärker erhöhen als Männer.
Unterschiede in der Wahrnehmung von Gegenständen
Für eine Studie sollten sich männliche und weibliche Probanden Bilder von Blättern, Eulen, Schmetterlingen, Watvögeln, Pilzen, Autos, Flugzeugen und Motorrädern einprägen. Danach mussten sie diese Bilder unter ähnlichen, aber unbekannten Bildern derselben Kategorien wiedererkennen. Nach dem gleichen Prinzip führten die Forscher anschließend Wiedererkennungstests mit Gesichtern durch, bei denen sich zeigte, dass die besten Autoerkenner und Vogelspezialistinnen gleichzeitig auch die erfolgreichsten Kandidaten bei Wiedererkennungstests von Gesichtern waren. Dies ist nach Ansicht der Wissenschaftler insofern überraschend, da bisher angenommen worden war, dass die Wahrnehmung von Gesichtern anders funktioniert als die von Objekten. Man vermutet hinter den geschlechtsspezifischen Wahrnehmungsfähigkeiten Grundinteressen, in denen sich Männern und Frauen unterscheiden.
Unterschiede im Tastsinn: Frauen haben mehr Fingerspitzengefühl
Frauen haben nach neueren Erkenntnissen mehr Fingerspitzengefühl, da ihre Hände bzw. Finger im Durchschnitt kleiner sind, und je kleiner die Fingerspitze, desto feinere Strukturen können auf einer Oberfläche erkannt werden. Auf den Fingerspitzen gleichaltriger Menschen ist die Zahl der Merkel-Zellen (Nervenzellen, die den Druck wahrnehmen und um die Schweißporen verteilt sind) ähnlich hoch, damit sitzen diese Sensoren auf kleinen Fingern besonders dicht beieinander und liefern dem Gehirn daher mehr detaillierte Eindrücke.
Das Kind hat den Verstand meistens vom Vater, weil die Mutter ihren noch besitzt.
Adele Sandrock
Unterschiede in mathematischen Fähigkeiten?
Mädchen weisen häufig sehr schlechte Leistungen in Mathematik auf und erreichen öfter als Knaben nicht die notwendigen Mindestkompetenzen, wobei das nicht bedeutet, dass Knaben von Natur aus einen besseren Zugang zu Zahlen haben, denn es gibt Länder wie Island, wo Mädchen bei Pisa bereits eindeutig besser in Mathe abschnitten als ihre gleichaltrigen Mitschüler. Auch in der TIMMSS-Studie zeigten in mehreren Ländern Mädchen bessere Mathematikleistungen. Generell vermutet man, dass Mädchen sich oft weniger zutrauen und deshalb auch schlechtere Noten haben. Auch schreiben sich Knaben im Schulfach Mathematik größere Fähigkeiten zu als Mädchen, und zwar in einem Ausmaß, das durch die tatsächlichen Schulnoten nicht gerechtfertigt ist. Dabei weichen die entsprechenden Selbsteinschätzungen von Schülerinnen und Schülern bereits in der fünften Klasse deutlich voneinander ab, und die Unterschiedeb leiben bis einschließlich der zwölften Jahrgangsstufe weitgehend bestehen. In vielen Gesellschaften herrscht ein Klima, in dem es als normal erscheint, dass Mädchen Mathematik nicht so gut können, ein Faktor, der sich offenbar auch auf die Schulleistungen auswirkt. Grundlage ist dabei das Rollenklischee, dass Mädchen einfach nicht rechnen können und sie in dieser Fehleinschätzung auch noch von vielen Eltern bestärkt werden. Mädchen werden offenbar unbewusst dazu erzogen, keine besonders gute Mathematikkenntnisse zu besitzen, sodass gerade die Eltern oft bewusst oder unbewusst dazu bei tragen, dass sich Knaben mehr für Mathematik und Naturwissenschaften interessieren, etwa indem sie sich für ihre Töchter seltener einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf vorstellen können als für ihre Söhne. Auch wenn es sich dabei um einen Bildungsmythos handelt, ändert das nichts daran, dass sich Vorurteile häufig bestätigen, weil Mädchen sich dadurch weniger zutrauen und ihr schlechteres Abschneiden so zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. In Kanada erreichten Studentinnen in einem Mathetest deutlich weniger Punkte, wenn sie vorher gesagt bekamen, dass Frauen in diesem Test üblicherweise schlechtere Leistungen erbringen als Männer, wobei ohne diese Ansage die Studentinnen ähnlich gut abschnitten wie ihre männlichen Kommilitonen. Das verwundert umso mehr, als viele Mädchen gut statische Strukturen analysieren, sich aber schlechter dynamische Prozesse vorstellen können, was wiederum Knaben oft leicht fällt. Es gibt also offenbar Unterschiede im Gehirn, doch die bedeuten nicht, dass Mädchen automatisch schlechter in Mathematik sind, sondern man müsste sie lediglich anders auf die Aufgaben vorbereiten, damit sie genauso gut abschneiden wie Knaben. Allerdings gibt es in den letzten Jahrzehnten ein gewandeltes gesellschaftliches Bewusstsein und mehr erfolgreiche Rollenmodelle für Frauen und Mädchen, und es scheint realistisch, dass sich in ein paar Jahrzehnten diese Rollenbilder verändern werden, und damit auch die Leistungen in Mathematik bei Mädchen.
Möhring et al. (2021) untersuchten den Zusammenhang zwischen räumlichen Fähigkeiten von Kindern mit dem späteren mathematischen Verständnis der Kinder. Räumliche und mathematische Fähigkeiten wurden mit standardisierten Tests gemessen, wobei die Ausgangspunkte der Kinder und die Wachstumsrate der räumlichen Fähigkeiten mit latenten Wachstumskurvenmodellen analysiert wurden. Ebenfalls untersuchte man den Einfluss verschiedener Kovariaten auf die Entwicklung der räumlichen Fähigkeiten und fand heraus, dass der sozioökonomische Status, die Sprachkenntnisse und das Geschlecht, aber nicht der Migrationshintergrund die räumliche Entwicklung der Kinder vorhersagen konnten. Kinder, die also mit drei Jahren mit geringeren räumlichen Fertigkeiten in die Untersuchung starteten, entwickelten diese in den Folgejahren zwar schneller, schnitten aber mit sieben Jahren in Mathematik immer noch schlechter ab. Auch gelang es diesen Kindern trotz der schnelleren Entwicklung nicht, die Kinder mit besserem räumlichen Denken bis zum Schuleintritt vollständig einzuholen. Mit drei Jahren unterschieden sich Buben und Mädchen praktisch nicht, doch in den Folgejahren entwickelt sich die Raumvorstellung bei Mädchen jedoch langsamer als bei Buben. Man vermutet, dass diese nicht nur mehr räumliche Sprache hören, sondern auch typische Buben-Spielsachen nutzen, die das räumliche Denken fördern (z. B. Bausteine), während auf Mädchen ausgerichtete Spielsachen vor allem soziale Fertigkeiten ansprechen. Man kann daraus schließen, dass neben der sprachlichen Förderung auch die Förderung des räumlichen Denkens für Kinder im Vorschulalter wichtig ist, um damit eine gute Basis für den späteren Erfolg in Mathematik zu legen.
Eine Reanalyse PISA-Studie von 2003, in der die Ergebnisse von 270.000 SchülerInnen zeigte, dass Mädchen in der Mathematik insgesamt durchschnittlich etwas schlechtere Leistungen erbracht hatten als die Jungen, aber die Resultate spiegelten vor allem den Einfluss kultureller Unterschiede wider: Auf dem letzten Platz landete die Türkei, wo die Mädchen in der Mathematik 22,6 weniger Punkte erreichten, in den skandinavischen Ländern war praktisch kein Unterschied mehr vorhanden, und in Island schnitten die Mädchen sogar um 14,5 Punkte besser ab. Der Vergleich mit Indices zur Chancengleichheit in den verschiedenen Ländern zeigte eine deutliche Korrelation: Je emanzipierter die Frauen in einem Staat, desto besser können die Mädchen rechnen. Eine aktuelle Untersuchung aus den USA von Janet S. Hyde (University of Wisconsin, University of California) verglich die Leistungsdaten von mehr als sieben Millionen SchülerInnen aus zehn verschiedenen US-Staaten. Das Resultat: Mädchen und Jungen sind praktisch gleich gut in Mathematik.
Nicole Else-Quest analysierte 2009 ebenfalls die beinahe 500000 Datensätze der TIMSS- und der Pisa-Studie von 2003 aus 69 Ländern, wobei die Ergebnisse zeigen, dass Mädchen die gleiche Leistung bringen wie Knaben, wenn sie die richtige pädagogische Unterstützung bekommen und sich an weiblichen Vorbildern orientieren können. Männliche Jugendliche bringen zwar in der Regel bessere Leistungen, was aber an den stärkerem Selbstbewusstsein und der Überzeugung, dass Mathematik später für den Beruf wichtig sei, liegt. Unterschiede zwischen den Geschlechtern differierten von Land zu Land erheblich, da die Stellung der Frau in der Gesellschaft und ihr Lebensstandard eine große Rolle spielen. In Ländern, in denen Frauen wichtige Funktionen im Bereich der Wissenschaft übernehmen, zeigen auch Mädchen bessere mathematische Fähigkeiten. Die Analyse von englischsprachigen wissenschaftlichen Arbeiten zwischen 1990 und 2007, in denen mathematische Fähigkeiten von Männern und Frauen verschiedenen Alters, von der Grund- bis zur Oberschule und darüber hinaus, vergleichen worden waren, und die Ergebnisse mehrerer Langzeitstudien ergab, dass die Unterschiede in den Rechenleistungen zwischen den Geschlechtern sehr gering waren. Offensichtlich haben beide Geschlechter annähernd gleiche mathematische Fähigkeiten, doch dringt diese Erkenntnis nur langsam zu LehrerInnen und Eltern durch, denn diese senden unterschwellige Botschaften, welche Leistungen sie von jungen Mädchen oder Buben in welchen Fächern erwarten, was einen ernormen Einfluss auf ihre eigene Meinung von ihren Fähigkeiten hat.
Es ist übrigens ein Vorurteil, dass Schülerinnen in Mathematik ängstlicher und gehemmter sind als ihre Mitschüler, denn in einer Studie mit 700 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5 bis 11 mussten die Jugendlichen einen Fragebogen zur Angst vor Mathematikprüfungen ausfüllen. In einem zweiten Teil der Studie wurden sie zur Angst vor dem Mathematikunterricht gemessen, indem sie während des Unterrichts ihr Feedback zur ihrer gegenwärtigen Angst über einen kleinen Handcomputer eingaben. Während der Fragebogenteil zwar frühere Befunde bestätigte, dass Mädchen über stärkere Mathematikangst als Buben äußern, doch in der echten Prüfungs- oder Unterrichtssituation fühlten sie sich jedoch keineswegs ängstlicher als ihre Mitschüler. Der Schluss daraus: Mädchen haben nicht mehr Angst, sondern sie glauben nur, mehr Angst zu haben. Auch geben Mädchen nicht einfach offener ihre Angst zu als Buben, sondern man vermutet, dass die Angst der Mädchen im stärkeren Glauben an Stereotypen wurzelt, d. h., Mädchen vertrauen weniger auf ihre Fähigkeiten als die Buben, unabhängig von ihren tatsächlichen Leistungen, und bewerten deshalb ihre Angst vor dem Fach höher. Das ist vermutlich ein wichtiger Grund dafür, dass Frauen weniger häufig als Männer in mathematikintensive Berufsfelder gehen, sodass Mädchen ganze Berufsfelder auf Grund von ungerechtfertigten Fehleinschätzungen meiden. Lehrerinnen könnten diese selbstabwertenden Einstellungen korrigieren, indem sie ihre Schülerinnen darauf hinweisen, dass sich ihre Leistungen und Ängste nicht von denen ihrer Mitschüler unterschieden (vgl. Goetz et al., 2013).
Unterschied beim räumlichen Orientierungsvermögen zwischen den Geschlechtern auch bei Hunden
Müller et al. (2022) studierten am Beispiel Hund, ob es bei
Säugetieren geschlechtsbedingte Wahrnehmungsunterschiede gibt. Dafür
ließen sie in einem Experiment 50 Hunde (je 25 weibliche und 25
männliche) zwischen den Beinen ihres Herrchens Platz nehmen. Während die
Hundebesitzer mit verbundenen Augen dasaßen, konnten die Tiere
beobachten, wie ein blauer Ball vor ihren Augen dahinrollte, kurz hinter
einem Sichtschirm verschwand und jedes zweite Mal gegen einen doppelt
so großen ausgetauscht wurde. Männliche Hunde schauten im Durchschnitt
17 Sekunden dem wiederaufgetauchten Ball nach, ganz egal, ob er nun
seine Größe änderte oder nicht. Hündinnen hingegen schenkten dem
normalen Ball nur etwa 11 Sekunden Aufmerksamkeit, war der Ball doppelt
so groß, schauten sie ihm 35 Sekunden nach.
Geschlechtsunterschiede in der Gehirngröße bei Singvögeln
Bisher dachte man, dass die Geschlechtsunterschiede beim Gesangsverhalten sich im Gehirn der Tiere widerspiegeln, wobei man dies bei den Arten, bei denen sich auch das Gesangsverhalten stark unterscheide bzw. bei denen nur die Männchen singen, auf Strukturunterschiede im Gehirn von Männchen und Weibchen zurückführte. Bei Untersuchungen zeigte sich aber ein vom sozialen Status abhängiger Geschlechtsunterschied, denn die dominanten Männchen hatten ein fast dreimal so großes Gesangszentrum wie die weiblichen Tiere. Verglichen sie jedoch subdominante Männchen mit Weibchen, die beide denselben Duettgesang singen, so war der männliche Gehirnabschnitt immer noch doppelt so groß wie der weibliche. Die Größenunterschiede kommen hauptsächlich durch eine höhere Anzahl von Nervenzellen in diesen Arealen zustande, wobei sich keinerlei Geschlechtsunterschiede in jener Region feststellen ließ, die beim Gesangslernen eine Rolle spielt.
Literatur
Else-Quest, Nicole M., Hyde, Janet Shibley & Linn, Marcia C. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 103-127.
Goetz, T., Bieg, M., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Hall, N.
C., (2013). Do girls really experience more anxiety in mathematics?
Psychological Science.
Lendrem, Ben Alexander Daniel, Lendrem, Dennis William, Gray, Andy & Isaacs, John Dudley (2014). The Darwin Awards: sex differences in idiotic behaviour. British Medical Journal, 349, doi:10.1136/bmj.g7094.
Möhring, Wenke, Ribner, Andrew D., Segerer, Robin, Libertus, Melissa E., Kahl, Tobias, Troesch, Larissa Maria & Grob, Alexander (2021). Developmental trajectories of children's spatial skills: Influencing variables and associations with later mathematical thinking. Learning and Instruction, 75, doi:10.1016/j.learninstruc.2021.101515.
Müller, C. A., Mayer, C., Dörrenberg, S., Huber, L. & Range, F. (2011). Female but not male dogs respond to a size constancy violation. Biol Lett 2011 : rsbl.2011.0287v1-rsbl20110287.
Weber, D., Skirbekk, V., Freund, I. & Agneta Herlitz, A. (2014). The Changing Face of Cognitive Gender Differences in Europe. Proceedings of the National Academy of Science. PNAS Early edition www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1319538111.
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/mathe-warum-maedchen-schlechter-abschneiden-a-1221366.html (18-08-03)
http://www.mpg.de/4337884/gehirngroesse_bei_singvoegeln?filter_order=L (11-06-11)
science.ORF.at vom 25.1.05.
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-20819-2016-11-10.html (16-11-11)
Überblick Arbeitsblätter "Geschlechtsunterschiede ;-)"
- Psychologie der Geschlechtsunterschiede
- Geschlecht: Emotion und Aggression
- Geschlecht und Beziehung
- Geschlecht und Depression
- Geschlecht und Gehirn
- Zusammenspiel zwischen Gehirnentwicklung und sozialem Verhalten
- Rotationstest Mann-Frau
- Geschlecht und mentale Erregung
- Frauen und Männer denken unterschiedlich oft an Sex
- Geschlecht und Hormone
- Geschlecht und Intelligenz
- Die Male Idiot Theory
- Geschlecht und Kunst
- Geschlecht und Karriere
- Weibliche Führungskräfte
- Geschlechtsrollenkonflikte
- Geschlecht und Körper
- Geschlecht und Sucht
- Geschlecht und Kommunikation
- Geschlecht-Schlaf
- Geschlecht-Schule-Leistung
- Geschlecht: Social-Media
- Spam: Unterschied im Umgang von Mann und Frau
- Geschlecht und Orientierungssinn
- Geschlecht-Stereotype
- Geschlecht: Kurioses aus der Geschlechterforschung
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::