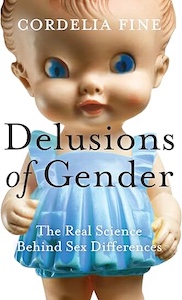Geschlecht und Körper
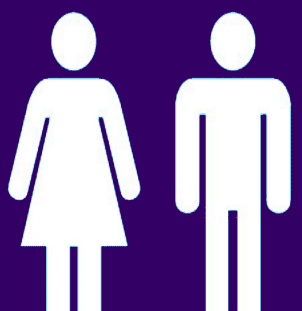
Lebenserwartung
Bei der Lebenserwartung gibt es einerseits von Natur aus einen weiblichen Vorsprung, andererseits spielen aber soziale Faktoren eine wichtige Nebenrolle. Einiges deutet darauf hin, dass Frauen selbst bei identischer Lebensführung immer etwas länger leben werden als Männer, denn zum einen werden Frauen in relativ homogenen Gemeinschaften wie etwa im Kloster ebenfalls älter, andererseits sterben selbst bei Neugeborenen mehr männliche Babys, wobei Unterschiede im Verhalten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam sein dürften. Zarulli et al. (2017) haben den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Lebenserwartung anhand von historischen Daten zu Krisensituationen in verschiedenen Populationen untersucht, u. a. an Sklaven auf Trinidad im 19. Jahrhundert, befreiten Sklaven, die zwischen 1820 und 1843 nach Liberia zurückkehrten, von Hungersnot in der Ukraine im Jahr 1933, von Masernepidemien in Island im 19. Jahrhundert und von der Hungersnot in Irland (1845 bis 1849) infolge der Kartoffelfäule. Tatsächlich lebten die Frauen in allen Populationen auch in Krisenzeiten durchschnittlich länger, wenngleich die Lebenserwartung insgesamt deutlich zurückging und der Vorsprung der Frauen im Vergleich zu vor und nach der Krise nicht mehr ganz so hoch war. Nur bei den Sklaven auf Trinidad war die Sterblichkeit bei Frauen in jungen Jahren etwas höher, was daran liegen könnte, dass junge männliche Sklaven für ihre Besitzer besonders viel wert waren, also hat man auch in ihr Überleben mehr investiert. Die Kinder- bzw. Säuglingssterblichkeit hatte in allen Datensätzen den größten Einfluss auf die Geschlechterunterschiede, denn weibliche Babys überlebten die Notlage fast überall deutlich häufiger als ihre männlichen Altersgenossen. Für den biologischen Vorteil von Frauen vermutet man, dass sie das zweite X-Chromosom länger leben lässt, doch auch hormonelle Unterschiede könnten eine Rolle spielen, denn das weibliche Geschlechtshormon Östrogen stärkt die Immunabwehr, während Testosteron diese eher schwächt. Ein wensentlicher Teil der höheren Lebenserwartung ist den Lebensumständen geschuldet, denn so leben Frauen in armen Ländern nicht um so viel länger als Männer, da dort die Müttersterblichkeit sehr hoch ist. Am größten ist der Abstand zwischen den Geschlechtern aktuell in reichen westlichen Industrienationen, der erst in den letzten Jahrzehnten langsam wieder kleiner wird, da sich die Geschlechter bei ihrer Lebensführung immer ähnlicher werden.
Wissenschaftler haben über 30 Jahre Männer und Frauen befragt, wie sie ihre Gesundheit einschätzen, und wiesen dabei nach, dass das Sterberisiko bei der Einschätzung von „sehr gut“ über „gut“, „es geht“ „schlecht“ bis „sehr schlecht“ kontinuierlich ansteigt. Männer, die „sehr schlecht“ antworteten, hatten ein über 3,3-fach höheres Sterberisiko gegenüber gleichaltrigen Männern mit „sehr guter“ Bewertung, und auch bei Frauen liegt der Faktor noch bei 1,9. Daraus ergibt sich, dass das Risiko von optimistischen zu pessimistischen Einschätzungen kontinuierlich zunimmt, denn schon Menschen mit „guter“ Gesundheit hatten weniger günstige Überlebenschancen als die mit „sehr guter“. Bemerkenswert daran ist, dass nur die Selbsteinschätzung abgefragt wurde, also die eigene Wahrnehmung, und tatsächliche Krankheiten, Rauchen oder Medikamente keinen Einfluss auf die Bewertung hatten. Offenbar besitzen Menschen, die ihre Gesundheit als sehr gut einschätzen, auch Eigenschaften wie Optimismus oder Zufriedenheit, die eine Gesundheitsressource darstellen und zu anderem Verhalten führen.
Literatur
Bürgel, I. (2019). Das 3:1-Prinzip - das ist die Formel für ein glückliches Leben. Online Focus vom 23. Dezember.
http://science.orf.at/stories/2888277/ (18-01-10)
Gesundheitsbewusstsein und Geschlecht
Männer zwischen 40 und 80 Jahren überschätzen nach einer Umfrage in sechs europäischen Ländern und den USA ihren gesundheitlichen Zustand oft, denn sie glaubten zu rund 85 Prozent, sie seien gesund, während die Krankenakten anderes aussagten. Während Frauen eher gewohnt sind, auf die eigene Gesundheit und die der Familie zu achten, ignorierten Männer Schmerzen häufiger und sind daher anfällig für Herzinfarkte und Schlaganfälle, denen häufig Antriebslosigkeit und Müdigkeit vorausgingen.
Quelle: http://www.welt.de/die-welt/wissen/article7462958/Der-Anti-Hypochonder.html (10-05-05)
Frauen essen anders, aber Männer auch
Männer essen mehr Fleisch, aber weniger Gemüse als Frauen, wobei die Ursachen dafür weniger biologischer, als vielmehr kulturell-gesellschaftlicher Natur sind, weil Fleisch traditionell als kräftigende Männernahrung gilt und Gemüse mit Mutter Erde verbunden und damit weiblich besetzt ist. Eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam resümiert: „Gutes Essen hebt die Stimmung bei Männern mehr als bei Frauen.“ Doch das hat nichts mit Genussfähigkeit zu tun, sondern damit, dass Männer gutes Essen als Belohnung für hartes Arbeiten empfinden. Männer sind auch Schlinger, denn sie nehmen laut einer Studie der US-amerikanischen Ernährungswissenschaftlerin Kathleen Melanson bei einer Mahlzeit pro Minute rund 80 Kilokalorien zu sich, Frauen doch nur 52. Diäten sind Frauensache, denn 70 Prozent der 16- bis 44-jährigen Frauen wollen laut Umfragen aktuell abspecken, während es bei den Männern nur 48 Prozent sind, obwohl sie deutlich öfter unter behandlungsbedürftigem Übergewicht leiden.
Quelle: https://www.schwaebische.de/ueberregional/panorama_artikel,-persoenlichkeit-und-essverhalten-du-bist-was-du-isst-_arid,11251960.html (20-08-02)
Temperaturempfinden unterschiedlich
Im Hypothalamus befindet sich in einem etwa nussgroßen Areal eine Art körpereigenes Thermometer, das die Kerntemperatur misst und entscheidet, ab wann man zu zittern beginnen soll. Der Sollwert des Menschen beträgt um die 37 Grad, wobei die Toleranz gering ist, denn zwischen 36,5 und 37,5 Grad liegt die "Wohlfühlzone", innerhalb derer sich Menschen gut fühlen. Allerdings gibt es von der Klimazone abhängige Schwankungen zwischen den Kulturkreisen, denn australische Ureinwohner frieren erst, wenn sich ihr Körper deutlich unter 37 Grad abkühlt. Verlässt die Temperatur den Wohlfühlbereich nach oben oder unten, beginnen Menschen entweder zu schwitzen oder zu zittern, wobei dieser Prozess bei Frauen und Männern zwar gleich abläuft, aber Frauen den kleinen Vorteil haben, dass durch ihre durchschnittlich etwas dickere Fettschicht ihr Körper besser isoliert ist. Dennoch frieren Männer in der Regel weniger, denn ihre im Durchschnitt größere Muskelmasse isoliert zwar nicht so gut wie Fett, produziert aber auch im Ruhezustand Wärme. Dicke frieren übrigens generell weniger, denn je kleiner die Körperoberfläche im Verhältnis zum Volumen ist, desto weniger Wärme verliert der Körper. Der optimale Körper gegen die Kälte wäre daher eine Kugel ;-)
In einem Experiment (Chang & Kajackaite, 2019) wurden Unterschiede im Einfluss der Temperatur auf die kognitive Leistungsfähigkeit in Bezug auf das Geschlecht untersucht, wobei die Leistungen bei mathematischen, verbalen und kognitiven Reflexionsaufgaben gemessen wurden. Dabei zeigte sich, dass die Auswirkungen der Temperatur zwischen Männern und Frauen stark variierten. Die Wohlfühltemperatur von Frauen liegt im Schnitt drei Grad Celsius über der von Männern. Bei höheren Temperaturen leisten Frauen bei einer mathematischen und verbalen Aufgabe mehr, während bei Männern der umgekehrte Effekt beobachtet wurde. Die Zunahme der weiblichen Leistung als Reaktion auf eine höhere Temperatur war dabei deutlich größer als die entsprechende Abnahme der männlichen Leistung. Im Gegensatz zu mathematischen und verbalen Aufgaben hat die Temperatur keinen Einfluss auf die kognitive Reflexion für beide Geschlechter. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass geschlechtsspezifische Mischarbeitsplätze in der Lage sein könnten, die Produktivität zu steigern, indem sie den Thermostat höher stellen.
Literatur
Chang, T. Y. & Kajackaite, A. (2019). Battle for the thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance. PLoS ONE, 14, doi:10.1371/journal.pone.0216362.
http://www.ksta.de/html/artikel/1292517911013.shtml (10-12-20)
Geschlechtsunterschiede beim Händewaschen
In einer Untersuchung von Frank Musolesi (SRH Hochschule Heidelberg) schauten zehn Psychologie-Studierende einen Monat lang insgesamt tausend Besuchern öffentlicher Toiletten in und um Heidelberg auf die Finger. Während elf Prozent der beobachteten Männer ganz auf die Reinigung verzichteten, waren es bei den Frauen drei Prozent. Mit Wasser und Seife rückten immerhin 82 Prozent der Frauen den Keimen auf den Leib, bei den Männern waren es 51 Prozent. Die Studierenden der Fakultät für Angewandte Psychologie standen so unauffällig wie möglich in den Waschräumen von Fast-Food-Restaurants und Raststätten sowie im Bahnhof und in der Mensa.
Die Männer beteuern immer, sie lieben die innere Schönheit der Frau –
komischerweise gucken sie aber ganz woanders hin.
Marlene Dietrich
Schönheit erhöht Reproduktionsrate stärker bei Frauen als bei Männern
Markus Jokela hat die Fotografien von 1244 Frauen und 997 Männern der Wisconsin-Longitudinalstudie analysiert. Diese Männer und Frauen wurden zwischen 1937 und 1940 geboren, wobei ihre Fotos im Alter rund um 18 angefertigt worden waren. Bei den Frauen gab es einen positiven Zusammenhang zwischen der den Personen zugeschriebenen Attraktivität und der Reproduktionsrate, d.h., Frauen, die auf den Fotos als überdurchschnittlich schön beurteilt wurden, bekamen signifikant mehr Kinder als weniger gut aussehende Frauen. Die besonders schönen hatten sechs Prozent mehr Nachwuchs und die zweitschönsten um 16 Prozent mehr als die weniger attraktiven. Bei den Männern hatten nur die besonders unattraktiven weniger Kinder, und zwar um 13 Prozent als der Rest, ansonsten unterschieden sich die Männer nicht in ihrem reproduktiven Erfolg. Für diesen Zusammenhang von Attraktivität und Fruchtbarkeit gibt es mehrere Erklärungen: Attraktivität könnte mit einem stärkeren Kinderwunsch in Beziehung stehen. Sie könnte aber auch die Kriterien der Partnerwahl verändern oder die Zuschreibung beeinflussen, ob jemand als potenzieller Vater oder potenzielle Mutter erachtet wird.
Quelle: Klaus Taschwer (2009). DER STANDARD, Printausgabe, 30. 7. 2009.
Teilweise widerlegt wird das allerdings in einer Studie von Elizabeth McClintock, Soziologin an der University of Notre Dame, denn attraktive Frauen haben ihrer Studie zufolge weniger Sexualpartner als der Durchschnitt. Bei Männern ist es hingegen umgekehrt, denn bei ihnen erhöht gutes Aussehen die Zahl der Partnerinnen. Sehr gutaussehende Frauen nutzen demnach ihr Äußeres, um die Kontrolle über den Fortgang der Beziehung zu erhalten, bevorzugen Langzeitbeziehungen und bestimmen zu Beginn den Grad der Verbindlichkeit. So lassen sie etwa Sex in der ersten Woche seltener zu als der Durchschnitt.
Quelle: OÖN vom 12. Februar 2013
Versluys et al. (2018) vermaßen für ihre Studie neuntausend amerikanische Rekruten und erstellten auf Basis der Daten Bilderserien von männlichen Modellen her, die im Hinblick auf drei Proportionen variiert wurden: Zum Ersten erstellte man Silhouetten von Männern, deren Armpaare in Relation zum übrigen Körper verschieden lang waren, zum Zweiten wurden die Beinpaare länger oder kürzer dargestellt, und zum Dritten variierte man das Verhältnis von Ober- und Unterarm bzw. Ober- und Unterschenkel. Diese Silhouetten wurden drei Gruppen heterosexueller Probandinnnen gezeigt. Während den Frauen die relative Armlänge völlig und das Längenverhältnis von Ober- und Unterarm bzw. Ober- und Unterschenkel ziemlich egal war, kam es sehr wohl auf die Beinlänge an, wie auch schon frühere Studien vermuten ließen, d. h., bei einem Mann attraktiv sind durchschnittliche oder etwas längere Beine. Vermutlich werden kurze Beine mit Krankheiten wie Typ-zwei-Diabetes, Herzerkrankungen und Demenz assoziiert, während lange Beine ebenfalls mit Dispositionen mit bestimmten genetischen Erkrankungen verknüpft sind. Normal lange Beine hingegen würden am ehesten einen gesunden und fitten Partner versprechen.
Quelle: https://www.derstandard.de/story/2000080012383/was-maennerkoerper-attraktiv-macht (18-05-20)
Literatur: Versluys, Thomas M. M., Foley, Robert A. & Skylark, William J. (2018). The influence of leg-to-body ratio, arm-to-body ratio and intra-limb ratio on male human attractiveness, Royal Society Open Science, 5, dos:10.1098/rsos.171790.
Wenn eitle Frauen nicht länger mit Jugend kokettieren können, so geschieht es mit Alter.
Dorothea Schlegel
Wenn man einen Mann zu irgendeiner Arbeit bewegen will, muss man ihn nur fragen, ob er nicht zu alt dafür ist.
Cindy Crawford
Eitelkeit
Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins Baby und Familie, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei etwa eintausend Frauen und eintausend Männern ab vierzehn Jahren zeigte, dass Frauen bis ins hohe Alter eitel bleiben, Männer hingegen nicht. Dass Frauen ab einem gewissen Alter das Aussehen “vermutlich völlig egal sein wird”, kann sich von den weiblichen Befragten nicht einmal ein Drittel (29,9 Prozent), bei ihren männlichen Kollegen aber fast die Hälfte (47,7 Prozent) vorstellen. Dabei ist es für Männer offensichtlich deutlich leichter, in fortgeschrittenen Jahren den Schönheitsidealen zu entsprechen, denn Männer wirken mit zunehmendem Alter attraktiver, während Frauen an Anziehungskraft verlieren.
Frauen können besser riechen als Männer
Frauen verfügen über etwa fünfzig Prozent mehr Nervenzellen - Riechkolben - in der Nase als Männer, wobei Riechkolben jene Strukturen des vorderen Gehirns darstellen, die Geruchssignale von der Riechschleimhaut in die Hirnteile weiterleiten. Der Riechkolben ist die erste Stelle der Geruchsrepräsentation im Gehirn von Säugetieren, und ihre einzigartige Struktur gilt als notwendiges Substrat für die raumzeitliche Geruchskodierung. Weiss et al. (2019) haben entdeckt, dass auch Menschen ohne diese Struktur an der vorderen Basis des Gehirns riechen können, d. h., sie erkennen und unterscheiden Gerüche ebenso gut wie andere Menschen. Rätselhaft ist nur, warum dieses Phänomen besonders beim weiblichen Geschlecht und vor allem unter Linkshänderinnen verbreitet zu sein scheint. Vermutlich wird bei Menschen, die ohne Riechkolben geboren wurden, die Geruchsinformation in einem anderen Areal des Gehirns repräsentiert.
Literatur
Oliveira-Pinto A. V., Santos R. M., Coutinho R. A.,
Oliveira L. M., Santos G. B., et al. (2014). Sexual Dimorphism in the
Human Olfactory Bulb: Females Have More Neurons and Glial Cells than
Males. PLoS ONE 9(11): e111733. doi:10.1371/journal.pone.0111733.
WWW: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111733 (14-11-11)
Weiss, T., Soroka, T., Gorodisky, L., Shushan, S., Snitz, K.,
Weissgross, R., Furman-Haran, E., Dhollander, T. & Sobel, N. (2019).
Human Olfaction without Apparent Olfactory Bulbs. Neuron,
doi:10.1016/j.neuron.2019.10.006.
Unterschiedliches Verhalten bei Diät
Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung berichtet geschlechtsspezifische Unterschiede bei Diäten: Vor allem bei Frauen verändert sich mit der Zunahme des Gewichts auch die verhaltenssteuernde Hirnregion, d. h., in Verhaltensexperimenten neigen übergewichtige im Vergleich zu normalgewichtigen Frauen eher dazu, kurzfristige Belohnungen zu wählen, auch wenn negative Konsequenzen folgen. In Verhaltensexperimenten der Abteilung Neurologie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zeigte sich, dass Frauen mit Übergewicht sich anders als Normalgewichtige ein Stück Schokolade auch dann nicht verkneifen können, wenn sie wissen, dass es ihrer Figur schadet, während bei Männern dieser Unterschied nicht zu beobachten war. Daher fällt es übergewichtigen Frauen schwerer als Männern, Gewicht zu verlieren. Größenunterschiede in den entsprechenden Gehirnarealen lassen vermuten, dass Frauen eine erhöhte Willenskraft aufbringen müssen, um Diäten erfolgreich einzuhalten. Der Erfolg einer Diät hängt also nicht nur von der eigenen Disziplin ab, sondern auch die Struktur bestimmter Hirnregionen spielt somit eine wichtige Rolle. Hirnareale, die bei der automatischen und zielgerichteten Verhaltenskontrolle eine Rolle spielen, verändern sich bei ihnen schneller.
Literatur
Die Welt vom 16. Feb. 2013
Veränderungen im Gehirn verhindern den Erfolg von Diäten. Deutsche Gesundheits Nachrichten vom 22. Februar 2013.
Virginia Zarulli, Julia A. Barthold Jones, Anna Oksuzyan, Rune Lindahl-Jacobsen, Kaare Christensen, & James W. Vaupel (2018). Women live longer than men even during severe famines and epidemics. PNAS, doi:10.1073/pnas.1701535115.
Hören Sie hinein in die neueste Folge unseres Podcasts:
Empfehlen Sie unsere Podcasts weiter!
Überblick Arbeitsblätter "Geschlechtsunterschiede ;-)"
- Psychologie der Geschlechtsunterschiede
- Geschlecht: Emotion und Aggression
- Geschlecht und Beziehung
- Geschlecht und Depression
- Geschlecht und Gehirn
- Zusammenspiel zwischen Gehirnentwicklung und sozialem Verhalten
- Rotationstest Mann-Frau
- Geschlecht und mentale Erregung
- Frauen und Männer denken unterschiedlich oft an Sex
- Geschlecht und Hormone
- Geschlecht und Intelligenz
- Die Male Idiot Theory
- Geschlecht und Kunst
- Geschlecht und Karriere
- Weibliche Führungskräfte
- Geschlechtsrollenkonflikte
- Geschlecht und Körper
- Geschlecht und Sucht
- Geschlecht und Kommunikation
- Geschlecht-Schlaf
- Geschlecht-Schule-Leistung
- Geschlecht: Social-Media
- Spam: Unterschied im Umgang von Mann und Frau
- Geschlecht und Orientierungssinn
- Geschlecht-Stereotype
- Geschlecht: Kurioses aus der Geschlechterforschung
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::