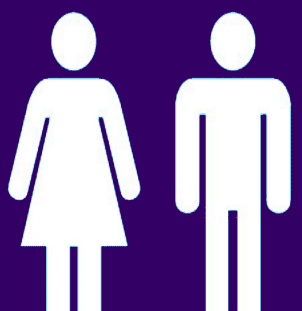
Frauen lernen schnell und Männer glauben, sie wissen schon alles.
Der Mensch gliedert sich in zwei Teile:
Einen Weiblichen, der nicht denken kann,
und einen Männlichen, der nicht denken will.
Kurt Tucholsky
Frauen geben Fehler leichter zu als Männer. Deshalb sieht es so aus, als machten sie mehr.
Gina Lollobrigida
Ein Mann erwartet von einer Frau, dass sie perfekt ist und dass sie es liebenswert findet, wenn er es nicht ist.
Catherine Zeta-Jones
Literatur
Kasten, H. (2003). Weiblich - Männlich. Geschlechterrollen durchschauen. München: Reinhardt.
Rustemeyer, R. & Thrien, S. (2001). Das Erleben von Geschlechtsrollenkonflikten in
geschlechtstypisierten Berufen. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 45, 1, 34-39
Geschlechtsunterschiede ;-)
Die angeblich natürlichen, also biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind einerseits ein echter Klassiker unter den Stereotypen, andererseits ist es sehr zeitgenössisch, ausführlich die Unterschiede der Gehirne der verschiedenen Geschlechter zu beleuchten. Buchtitel wie "Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken" werden gerne zu Bestsellern. Es ist sehr in Mode, geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede mit den neurologisch unterschiedlichen Hirnen zu begründen, sehr oft verbunden mit evolutionsbiologischen Argumenten. Frauen sind demnach emotionaler, weil ihr Körper ihnen das diktiert, aus dem gleichen Grund denken Männer stärker abstrakt. Der berühmte Satz von Simone de Beauvoir: "Man wird nicht als Frau geboren, man wird es", gilt vielen nichts mehr. Da ist der Weg wieder kurz zu den Argumenten über den "physiologischen Schwachsinn des Weibes" (Naica-Loebell 2008).
Frauen sind weniger suchtgefährdet, begehen seltener Selbstmord, ertragen Schmerzen und Stress besser und bringen in der Schule im Durchschnitt bessere Leistungen als Männer. Nach den Erkenntnissen der Genforschung sind sie auch noch klüger und üben auf Grund des X-Chromosoms, das vor allem für intelligente Leistungen zuständig ist, starken Einfluss auf die Intelligenzentwicklung aus, denn Frauen verfügen über zwei X-Chromosomen, sodass Defekte bei Männern oft schwerwiegendere Auswirkungen haben als bei Frauen. So ist etwa die geistige Minderbegabung bei Männern häufiger als bei Frauen anzutreffen, allerdings findet man unter Männern nach einer Studie an der Universität Edinburgh auch mehr Hochbegabte, denn unter den intelligentesten zwei Prozent der Bevölkerung gibt es doppelt so viele Männer wie Frauen. Allerdings sind die Männer auch in der Gruppe mit geringer Intelligenz besonders stark vertreten. Die Hochintelligenz bei Männern ist für manche Forscher ein wichtigen Bestandteil der menschlichen Evolution, denn mit einer überragenden Intelligenz gelingt es nicht nur, für viele Frauen attraktiver zu sein und mit ihnen Nachkommen zu zeugen, sondern sie ist auch im täglichen Existenzkampf förderlich. Die Entwicklung der Intelligenz der Menschheit ist demnach vorwiegend den Wünschen und Erwartungen der Frauen zu verdanken. Bei der Intelligenzvererbung spielt der Mann ebenfalls eine untergeordnete Rolle, denn ein Vater gibt seine Intelligenz nur an seine Tochter weiter, nicht aber an seinen Sohn. Der Sohn bekommt nur die Intelligenzgene auf dem X-Chromosom von seiner Mutter.
Der Mensch ist mehr als ein Säugetier, aber Säugetier ist er fundamental auch und zu allererst. Es gibt daher ein weibliches und ein männliches Gehirn, denn das Säugetier Mensch existiert in der Regel als Mann und Frau, die sich in vielen Aspekten deutlich voneinander unterscheiden, die vor jeder Sozialisation liegen und es ist durch keine Sozialisation bisher gelungen, diese basalen Unterschiede aufzuheben. Insgesamt betrachtet nutzen Frauen ihr Gehirn anders als Männer, wie viele Untersuchungen zu Wahrnehmung, Orientierung und Koordination zeigen. Das Sehfeld ist bei Frauen größer, Männer sehen dafür schärfer, Frauen können einzelne Finger gezielter bewegen, Männer werfen und fangen dafür besser. Bei der Wegsuche verlassen sich Männer häufiger auf ihre Fähigkeiten, Richtungen und Entfernungen besser abzuschätzen, während sich Frauen an charakteristischen Objekten orientieren. Frauen nutzen ihr Gehirn jedoch nicht so einseitig wie Männer und können deshalb in vielen Bereichen Funktionsstörungen besser kompensieren. Allerdings spiegeln sich in vielen Forschungsergebnissen nicht nur die Erbanlagen sondern auch Umwelteinflüsse. In allen Kulturen und zu allen Zeiten gab es zahlreiche Vorstellungen über die Unterschiede der Geschlechter, wobei lange die Idee von einer natürlichen biologischen Verschiedenheit dominierte, die gesellschaftlich zur Formulierung einer spezifisch weiblichen und männlichen Identität führte. Aktuell werden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowohl als Ergebnis der Geschichte als auch der Sozialisation interpretiert. Auch wenn es auf Grund der immer wieder postulierten Gleichberechtigung der Geschlechter als progressiv und politisch korrekt gilt, darauf zu bestehen, die beiden Geschlechter seien in ihren kognitiven Fähigkeiten nur minimal verschieden und das auch nur auf Grund unterschiedlicher Erfahrungen während der kindlichen Entwicklung, legt dennoch die Mehrzahl der aktuell vorliegenden wissenschaftlichen Befunde nahe, dass etwa der Feinaufbau des Gehirns schon sehr früh von Sexualhormonen beeinflusst wird, so dass die Umwelt von Geburt an und auch schon davor bei Mädchen und Buben auf schon grundlegend unterschiedlich verschaltete Gehirne einwirkt, sodass es später nahezu unmöglich wird, in der Entwicklung Erfahrungseinflüsse getrennt von der physiologischen Disposition zu erfassen.
Überblick Arbeitsblätter "Geschlechtsunterschiede ;-)"
- Psychologie der Geschlechtsunterschiede
- Geschlecht: Emotion und Aggression
- Geschlecht und Beziehung
- Geschlecht und Depression
- Geschlecht und Gehirn
- Zusammenspiel zwischen Gehirnentwicklung und sozialem Verhalten
- Rotationstest Mann-Frau
- Geschlecht und mentale Erregung
- Frauen und Männer denken unterschiedlich oft an Sex
- Geschlecht und Hormone
- Geschlecht und Intelligenz
- Die Male Idiot Theory
- Geschlecht und Kunst
- Geschlecht und Karriere
- Weibliche Führungskräfte
- Geschlechtsrollenkonflikte
- Geschlecht und Körper
- Geschlecht und Sucht
- Geschlecht und Kommunikation
- Geschlecht-Schlaf
- Geschlecht-Schule-Leistung
- Geschlecht: Social-Media
- Spam: Unterschied im Umgang von Mann und Frau
- Geschlecht und Orientierungssinn
- Geschlecht-Stereotype
- Geschlecht: Kurioses aus der Geschlechterforschung
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
Die englische Sprache bietet dabei eine Differenzierung von Geschlecht an: "gender" als soziales und "sex" als biologisches Geschlecht. "Sex" wird durch Anatomie, Physiologie und Hormone determiniert, während "gender" den erworbenen Status bzw. sozial und kulturell geprägte Geschlechtscharaktere meint, die durch Sozialisationsprozesse angeeignet werden. Zunehmend wird das Geschlecht auch nicht mehr nur als körperlicher oder sozialer Zustand sondern als Prozess von Geschlechtsidentität und Geschlechterbeziehungen gesehen. Geschlecht ist demnach keine fixe Rolle, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt, ein Produkt sozialen Handelns, das eine soziale Reproduktion von Regeln und Strukturen beinhaltet.Geschlechtsrollenkonflikte findet man auch bei typischen Frauen- und Männerberufen, wobei der Geschlechtsrollenkonflikt zwei Aspekte beinhaltet: Die Diskrepanz zwischen der erwünschten und der tatsächlich erlebten Behandlung durch andere, und die Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und den von außen gestellten Erwartungen. Negative Folgen erhöhter Geschlechtsrollenkonflikte können sich im Beruf mit Unzufriedenheit, Neigung zum Berufswechsel oder Abwesenheit vom Arbeitsplatz zeigen. Im familiären Bereich resultieren Geschlechtsrollenkonflikte eher in Depressivität. Niedriges Geschlechtsrollenkonflikte-Erleben hat im Gegensatz dazu emotionale und körperliche Gesundheit zur Folge. Grundsätzlich haben Frauen ein stärkeres Geschlechtsrollenkonflikte-Empfinden als Männer. (vgl. Rustemeier & Thrien, 2001, S. 34-35). Man unterscheidet in der Forschung zwischen biologischem Geschlecht (engl. sex) und sozialem Geschlecht (engl. gender). Bei Personen, bei denen diese beiden Geschlechter stark differieren kommt es vermehrt zu Geschlechtsrollenkonflikten. Unterschiedliche Berufe können unterschiedliche geschlechtstypische Images aufweisen. Dieses Image hängt einerseits vom Frauen- bzw. Männeranteil des Berufs, andererseits von den mit dem Beruf assoziierten männlichen oder weiblichen Eigenschaften ab. Die Maskulinität eines Berufes ist immer noch stark mit seiner Entlohnung und seinem Prestige verbunden (vgl. Rustemeier & Thrien, 2001, S. 35). Die einfachste Art der Passung wäre die Übereinstimmung mit dem biologischen Geschlecht. Es spielen aber auch die besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften die eine Person hat eine Rolle. Bei zu großen Unterschieden zwischen Berufsimage und Eigenschaften der ausführenden Person wirkt sich das meist negativ aus. Generell sind Frauen und Männer eigentlich gleich erfolgreich, nur eben in verschiedenen Berufen. Eben Frauen in Frauenberufen und Männer in Männerberufen. Frauen haben allerdings den Nachteil das typische Männerberufe immernoch besser bezahlt sind. Die Passung wirkt sich stark auf das Geschlechtsrollenkonflikte-Empfinden der Personen aus. Bei schlechter Passung ist das Empfinden hoch, sonst vergleichsweise niedrig (vgl. Rustemeier & Thrien, 2001, S. 35-36).
Janet Hyde (University of Wisconsin) analysierte zahlreiche verfügbare Daten zu Geschlechtsunterschieden in einer Metaanalyse und fand eine Liste von 124 untersuchten Eigenschaften. Angefangen vom Ins-Wort-Fallen über die sexuelle Erregbarkeit bis hin zum abstrakten Denken scheinen sich Männer und Frauen tatsächlich signifikant zu unterscheiden. Für die Bewertung mindestens ebenso wichtig ist aber die Effektstärke, also jenes statistische Maß, das die Differenz zwischen den zwei Mittelwerten mit der Variabilität innerhalb der beiden Gruppen mitberücksichtigt. Dabei erwiesen sich aber etwa 80 Prozent der gefundenen Geschlechtsunterschiede als so klein, dass ihnen kaum praktische Relevanz zukommt, denn die Ähnlichkeiten zwischen den Geschlechtern sind in fast allen Bereichen sehr viel größer als die Unterschiede.
Übrigens: der Fachbegriff für biologisch bedingte Geschlechtsunterschiede lautet Geschlechtsdimorphismus, der besagt, dass der Körper von Männchen und Weibchen einer Tierart in Form Färbung und/oder Größe unterschiedlich ausgeprägt ist. Beispiele findet man bei vielen Fischen, Vögeln und Säugetieren. Geschlechtsdimorphismus entsteht durch natürliche Auslese, denn bei Tieren mit Geschlechtsdimorphismus werden etwa die prächtigsten Männchen bzw. Weibchen bevorzugt. Manche Tierarten zeigen den Geschlechtsdimorphismus nur zur Paarungszeit. Vor allem bei den Primaten kann man anhand des Geschlechtsdimorphismus in Form des Größenunterschiedes zwischen den Geschlechtern auf das Gruppenverhalten schließen. Bei extremem Größenunterschied findet man meist ein Zusammenleben in Haremsform, d. h. ein großes erfahrenes männliches Tier und mehrere weibliche bilden eine Gruppe wie etwa bei den Gorillas. Bei gering ausgeprägtem Größenunterschied herrscht meist eine Zweierbeziehung vor, die aber nicht unbedingt eine lebenslange Monogamie bedeuten muss, sondern oft auch nur während der Paarungszeit anzutreffen ist. Ein Beispiel dafür ist das soziale Gruppenverhalten der Schimpansen, der Bonobos und auch des Menschen.
Psychologische Theorien zur Entstehung der Geschlechtsunterschiede
Es gibt verschiedene psychologische Theorieansätze, die zu erklären versuchen, warum Buben und Mädchen schon im Kindergarten unterschiedliche Verhaltensrepertoires, Interessen und Beschäftigungsvorlieben haben, wobei das Schwergewicht dabei auf der Entwicklung in der Kindheit und der Rolle der Eltern bei der Geschlechtsrollenentwicklung liegt. Die Bekräftigungstheorie postuliert, dass Buben und Mädchen schon ab dem Kleinkindalter für Verhalten, dass ihrem Geschlecht angemessen erscheint, belohnt werden, was durch Lob, Anerkennung und direkte Belohnung erfolgt, während ihrem Geschlecht unangemessene Verhaltensweisen nicht verstärkt, sondern sogar manchmal sogar bestraft, missbilligt oder einfach ignoriert werden. Die Bekräftigungstheorie basiert also darauf, dass bestimmte dem Geschlecht entsprechende Verhaltensstereotype existieren und Eltern ihre Kinder diesen Stereotypen gemäß erziehen, d.h., dass Eltern ihre Kinder unterschiedlich behandeln. Die Imitationstheorie postuliert, dass Kinder geschlechtstypisches Verhalten durch die Beobachtung gleichgeschlechtlicher Modelle bzw. die Nachahmung und Übernahme deren geschlechtsangemessenen Verhaltens erwerben. Dabei sind vor allem die Bezugspersonen im Hinblick auf erfolgreiches oder erfolgloses Verhalten ihre Vorbilder, d.h., nachgeahmt wird vorwiegend erfolgreiches Modellverhalten überwiegend am gleichgeschlechtlichen Vorbild. Die der Imitationstheorie nahe Identifikationstheorie nimmt an, dass durch die Primärbeziehungen geschlechtsspezifisches Verhalten gefördert bzw. erlernt wird, also durch die Beziehungen zu den wichtigsten Bezugspersonen gemeint, mit denen sich in den ersten Lebensjahren eine intensive gefühlsmäßige Beziehung und Bindung entwickelt hat, wodurch sich ein Kind mit dieser Person identifiziert, also Mädchen mit der Mutter und Buben sich mit dem Vater identifizieren, da Buben und Mädchen sich innerlich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil als ähnlich oder gar identisch erleben, wodurch auch Einstellungen, Werthaltungen und äußere Verhaltensweisen übernommen werden. Die kognitive Theorie knüpft an die allgemeine Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget an, wonach sich die geistige Entwicklung des Menschen von innen heraus und in mehreren Stadien vollzieht. Das sich aktiv mit seiner physikalischen und sozialen Umwelt auseinandersetzende Kind erwirbt demnach Wissen und ein immer differenzierteres Urteilsvermögen auch über geschlechtsbezogene Merkmale und Inhalte, die für seine Kultur typisch sind, wodurch ein Kind sich selbst und andere Personen dem weiblichen oder männlichen Geschlecht eindeutig zuzuordnet. Während in der früheren Kindheit diese Zuordnung vor allem durch äußere Merkmale wie Frisur, Kleidung oder Körperbau erfolgt, kommen später Verhaltensweisen, Beschäftigungsvorlieben oder Einstellungen und Haltungen hinzu. In der psychoanalytischen Theorie der Geschlechtsrollenentwicklung ist der anatomische Unterschied zwischen Buben und Mädchen ausschlaggebend. Während Knaben einen Penis besitzen und Mädchen nicht, sodass sie sich als verstümmelt und minderwertig empfinden und das andere Geschlecht deshalb beneiden. Mädchen fühlen sich daher sich zum Vater hingezogen, um ihren kastrierten Zustand zu beenden, während Buben sich zur Mutter hingezogen fühlen und den Vater als Rivalen erleben. Diese auf das andere Geschlecht bezogenen Wünsche spielen sich unbewusst während der ödipalen Phase ab. Zu diesen psychologischen Theorien kommen biologische, kulturelle und soziologische Einflussfaktoren hinzu, die eine zusätzliche Rolle bei der Herausbildung geschlechtstypischen Verhaltens spielen.
Kaum Veränderung der Geschlechterstereotypen in den letzten 30 Jahren
In allen Kulturen gilt das Geschlecht als wichtige Kategorie für die soziale Differenzierung, mit ihr verbindet sich eine Vielzahl geschlechtsbezogener Erwartungen und Vorschriften. Kinder lernen schon sehr früh, welche Merkmale in ihrer Kultur als „männlich“ und welche als „weiblich“ angesehen werden, bzw. welches Verhalten vor diesem Hintergrund als abweichend gilt. Lawrence Kohlberg hat darauf hingewiesen, dass Kinder einen aktiven Beitrag bei der Interpretation ihrer Geschlechterrolle leisten, denn sobald sie die Unveränderbarkeit ihrer Geschlechtszugehörigkeit erkannt haben, streben sie danach, sich ihrem Geschlecht entsprechend zu verhalten. Während Kinder im jüngeren und mittleren Alter aufgrund ihres Entwicklungsstands recht starr Geschlechterstereotypen folgen, setzen sich Jugendliche eher kritischer mit solchen Normen auseinander.
Die Längsschnittstudie „Aida“ an über 3000 Berliner Jugendlichen zeigte, dass weibliche Jugendliche sind unzufriedener mit ihrem Äußeren sind, weil sie offenbar von dem zunehmenden Schönheitswahn der Erwachsenenwelt beeinflusst werden. Sie entwickeln weniger Ich-Stärke als männliche Jugendliche, das heißt, sie verfügen über ein weniger positives Selbstbild und eine geringere psychische Stabilität, auch ihr Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit und ihre Erfolgszuversicht sind im Schnitt geringer ausgeprägt. Obwohl sie in stärkerem Maße für die Gleichberechtigung von Frau und Mann in Familie und Beruf eintreten als die männlichen Jugendlichen, wählen sie in der großen Mehrheit geschlechterstereotype Berufe mit geringen Aufstiegschancen.
Die Pädagogin Renate Valtin hat in einer Studie LehrerInnen der Grundschule gebeten, Kinder im Alter von etwa zehn Jahren einen Text schreiben zu lassen zum Thema „Warum ich gern ein Mädchen/Junge bin“. Als Datenbasis liegen an die 100 Aufsätze aus dem Jahr 2010 sowie 181 Aufsätze aus dem Jahr 1980 vor, sodass Veränderungen in den 30 dazwischen liegenden Jahren untersucht werden können.
Dabei erwies sich die Annahme, die Kinder seien heute weit weniger von alten Stereotypen beeinflusst, als falsch. Im Gegenteil sind ihre Aussagen stark von Rollenklischees geprägt. Jungen empfinden sich bereits als das überlegene Geschlecht, das sich körperlich durch Stärke und Schnelligkeit, im technischen Bereich durch größere Geschicklichkeit und im sozialen Bereich durch Dominanz (Mut, Wildheit) auszeichnet. Jungen sind offenbar recht zufrieden mit ihrem Geschlecht, nur ganz selten finden sich kritische Äußerungen dazu. Stereotyp sind auch die Antworten der Mädchen, doch während sich in den Selbstbeschreibungen der Jungen von 1980 und 2010 kaum Unterschiede finden, ist das bei den Mädchen anders. Im Jahr 1980 waren ihre Äußerungen meist auf vier Bereiche gleichermaßen bezogen: praktische Fähigkeiten im Haushalt (25 Prozent), Attraktivität/Kleidung (22 Prozent), körperlich/sportliche Fähigkeiten und Spiele wie Gummitwist, Geräteturnen, mit Puppen spielen (20 Prozent) und soziales Verhalten/Fürsorglichkeit/Bravheit (20 Prozent). Im Jahr 2010 überwiegen hingegen die Äußerungen, die sich auf Schönheit und modische Attribute beziehen, während auf Hausarbeit bezogene Tätigkeiten 2010 nicht mehr genannt werden. Mädchen halten es heute also nicht mehr für so wichtig für ihre Rolle, angepasst zu sein und Fähigkeiten im Haushalt zu beherrschen, doch attraktiv zu sein hat für sie deutlich gewonnen.
Veränderungen zeigen sich auch darin, wie die Jungen die Mädchen wahrnehmen, denn von Jungen finden sich aktuell nur ganz selten positive Äußerungen über Mädchen bzw. im Jahr 2010 möchte nur ein Junge manchmal ein Mädchen sein. Gegenüber 1980 sind auch die Begründungen zahlreicher geworden, warum man kein Mädchen sein möchte. Die Jungen empfinden, dass sie zum bevorzugten Geschlecht gehören. denn sie unterliegen weniger Zwängen und haben größere Freiheiten. Die Mädchen allerdings haben heute wie vor 30 Jahren mehr Positives als Negatives über Jungen zu sagen, wobei etwa 20 Prozent der Mädchen schreiben, dass sie manchmal auch gern ein Junge wären, und verweisen dabei auf die größere Bewegungs- und Handlungsfreiheit von Jungen: Jungen dürfen Fußball spielen, auf Bäume klettern, sie dürfen mehr Blödsinn machen. Mädchen beneiden Jungen, auch wenn kritische Äußerungen zum Sozialverhalten der Jungen kommen.
Offensichtlich hat sich die Erwartung, dass sich nach 30 Jahren die Einstellungen bei Kindern in Richtung Gleichheit geändert hätten, nicht erfüllt, selbst wenn die schmale Datenbasis von nicht ganz 300 Aufsätzen nur vorsichtige Schlussfolgerungen erlaubt. Bedenklich ist vor allem, dass bei Mädchen die Attraktivität einen erheblich größeren Raum einnimmt, auch wenn dies von den Jungen dieser Altersstufe nicht einmal honoriert wird. Der Eindruck entsteht, dass die Gräben von Jungenseite aus tiefer geworden sind, da sie sich im Jahr 2010 stärker von Mädchen abgrenzen als 30 Jahre zuvor.
Weibliche Führungskräfte
In deutschen Unternehmen sind lediglich 30% der leitenden Positionen von Frauen besetzt, die auch im Vergleich mit Männern durchschnittlich um ein Drittel schlechter bezahlt werden, obwohl sich Frauen am Arbeitsplatz härter bewähren und besser beurteilt werden müssen, um befördert zu werden. Aufgrund dessen wurde bekanntlich eine Quotenregelung eingeführt, wobei diese in vielen Fällen auch Reaktanz bei beiden Geschlechtern provoziert. An einer Untersuchung von van Quaquebeke & Schmerling (2010) nahmen 50 weibliche und 27 männliche Studierende der Universität Hamburg und der Fachhochschule Wedel teil (Altersdurchschnitt 27 Jahre). Mittels Single Target Implicit Association Test (ST-IAT) wurde gemessen, wie stark Frau oder Mann mit Führung assoziiert sind. Die Assoziationsstärke ergibt sich aus der Zeit, die der Teilnehmer für die Erfüllung der Aufgabe benötigen. Die Probanden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei auf gleiche Geschlechterverteilung und gleiche Arbeitserfahrung geachtet wurde. Einer Gruppe wurden Bilder bekannter weiblicher Führungskräfte vorgelegt, der zweiten Gruppe wurden Bilder bekannter männlicher Führungskräfte vorgelegt. Es zeigte sich, dass die Assoziation „Mann und Führung“ stärker bestätigt wird, abe rdass sich das Assoziationsmuster von „Frau und Führung“ an das männliche Assoziationsmuster annähert. Die Wirksamkeit von Interventionen bei Frauen lässt darauf schließen, dass künftige Forschungen geschlechtsspezifisch betrachtet werden sollen. Um eine Veränderung des Assoziationsmusters zu erkennen sollte der Zeitraum der Untersuchung verlängert werden. Bestehende Stereotypen haben nach wie vor großen Einfluss auf den Karriereweg von Frauen aber auch Frauen selbst neigen dazu, die eigenen Leistungen zu unterschätzen. Weibliche Mitarbeiter sollten daher mehr gefördert werden und empfiehlt sich eine bessere Darstellung des Konzepts „Frauen und Führung“. (vgl. van Quaquebeke & Schmerling, 2010, S. 100f).
Literatur & Quellen
Van Quaquebeke, N. & Schmerling, A. (2010). Kognitive Gleichstellung. Wie bloße Abbildung bekannter weiblicher und männlicher Führungskräfte unser implizites Denken zu Führung beeinflusst. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 54, 91-104.
Valtin, Renate (2010). Geschlechterstereotypen „...weil ich im stehen Pinkeln kann“.
WWW: http://www.tagesspiegel.de/wissen/-weil-ich-im-stehen-pinkeln-kann/1971882.html10-11-02)
Friedrich Nietzsche
Entwicklung des Corpus Callosum durch Sexualhormone beeinflusst
Sind das männliche und weibliche Gehirn unterschiedlich aufgebaut? Wie wirken Hormone und Geschlecht zusammen? Gibt es geschlechtsspezifische kognitive Fähigkeiten? Sind Entwicklungsstörungen eine männliche Domäne? Sind nur Frauen essgestört? Welche Rolle spielen Geschlechtshormone bei der Multiplen Sklerose, bei Schizophrenie und Depression? Ist die Demenz bei Frauen und Männern das gleiche Problem?
Frauen schneiden für gewöhnlich in Tests besser ab, die den guten Umgang mit Sprache voraussetzen, und sie besitzen auch eine ausgeprägtere feinmotorische Koordination. Dagegen zeigen Männer Vorteile bei zielgerichteten motorischen Leistungen, wie dem Werfen und Auffangen von Gegenständen und bei Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen. Ihre Gehirne scheinen also teilweise anders zu funktionieren. Allerdings sind die 'Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Verhältnis zu den Schwankungen unter den Angehörigen desselben Geschlechts eher gering. Solche Unterschiede werden sehr früh angelegt, denn nach der Geburt bilden die rund 100 Milliarden Nervenzellen immer mehr Verknüpfungen. Sexualhormone beeinflussen dabei den Feinbau, die zu Unterschieden bei weiblichen und männlichen Gehirnen führen. Zum Beispiel besitzt der Balken, der die rechte und linke Gehirnhälfte miteinander verbindet (Corpus Callosum), bei Frauen am hinteren Ende eine Verdickung. Das weibliche Gehirn kann dadurch Informationen effektiver mit beiden Hälften verarbeiten als das männliche, wodurch Frauen bezüglich ihres Sprachvermögens nicht nur auf ihre linke Hemisphäre angewiesen sind, wie man es bei Männern vermutet. Da bei Frauen die Brücke zwischen den beiden Hirnhälften stärker ausgeprägt ist, ist die linke Hirnhälfte für analytisches Denken und Sprache stärker mit der rechten, in der Emotionen und Einfühlungsvermögen ihren Sitz haben, verbunden. Bei Männer sind demnach Logik und Gefühl weniger intensiv verknüpft als bei Frauen.
Bestätigt wird das dadurch, dass Frauen nach einem Schlaganfall, der die linke Gehirnhälfte stärker beeinträchtigt, sich schneller wieder mit der Sprache zurechtfinden als die meisten Männer.
Menstruelle Einflüsse auf Gehirnfunktionen
Die Funktionen unseres Gehirns werden auch während des späteren Lebens auf vielfältige Weise durch Sexualhormone beeinflusst. Die hormonellen Schwankungen beim Monatszyklus der Frau scheinen einen Einfluss auf das Gehirn zu haben, denn Tests, bei denen Frauen in den verschiedenen Phasen ihres Zyklus auf bestimmte Fähigkeiten untersucht wurden, zeigen, dass nach dem Eisprung das Gehirn der Frau unter dem Einfluss des Gelbkörperhormons "typisch weiblich" arbeitet, das heißt, beide Hirnhälften zeigen annähernd die gleiche Aktivität. Jetzt sind die sprachlichen Fähigkeiten, wie die Wortgewandtheit der Frau am größten. Zu Zeiten der Menstruation sinkt die Konzentration dieses Hormons ab und das weibliche Gehirn arbeitet ähnlich dem der Männer, indem ihr räumliches Wahrnehmungsvermögen größer ist.
Nach neueren Studien sind Frauen weniger vergesslich, wobei man vermutet, dass es vielleicht am weiblichen Sexualhormon Östrogen liegt, denn wenn der Östrogenspiegel während der Menopause bei Frauen absinkt, reduziert sich auch über einige Zeit deren durchschnittliche Gedächtnisleistung, reguliert sich aber der Östrogenhaushalt nach den Wechseljahren wieder, verbessert sich auch wieder das Erinnerungsvermögen.
Mentale und körperliche Erregung bei Männern und Frauen
In einer Studie von Meredith L. Chivers (Queen’s Universität in Kingston) wurden 134 Untersuchungen über das sexuelle Verhalten aus der ganzen Welt analysiert, die die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper im Stadium der Erregung untersuchten. Es zeigte sich, dass das männliche Gehirn und die Geschlechtsteile bei sexueller Erregung häufiger synchron funktionieren als bei Frauen. Wenn sich also Männer im Kopf erregt fühlen, ist die Chance groß, dass sich auch eine Erektion einstellt, während körperliche Anzeichen der Erregung bei Frauen nicht immer unmittelbar mit gedanklicher Erregung zu tun hatten. Offensichtlich funktioniert der Zusammenhang zwischen mentaler und physischer Erregung bei Frauen anders, denn sie können körperliche Reaktionen zeigen und trotzdem nicht erregt sein. Auch ließ sich aus den Untersuchungen schließen, dass die Chance bei Frauen, Lust sowohl körperlich als auch mental zu erfahren dann größer ist, wenn sie bestimmten visuellen Reizen ausgesetzt sind. Nach Meredith Chivers lassen sich die Resultate jedoch nicht so interpretieren, dass Frauen nicht wissen, was sie wollen, sondern dass das, was sie wollen, weniger stark mit ihrer körperlichen sexuellen Reaktion verbunden ist, als dies bei den Männern der Fall ist. In einer anderen Untersuchung von Chivers, bei denen die Probanden Videos von Sex zwischen Affen gezeigt wurden, wurden die Männer nicht erregt, während Frauen mit sexueller Erregung darauf reagierten - allerdings nur im physischen Bereich. Subjektive Lust im Kopf empfanden sie dabei keine. Auch reagieren Frauen generell auf eine größere Auswahl sexueller Stimuli als Männer.
Die Fisher et al. (2012) haben untersucht, wie oft der Gedanke an Sex in den Köpfen von Männern und Frauen auftaucht, und statteten 283 Studenten mit einem Beeper aus, den sie eine Woche lang immer dann drücken sollten, wenn ihnen ein solcher Gedanke kam. Männer dachten in dieser Zeit durchschnittlich 34 Mal am Tag an Sex, Frauen 19 Mal, wobei es unabhängig vom Geschlecht große individuelle Unterschiede von nur einem bis zu 400 Gedanken pro Tag gab. In diesem Experiment wurde auch erhoben, wie oft die VersuchsteilnehmerInnen an Essen und an Schlafen dachten: die jungen Männer dachten auch hier deutlich häufiger an Essen und Schlafen als Frauen, wobei es aber ProbandInnen gab, die häufiger an Essen und Schlafen als an Sex dachten.
Literatur
Chivers, M. L., Seto, M. C., & Blanchard, R. (2007). Gender and sexual orientation differences in sexual response to the sexual activities versus the gender of actors in sexual films. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 1108–1121.
Chivers, M. L., Seto, M. C., Lalumière, M. L, Laan, E., & Grimbos, T. (in press). Agreement of genital and subjective measures of sexual arousal in men and women: A meta-analysis. Archives of Sexual Behavior.
Suschinsky, K., Lalumière, M. L., & Chivers, M. L. (2009). Sex differences in patterns of genital arousal: Measurement artifact or true phenomenon? Archives of Sexual Behavior, 38, 559–573.
Fisher, Terri D., Moore, Zachary T. & Pittenger, Mary-Jo (2012). Sex on the Brain? An Examination of Frequency of Sexual Cognitions as a Function of Gender, Erotophilia, and Social Desirability. Journal of Sex Research, 49, 69-77.
Rotationstest
Bei einigen wenigen räumlichen Denkprozessen weisen Männer teilweise eine deutliche Überlegenheit auf, wobei es Männer besonders gut können, sich vorzustellen, wie ein kompliziertes Objekt, das im Raum gedreht wird, aussehen würde, wenn die Drehung zu Ende ist, d.h., sie sind in Belangen der mentalen Rotation besser. Einige Dinge, die daraus folgen, liegen diesem Kern zugrunde, denn Frauen sind überall dort, wo das Rotationsprinzip eine Rolle spielt, im statistischen Mittel, weniger begabt, wobei es sich dabei um einen statistischen, sehr robusten Effekt handelt, der seit 40 Jahren und über alle Kulturkreise hinweg nachgewiesen werden konnte. In diesem Fall kann man mit großer Wahrscheinlichkeit von einem biologischen Faktor ausgehen, wobei auch die links-rechts-Verwechslung ist bei Frauen etwas stärker ausgeprägt, wenn auch der Unterschied nicht so deutlich ist wie bei der mentalen Rotation. Frauen parken daher experimentell nachweisbar schlechter ein, was sowohl mit der weniger ausgeprägten Begabung der räumlichen Vorstellung als auch vermutlich einem geringeren Selbstbewusstsein von Frauen angesichts von Parklücken zu tun hat. Vermutlich haben in diesem Fall auch self-fulfilling prophecies Einfluss auf die Denkleistungen nehmen.
Der mentale Rotationstest, der das räumliche Vorstellungsvermögen untersucht, indem dabei mehrere dreidimensionale Figuren auf Übereinstimmungen überprüft werden müssen, wofür man die Figuren im Kopf drehen muss, fällt Männern leichter. Man vermutet, dass Hormone dafür verantwortlich sind. Testosteron hilft offenbar beim mentalen Rotieren, denn Frauen mit hohen Testosteronwerten schneiden dabei ebenso wie Männer besser ab. Östrogene dagegen blockieren das geistige Drehen. Die Werte ändern sich auch mit dem monatlichen Zyklus, denn während der Menstruation, wenn die Östrogenwerte niedrig sind, beherrschen auch Frauen das Rotieren besser. Männer verarbeiten Sprache und räumliche Aufgaben eher getrennt in rechter und linker Hirnhälfte, während Frauen beide Hirnhälften gleichzeitig symmetrischer nutzen. Während der Menstruation verarbeitet auch das weibliche Gehirn Aufgaben asymmetrisch – links Sprache, rechts Raum. Und nach den Wechseljahren, wenn die Konzentration an weiblichen Sexualhormonen sinkt, funktioniert das Gehirn der Frauen ebenfalls eher nach männlichem Muster. Frauen denken also zu ganz bestimmten Zeiten in ihrem Leben anders.
Hungrig lernen
Buben lernen am besten, wenn sie leicht hungrig sind. Mädchen sind am aufmerksamsten nach einem kohlehydrat- und eiweißhaltigen Frühstück. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität in Belfast. Toasts und Bohnen wirkten sich am besten auf die Lernleistung aus.
OÖNachrichten vom 18.10.2003
Siehe auch ![]() Linkshändigkeit, die bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig aufreten.
Linkshändigkeit, die bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig aufreten.
Nur vier Prozent lesen Spam
User entwickeln subtile Methoden gegen Junk-Mails
New York (pte, 17. Oktober 2003 08:10) - Eine Studie des US-Onlinevermarkters Doubleclick http://www.doubleclick.com dürfte den Spammern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Demnach lesen lediglich vier Prozent der User Spam-Mails. 65 Prozent löschen als Spam erachtete Mails sofort, ohne diese überhaupt zu öffnen. Die Consumer-E-Mail-Studie wurde im Sommer dieses Jahres durchgeführt.
Spam führen die Hitliste der Ärgernisse bei E-Mail-Empfängern an - für 89 Prozent stellen sie das Hauptübel dar. Der durchschnittliche User hat im Untersuchungszeitraum 264 E-Mails pro Woche empfangen, eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als 254 elektronische Poststücke in den Accounts landeten. Der Anteil der Junk-Mails blieb dabei mit 56 Prozent konstant.
Die User haben aber gleichzeitig ihre "Abwehrstrategie" gegen Spam verfeinert. So löschen nunmehr zwei Drittel entsprechende Mails, ohne sie gelesen zu haben. Im Vorjahr ist der Wert dieser "Spam-Ignoranten" noch bei 60 Prozent gelegen. Überhaupt nur mehr jeder 25. User liest ein Spam-Mail, 2002 war es noch jeder 20. Darüber hinaus kreieren die Konsumenten zunehmend Bulk Folders, in denen automatisch Massen-E-Mails unbekannten Ursprungs landen.
36,1 Prozent der User vertrauen auf die Spam-Funktionen ihres E-Mail-Programmes und knapp 16 Prozent haben zusätzlich spezielle Filtersoftware heruntergeladen. 13,7 Prozent haben sich gar eine zweite E-Mail-Adresse zugelegt, über die Online-Käufe getätigt werden. Was den Spam-Begriff betrifft, sind Frauen offenbar etwas "toleranter" als Männer. Demnach definieren etwa 36 Prozent der Männer jedes Mail, das "mir ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen will", automatisch als Spam, während bei den Frauen dagegen nur 32 Prozent eine entsprechende Klassifizierung vornehmen.
Einer Studie zufolge reagieren vor allem Männer gestresst, wenn der Computer ausfällt, d. h., Frauen gehen mit „Technostress“, also wenn eine Aufgabe unter Zeitdruck am Computer erledigt werden muss, dieser aber streikt, entspannter um als Männer. Dabei zeigen Männer eine höhere Aktivierung des sympathischen autonomen Nervensystems, wenn sich ihnen ein Hindernis in den Weg stellt. Auch stieg der Spiegel der Stresshormone signifikant, wenn die Ausführung einer Mensch-Computer-Interaktionsaufgabe durch ein System nicht gewährleistet war, jedoch war bei Männern eine wesentlich stärkere Aktivierung des sympathischen autonomen Nervensystems bemerkbar als bei Frauen.
AGTK 03179: Spam. 17.10.03
http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=031017001/pte031017001
Medien/Kommunikation, Computer/Telekommunikation
http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/
psychologie-computerabstuerze-stressen-maenner-mehr-9018201.php (13-10-02)
Managerinnen haben bessere Performance
Die Kurse von weiblich geführten Unternehmen entwickeln sich besser als jene von Unternehmen mit männlichen Chefs.
Einem Bericht der Zeitung USA Today zufolge ist die Kursentwicklung jener Unternehmen, an deren Spitze Managerinnen stehen, deutlich besser als die durchschnittliche Kursentwicklung. Ein Investment von 8000 Dollar (6334 Euro) in den Aktienmarkt ergab zu Jahresende 2003 laut dem S&P-500-Index ein Ergebnis von 10.130 Dollar. Wären die 8000 Dollar nur in die acht von Frauen geleiteten Unternehmen in der Fortune-500- Liste investiert worden, hätte die Endsumme hingegen 12.130 Dollar betragen. Das bedeutet. dass mit "Frauen"-Aktien ein Gewinn von 52 Prozent erzielt wurde, während im Durchschnitt der Gewinn nur bei 27 Prozent lag.
Die Unternehmensberatung McKinsey zeigte, dass gemischte Führungsgremien sowohl ökonomisch als auch von der Unternehmenskultur her signifikant erfolgreiche rsind. Die Firmen mit den meisten Frauen im Vorstand erzielten im Vergleich zu solchen ohne Frauen eine bis zu 53 Prozent höhere Eigenkapitalrendite. Wo sich mindestens drei Frauen im Vorstand finden, steigen die Erträge nachweislich. Drei allerdings müssen es sein, um die dominierende Kultur in einer Gruppe zu beeinflussen. Die klassische Einzelkämpferin kann nichts verändern.
Einen Erklärungsversuch für die gute Performance von Managerinnen hat Eileen Scott, CEO der Supermarktkette Pathmark Stores und selbst eine der acht Chefinnen von Fortune-500-Unternehmen. Die "gläserne Decke", die Frauen an einer Karriere hindert, sei so schwierig zu durchstoßen. dass dies nur jene schaffen, die im direkten Vergleich mit männlichen Managern deutlich besser sind.
Die Presse vom 3.1.2004, S. 28.
Gesundheitsbewusstsein und Geschlecht
Männer zwischen 40 und 80 Jahren überschätzen nach einer Umfrage in sechs europäischen Ländern und den USA ihren gesundheitlichen Zustand oft, denn sie glaubten zu rund 85 Prozent, sie seien gesund, während die Krankenakten anderes aussagten. Während Frauen eher gewohnt sind, auf die eigene Gesundheit und die der Familie zu achten, ignorierten Männer Schmerzen häufiger und sind daher anfällig für Herzinfarkte und Schlaganfälle, denen häufig Antriebslosigkeit und Müdigkeit vorausgingen.
Quelle: http://www.welt.de/die-welt/wissen/article7462958/Der-Anti-Hypochonder.html (10-05-05)
breithüftige und kurzbeinige Geschlecht
das schöne zu nennen,
dies konnte nur der vom Geschlechtstrieb
umnebelte männliche Intellekt fertigbringen.
Arthur Schopenhauer.
Geschlecht als größtes Karrierehemmnis
Nach einer Studie von Accenture (2200 Führungskräfte aus dem mittleren und oberen Management wurden in 13 Ländern weltweit befragt), nann jede Vierte der Frauen ihr Geschlecht als Karrierehindernis, jedoch nur vier Prozent der Männer. Diese gaben Faktoren wie mangelnder Leidenschaft oder fehlender familiärer Unterstützung die Schuld, wenn es mit dem beruflichen Aufstieg nicht funktioniert. Frauen sehen eher die eigene Persönlichkeit und mangelnde Leistung als Karriereknick, während Männer äußere Umstände wie schlechte Konjunktur oder schlichtweg Pech als Grund für den ausbleibenden Erfolg nennen (Siehe dazu das Modell der Kontrollüberzeugung). Männer trauen sich bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn mehr zu als Frauen. Männer neigen dazu, sich zu große Schuhe anzuziehen und trauen es sich eher zu, in einen Job hineinzuwachsen. Nur ein Viertel der befragten Frauen misst Netzwerken eine große Bedeutung zu, während dies 40 Prozent der Männer tun.
Quelle: OÖN vom 19.4.2008
Temperaturempfinden unterschiedlich
Im Hypothalamus befindet sich in einem etwa nussgroßen Areal eine Art körpereigenes Thermometer, das die Kerntemperatur misst und entscheidet, ab wann man zu zittern beginnen soll. Der Sollwert des Menschen beträgt um die 37 Grad, wobei die Toleranz gering ist, denn zwischen 36,5 und 37,5 Grad liegt die "Wohlfühlzone", innerhalb derer sich Menschen gut fühlen. Allerdings gibt es von der Klimazone abhängige Schwankungen zwischen den Kulturkreisen, denn australische Ureinwohner frieren erst, wenn sich ihr Körper deutlich unter 37 Grad abkühlt. Verlässt die Temperatur den Wohlfühlbereich nach oben oder unten, beginnen Menschen entweder zu schwitzen oder zu zittern, wobei dieser Prozess bei Frauen und Männern zwar gleich abläuft, aber Frauen den kleinen Vorteil haben, dass durch ihre durchschnittlich etwas dickere Fettschicht ihr Körper besser isoliert ist. Dennoch frieren Männer in der Regel weniger, denn ihre im Durchschnitt größere Muskelmasse isoliert zwar nicht so gut wie Fett, produziert aber auch im Ruhezustand Wärme. Dicke frieren übrigens generell weniger, denn je kleiner die Körperoberfläche im Verhältnis zum Volumen ist, desto weniger Wärme verliert der Körper. Der optimale Körper gegen die Kälte wäre daher eine Kugel ;-)
Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1292517911013.shtml (10-12-20)
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
Frauen arbeiten unter Zeitdruck besser als Männer
Weibliche Teilnehmer einer Studie der Vanderbilt Universität waren beim Lösen von zeitlich befristeten Aufgaben deutlich erfolgreicher als Männer. 8000 TeilnehmerInnen zwischen zwei und 90 Jahren wurden verschiedene Aufgaben gestellt. Hinsichtlich der Intelligenz unterschieden sich die Geschlechter nicht, aber beim Lösen der Aufgaben waren die weiblichen Teilnehmer deutlich überlegen. Die Wissenschafter führen dies auf eine erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit der Frauen zurück, also die Fähigkeit, mittelschwere Aufgaben effizient und akkurat zu erledigen. Diese Überlegenheit tritt ab dem Grundschulalter auf und ist bei Kindern und Jugendlichen besonders ausgeprägt.
Intelligence April 2005.
Männer fragen nicht nach dem Weg
Eine britischen Studie ergab, dass männliche Autofahrer in England jährlich sechs Millionen Stunden Zeit verlieren, da sie im Durchschnitt 20 Minuten benötigen, bevor sie einen Ortskundigen nach dem Weg fragen. Frauen warten im Durchschnitt nur zehn Minuten. Fahren Männer und Frauen gemeinsam, gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie sich schon einmal über den richtigen Weg gestritten haben.
OÖNachrichten vom 15.03.2006, S. 22.
Orientierungssinn
Die meisten Männer können sich Wege besser merken und finden sich auch auf Landkarten leichter zurecht. Bereits frühere Studien hatten gezeigt, dass dahinter eine unterschiedliche Strategie steckt, sich zu orientieren. Das spiegelt sich etwa in der Art wider, wie Männer und Frauen eine Wegbeschreibung aufbauen: Während sich die Männer auf Himmelsrichtungen und Entfernungen konzentrieren, beschreiben Frauen fast ausschließlich markante Punkte.
Um das zu untersuchen, führten Jones und Healy verschiedene Tests mit 97 ProbandInnen durch. Einige der Tests waren nur mit Hilfe von räumlichen Informationen zu lösen, während für andere ausschließlich visuelle Hinweise wichtig waren. In einem letzten Test untersuchten die Forscherinnen schließlich, welche Informationen für die männlichen und weiblichen Probanden jeweils am hilfreichsten waren. Das Ergebnis: Frauen schnitten in den räumlichen Tests sehr viel schlechter ab als Männer. Hingegen waren die Leistungen bei den Aufgaben, bei denen es auf optische Merkmale ankam, praktisch gleich. Frauen haben demnach ein sehr viel schlechteres Gedächtnis für räumliche Anordnungen und verwenden hauptsächlich optische Informationen zum Orientieren. Männer können dagegen die räumlichen und die visuellen Hinweise gleich gut verwerten. Das erkläre auch, warum sich Frauen lediglich in einigen wenigen Situationen, beispielsweise in geschlossenen Räumen, besser orientieren können als Männer: Während sich Frauen ausschließlich auf die in solchen Fällen wichtigeren optischen Informationen konzentrieren, teilen die Männer ihre Aufmerksamkeit zwischen den wesentlichen und den unwesentlichen Informationen auf.
Literatur:
Catherine Jones und Susan Healy (Universität Edinburgh) in der Fachzeitschrift „Proceedings of the Royal Society B” (Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1098/rspb.22006.3572).
Geschlechtsrollenidentität und Aggressionsbereitschaft im interkulturellen Kontext
In der bisherigen Forschung bezüglich der Beziehung zwischen Geschlecht und Aggressivität weisen die überwiegenden Befunde darauf hin, dass Männer aggressiver sind als Frauen (Krahé, 2001) und dass dies ein stabiler Befund über verschiedene Kulturen zu sein scheint (Archer & McDaniel, 1995). Dennoch nehmen kulturelle Normen wie geschlechtsspezifische Eigenschaften einen sehr unterschiedlichen Einfluss auf die Aggressionsbereitschaft: Femininität hemmt eher Aggression, während Maskulinität diese eher verstärkt. Männer wenden eher direkte Formen (z.B. physisch), Frauen eher indirekte Formen der Aggression (z.B. relational) an. Auch interkulturelle Studien zeigen ein sehr heterogenes Bild und es bleibt unklar, inwiefern kulturelle Normorientierungen wie Kollektivismus und Individualismus Einfluss auf das Aggressionsniveau nehmen (Ramirez & Richardson, 2001).
Um die Beziehung zwischen Geschlecht, Kultur und Aggressionsbereitschaft näher zu untersuchen, wurde eine eigene interkulturelle Studie an 170 deutschen Studierenden (94 Frauen, 76 Männer), 157 amerikanische Studierende (71 Frauen, 86 Männer) und 164 kalmykischen Studierenden (86 Frauen, 78 Männer) durchgeführt. Hierzu wurden die kulturelle Normorientierung, geschlechtsspezifische Eigenschaften und Aggressionsbereitschaft erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass Kalmyken (und Amerikaner) eine stärkere kollektivistische Werteausprägung haben; aber die Kalmyken verfügen über ein höheres Aggressionsniveau als Deutsche und Amerikaner. Insbesondere der Kollektivismus wirkt bei den Männern der drei Kulturen eher hemmend auf die physische Aggressionsbereitschaft. Demgegenüber üben Maskulinität und Femininität bei den amerikanischen Studierenden einen starken Einfluss auf die Aggressivität aus (Wolfradt, 2003).
Unterschiede weiblicher und männlicher Psychothie
Eine Psychologin der Freien Universität konnte mit einigen Kollegen beweisen, dass die forensische Diagnose psychopathischer Frauen auf falschen Annahmen beruht, was vor allem im Strafvollzug Folgen haben kann, wenn an beide Geschlechter der gleiche Maßstab angelegt wird. Mithilfe der sogenannten Psychopathie-Checkliste (PCL) hat sie Straftäter beiderlei Geschlechts auf ihre Gefährlichkeit untersucht und Prognosen erstellt, auf deren Grundlage auch darüber entschieden wird, wer vorzeitig entlassen werden kann und wer besondere therapeutische Zuwendung erhält. In der Aggressionspsychologie geht man davon aus, dass Frauen im Gegensatz zu Männern weniger körperlich und auch weniger proaktiv aggressiv sind, d.h., dass Frauen sind eher relational und reaktiv aggressiv, während Männer die körperliche Auseinandersetzung suchen und sie gezielt einsetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Frauen hingegen sind in der Tendenz eher aggressiv, um auf eine Beeinträchtigung ihrer Interessen zu reagieren. Außerdem agieren sie bevorzugt auf der Beziehungsebene, etwa durch Intrigen, das Verbreiten von Gerüchten, gezieltes Ignorieren oder den Ausschluss unliebsamer Personen aus der Gemeinschaft. Da die Psychopathie-Checkliste von Hare nur auf die klassisch-männliche Aggression abzielt, erreichen Frauen seltener hohe Psychopathie-Werte: Einerseits wird ihre Gefährlichkeit tendenziell niedriger eingeschätzt als sie tatsächlich ist, was ihnen oft positive Prognosen verschafft, obgleich sie für die Gesellschaft möglicherweise ein großes Risiko sind. Andererseits werden ihnen Therapien gar nicht, später oder in geringerem Umfang angeboten.
Quelle: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/der-grosse-unterschied/4063842.html (11-04-16)
Wahnvorstellungen von Männern und Frauen unterschiedlich
Männliche und weibliche Schizophrenien unterscheiden sich nach Ansicht des Psychiaters Martin Brüne (Universität Bochum) insofern, als sich Männer im Wahn meist von Gruppen anderer Männer verfolgt fühlen: Mafia, Polizei, Agenten. Frauen hingegen fühlen sich von Personen aus dem persönlichen Umfeld bedroht, Nachbarn, Familienmitgliedern. Das ist im evolutionären Kontext verstehbar, weil so die frühen Gefahren aussahen: Männer wurden von fremden Männergruppen bedroht, Frauen durch Verstoß aus der Ingroup. Beim Liebeswahn, also wenn jemand fest davon überzeugt ist, von einer anderen Person geliebt zu werden, richtet sich bei Frauen der Wahn meist auf hochrangige, etwas ältere Männer. Bei Männern, bei denen die Störung selten vorkommt, eher auf attraktive, jüngere Frauen. Hier spiegeln sich die aus der evolutionären Psychologie bekannten, unterschiedlichen reproduktiven Strategien wieder: Frauen suchen Sicherheit für die langjährige Brutpflege, Männer wollen ihre Gene unter möglichst vielen jungen und gesunden Frauen verbreiten.
Quelle: Die Zeit vom 24. April 2011
Frauen lesen mehr Kriminalromane als Männer
GEO berichtet in seiner März-Ausgabe 2010, dass nach einer Statistik des Buchhandels im Jahr 2008 55 Prozent der deutschen Frauen mindestens einen Kriminalroman gelesen haben, gegenüber nur 44 Prozent der Männer. Man vermutet nach einer psychologische Studie der University of Illinois, dass Frauen vor allem zum Selbstschutz diese Lektüre bevorzugen, denn Frauen fürchten sich mehr vor Gewalttaten als Männer, obwohl letztere seltener Opfer sind. In Romanen aber auch in TV-Sendungen suchen sie nach HInweisen, wie eine Notsituation zu überleben wäre. Allerdings beruhigt sie dieses Wissen nicht, denn je mehr Frauen über Verbrechen lesen, desto größer ist ihre Angst, woraus der Teufelskreis entsteht, dass sie noch mehr Krimis als zuvor konsumieren. Actionfilme ohne konkreten Alltagsbezug berühren Frauen im Gegensatz zu Männern hingegen nicht.
Unterschiedliche Aggressionsformen bei Buben und Mädchen im Vorschulalter
Eine Untersuchung mit Vierjährigen in den USA hat gezeigt, dass Mädchen nicht friedlicher sind als Buben, aber sie kämpfen nur mit subtileren Mitteln. In diesem Experiment wurden die Vorschulkinder zu dritt in Mädchen- oder Bubengruppen eingeteilt und mussten sich um eine begehrte Tierpuppen streiten. Während Buben dabei auf direkte Aggression setzten und einem anderen die Puppe einfach wegnahmen, verwendeten Mädchen eher die Taktik der sozialen Ausgrenzung. So flüsterten sie etwa zu zweit hinter dem Rücken der gegenwärtigen Puppenbesitzerin oder versteckten sich sogar vor ihr. Diese sozial aggressive Taktik erklärt auch, warum Mädchen in Freundschaften mit Geschlechtsgenossinnen eifersüchtiger sind als Buben.
Quelle: OÖN vom 08.07.2008
Unterschiedliche Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten
Theodore Beauchaine (Universität von Washington) schließt aus Untersuchungen, dass typisch männliche Verhaltensauffälligkeiten wie Impulsivität, scheinbar grundloses aggressives Verhalten oder Konzentrationsschwäche zu achtzig Prozent vererbbar sind. Bei weiblichen Jugendlichen hingegen scheinen Verhaltensstörungen dagegen eher auf soziale Probleme zurückführen zu sein. Daher sollte über verschiedene Behandlungsansätze für Knaben und Mädchen nachgedacht werden.
Quelle: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Ist die stärkere weibliche Depressionsneigung auf ein anders strukturiertes Gehirn zurückzuführen?
An der Innsbrucker Medizinischen Universität (Klinischen Abteilung für Biologische Psychiatrie) hat Alex Hofer im Rahmen des Projekts "Funktionelle MRT-Untersuchung zur Lokalisation geschlechtsspezifischer Unterschiede in der cerebralen Verarbeitung emotionaler Stimuli" die Verarbeitung emotionaler Reize untersucht. Tatsächlich scheinen Frauen und Männer auf hoch emotionale Szenen, Bilder oder Worte unterschiedlich zu reagieren. Was wiederum die Frage aufwirft, ob diese divergierende Wahrnehmungsfähigkeit von Emotionen einfach nur irgendwie passiert oder ob sie sehr wohl mit ganz bestimmten unterschiedlichen Gehirnstrukturen gekoppelt ist. Es konnte gezeigt werden, dass deutliche "Aktivierungsunterschiede" zwischen Männern und Frauen existieren, wenn diese mit positiven Bildern (Kinder, Liebende, junge Hunde), ihrem Gegenteil (Kriegsszenen, Tötungen und dergleichen) oder auch mit positiven und negativen Worten konfrontiert sind. Generell wird das Gehirn von Frauen stärker aktiviert, wobei die Schläfenlappen, der Schalenkern, das Kleinhirn und der Hippocampus - je nachdem, ob es sich um Wörter oder Bilder handelt - eine regere Aktivität aufweisen. Nur einmal fällt die Aktivierung bei Männern stärker aus, wenn negativ konnotierte Wörter ins Spiel kommen: In diesem Fall springt sozusagen der rechte Scheitellappen an - bezeichnenderweise jener Gehirnbereich, der auch dann reagiert, wenn man mit aggressiven Handbewegungen konfrontiert ist. Frauen reagieren nach dieser Studie weitaus empfindlicher auf Emotionen - nicht allein subjektiv auf der Ebene des Erlebens, sondern auch im Bereich der biologischen Trägerstrukturen. Diese Areale oder Funktionsbereiche sind nachweislich auch bei Depressionen aktiv. Wenn Frauen also doppelt so oft wie Männer an Depressionen leiden, kann das mit dieser "Aktivierungsdifferenz" zusammenhängen.
Quelle: DER STANDARD vom 7. März 2007, S. 15.
Publikationen über die naturbedingten und angeblich unüberwindlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben seit Jahren Konjunktur, wobei die Grundlagen dafür hauptsächlich Studien liefern, die die neuen bildgebenden Techniken nutzen, um Geschlechtsunterschiede in der Struktur des Gehirns oder die Muster neuronaler Aktivität sichtbar zu machen. Cordelia Fine (Macquarie University, Australia) nimmt in ihrem Buch „Delusions of Gender“ Studien unter die Lupe, die sich mit dem Thema Männer- und Frauengehirn beschäftigten, und stellte dabei fest, dass viele Untersuchungen mit einer viel zu geringen Anzahl an ProbandInnen durchgeführt wurden. Auch gibt es große Diskrepanzen zwischen dem, was die bildgebenden Studien zeigten, und den Schlussfolgerungen, die Wissenschaftler daraus ziehen, denn die Autoren nutzen oft die gängigen Geschlechterstereotypen, um Lücken der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu überbrücken.
Männer sind laut Studien in hohen Jahren glücklicher, Frauen in der Jugend
Nach einer internationalen Studie, die am Weltkongress für Psychologie 2008 in Berlin präsentiert wurde, sind Frauen nur in jungen Jahren glücklicher als Männer, aber mit zunehmendem Alter werden sie durch schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen in der Liebe sowie finanzielle und andere Probleme stärker abgeschliffen. Obwohl beide Geschlechter ähnliche Wünsche im Leben haben, sind junge Männer oft unglücklich – vor allem in ihren Zwanzigern –, während junge Frauen in diesen Jahren das Leben und den beruflichen Erfolg am meisten genießen. Dann aber kehrt sich das allmählich um und das männliche Glück übertrifft das weibliche. Anke Plagnol und Richard Easterlin haben in den USA Längsschnittdaten ausgewertet und festgestellt, dass der Wendepunkt im Leben eines Menschen um sein 48. Lebensjahr eintritt. Nach diesem Wendepunkt sind es Männer, die eher ihre Sehnsüchte erfüllt sehen, die zufriedener sind mit ihrem Familienleben, ihrer finanziellen Situation und insgesamt glücklicher sind. Offensichtlich werden Frauen ab Ende vierzig schwerer fertig mit verlorenen Hoffnungen, vertanen Chancen und verfehltem Liebesglück. Männern in diesem Alter fällt es offenkundig leichter, solche Verluste wegzustecken.
Wiener Zeitung vom Donnerstag, 31. Juli 2008
Vom "katholischen Arbeitermädchen vom Lande" zum "türkischen Großstadtjungen"
In den Bildungsdebatten der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts war "das katholische Arbeitermädchen vom Lande" jene Symbolfigur, die alle Benachteiligungen auf sich vereinte. Heute gilt das für den "türkischen Großstadtjungen". Männliche Jugendliche kommen in der frauendominierten Schule heute zu kurz, denn wer sich wie ein typischer Bub aufführt, wird schnell als hyperaktiv, aggressiv oder sozial defizitär wahrgenommen, während das angepasste, pflegeleichte Mädchen hingegen "zum Maßstab in den Schulen" geworden ist. Bildungsexperten sehen aber die Benachteiligung in der Schule nicht allein auf die Jungen aus Migrantenfamilien begrenzt, denn in der sind zwei Drittel aller Schulabbrecher männlich, ebenso drei Viertel der Sonderschüler. Auch bleiben Jungen deutlich häufiger als Mädchen sitzen. In der Grundschule erhalten sie trotz gleicher Kompetenzen oft schlechtere Noten als Mädchen, und auch 56 Prozent der Abiturienten sind weiblich. Dabei sollten Mädchen wie Jungen die Schule als einen Ort erleben, "der für sie da ist, der auf ihre Bedürfnisse eingeht - auch auf die geschlechterbedingten", sagte Erdsiek-Rave. Der Hamburger Pädagoge Frank Beuster folgerte: "Jungen kommen in der frauendominierten Schule heute zu kurz. Wer sich wie ein typischer Junge aufführt, wird schnell als hyperaktiv, aggressiv oder sozial defizitär wahrgenommen." Das angepasste, pflegeleichte Mädchen sei hingegen "zum Maßstab in den Schulen" geworden. Männliche Lehrer gewünscht: Schuld daran ist vor allem die auch heute noch zunehmende "Verweiblichung" der Pädagogik- und Erziehungsberufe.
Quelle: http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/8/0,3672,3977480,00.html (06-09-01)
In männlichen Gehirnen weniger Oxytocin und Serotonin
In der Studie "Was könnte er gerade denken? - Wie der Verstand des Mannes wirklich funktioniert" versuchte der Sozialphilosoph Michael Gurian zwei Jahrzehnte neurobiologischer Forschung mit Geschichten aus den täglichen Leben und seinen Erfahrungen als Familientherapeut zu vereinen, um folgendes Bild der männlichen Psyche zu zeichnen: Da sich in männlichen Gehirnen weniger Oxytocin und Serotonin befindet, wünscht sich das männliche Hirn am Ende eines langen Tages abzuschalten und hirnlos in Action- und Sportsendungen herumzuzappen, während sich Frauen eher mit gefühlsintensiven Gesprächen entspannen können. Das männliche Gehirn nimmt daher auch weniger Details wahr, so dass Staub und Unordnung zu Hause unbemerkt bleiben. Männliche Hormone wie Testosteron und Vasopressin verursachen, dass er sich ständig beweisen will. Das verstärkt sich noch, wenn die Familien Kinder haben.
Immer weniger Jungen sind in der Schule erfolgreich
In Nordrhein-Westfalen verlassen 8,5 Prozent der Jungen die Schulen ohne Abschluss, bei den Mädchen sind es nur 4,9 Prozent. Der Anteil der Jungen, die von der Grundschule eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen, liegt sechs Prozent unter dem der Mädchen. Nahezu umgekehrt sieht es bei Hauptschulempfehlungen aus. Ebenfalls sechs Prozent weniger Jungen als Mädchen haben ein Abitur in der Tasche. In der BRD insgesamt liegt der Jungenanteil an Sonder- und Förderschulen bei 64 Prozent, an Hauptschulen bei 56 Prozent. Die "Jungenquote" beträgt an Gymnasien nur mehr 46 Prozent, Tendenz fallend. Von den Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss sind 35 Prozent Mädchen. Die Geschlechterrelation beim Erwerb der Hochschulreife hat sich gegenläufig von 52 Prozent Männeranteil 1980 auf nur mehr 43 Prozent im Jahr 2002 verschoben. Jungen erzielen an deutschen Gymnasien durchschnittlich um 0,35 Notengrade schlechtere Zensuren und stellen etwa sechzig Prozent der Sitzenbleiber. Zudem werden sie doppelt so häufig bei der Einschulung zurückgestellt als Mädchen.
Die Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung bestätigt das Aufholen der Mädchen beim Erwerb weiterführender Bildungsabschlüsse. Allerdings konstatiert die Arbeitsgruppe auch: "Die Bildungsbenachteiligung von Frauen ist damit jedoch nicht aufgehoben, sondern die Selektionsschwelle hat sich zum Studium und zur Berufsausbildung verschoben." Nach wie vor stellen Frauen unter den Universitätsprofessoren eine Minderheit. Nach wie vor verdienen berufstätige Frauen bei gleicher Vorbildung weniger als ihre männlichen Kollegen. Bei den Schulerfolgsquoten aber sind die Frauen auf der Überholspur.
Ist die Leistungsdifferenz allein daraus zu erklären, dass Mädchen in Bezug auf Arbeitshaltung und Fleiß den Jungen voraus sind, wie Schulpraktiker und Schulforscher zu konstatieren glauben? Unter Psychologen und Erziehungswissenschaftlern ist in der letzten Zeit ein Streit darüber entbrannt, ob dieses altbekannte Erklärungsmuster ausreicht, diesen Absturz der Jungen beim Wettlauf um höhere Bildungsabschlüsse zu begründen. Der Schweizer Psychologe Allan Guggenbühl (Institut für Konfliktmanagement in Zürich) wirft den Schulen vor, sie entwickelten sich zu einem Biotop, das den Bedürfnissen der Knaben kaum mehr gerecht werde. Die Jungen seien - so Guggenbühl - nicht leistungsschwächer, problematischer und erziehungsresistenter, es sei die heutige Schule, die es versäume, die Buben in ihren männlichen Verhaltensmustern anzusprechen.
Auch der Berliner Pädagogikprofessor Ulf Preuss-Lausitz und der Soziologe Ralf Dollenweber meinen eine "alltägliche Abwertung" und zunehmende "Pathologisierung" der Jungen in der Schule erkennen zu können. Der US-Psychotherapeut Michael Gurian beklagt, wie im FOCUS kürzlich nachzulesen war, die Bewertung der Geschlechter habe sich völlig verschoben. In den Schulen fasse man heute eher das kommunikationsorientierte weibliche Verhalten als vorbildlich auf und messe die vornehmlich konkurrenzorientierten Jungen an dieser Norm. Deren stärkerer Bewegungsdrang werde vorschnell als Disziplinlosigkeit geahndet. Die Buchautorin Karin Jäckel weist darauf hin, dass bei Buben Wildheit gerne als Verhaltensstörung kritisiert, beim anderen Geschlecht aber als Temperament bewundert werde. Solche Aussagen mögen einseitig und als zu pauschalierend erscheinen. Allerdings beklagen sich nach einer im letzten Jahr erschienenen OECD-Studie deutsche Lehrerinnen und Lehrer überdurchschnittlich häufig über Disziplinlosigkeiten und Unterrichtsstörungen, die in der überwiegenden Mehrzahl von Jungen verursacht würden. Jungen scheinen sich zunehmend zu den Sorgenkindern in Familie, Kindergarten und Schule zu entwickeln.
Der Entwicklungspsychologe Leonard Sax hat sich angesichts der bei Knaben festgestellten Defizite im koedukativen Schulsystem für getrennten Schulunterricht von Buben und Mädchen ausgesprochen. Er plädiert für Unterrichtsformen, die mehr auf die Bedürfnisse der Buben abgestimmt ist, denn diese sind zum Zeitpunkt der Einschulung kognitiv und körperlich noch weniger entwickelt als Mädchen. Auch benötigen sie mehr Bewegungsangebote und kürzere Konzentrationszeiten als Mädchen. Dies gelte vor allem für die ersten vier Schuljahre, wobei es besser wäre, den getrennten Unterricht dann bis zum Schulabschluss beizubehalten.
Rückzug der Männer aus dem Erziehungsprozess
Eine Reihe von Psychologen und Erziehungswissenschaftlern scheint eine der Ursache dafür einem besonderen Problemfeld zuzuordnen, dem bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde: Viele Jungen wachsen zu Hause weitgehend ohne Vater auf, sei es, weil dieser wegen Berufstätigkeit kaum greifbar ist, sei es aufgrund von Trennungen und Scheidungen. Auch im Kindergarten und an der Grundschule treffen sie fast ausschließlich auf Frauen, 98 Prozent der Erzieher in deutschen Kindergärten sind weiblich, 85 Prozent der Grundschullehrer. Bis zum Alter von zehn oder elf Jahren fehlt vielen Jungen die männliche Bezugsperson, - die pädagogische Betreuung bis dahin ist fast ausschließlich zu einer weiblichen Domäne geworden. Die Erziehungswissenschaftlerin Petra Milhoffer berichtet über ihre Erfahrungen bei der Ausbildung von Grundschullehrern: "Als ich kürzlich drei männliche Studenten in ihrem Unterrichtspraktikum zu betreuen hatte, was in meiner Tätigkeit zum ersten Mal vorgekommen ist, fiel mir Folgendes auf: sobald die drei Studenten hinten in der Klasse saßen, war die Lehrerin abgemeldet. Es entstand eine große Unruhe in der Klasse und vor allem die Jungen aber auch die Mädchen suchten jede Möglichkeit, mit den dreien in Kontakt zu kommen." An den Gymnasien, jahrelang eine Männerdomäne, was lange Zeit nachhaltig zum - zeitweise auch berechtigten - Bild einer männerdominierten, unpädagogischen Lehranstalt beigetragen hat, zeichnet sich inzwischen eine ähnliche Entwicklung ab. 1400 Referendarinnen, aber nur achthundert Referendare befinden sich derzeit etwa an bayerischen Gymnasium in der praktischen Seminarausbildung.
Damit ist allerdings noch nicht die Frage beantwortet, ob die weitgehende Abwesenheit von Männern im frühen Erziehungsprozess bis zehn Jahren eine der Ursachen dafür ist, dass Jungen im Bildungsprozess immer stärker zu den Verlieren zählen. Tatsächlich gibt es valide wissenschaftliche Erkenntnisse nur zur frühkindlichen Erziehung und nicht zum Schulbereich. 1978 fand eine breit angelegte amerikanische Studie heraus, die sich mit Kleinkindern bis zum Alter von dreißig Monaten beschäftigte, dass Kinder, bei denen der Vater aktiv in Erscheinung tritt, besser mit fremden Situationen und fremden Menschen fertig werden. Moderne Erhebungen stützen die Erkenntnis, dass Kindererziehung vor allem dann glückt, wenn sich in ihr männliche und weibliche Verhaltensanteile anbieten von Personen verschiedenen Geschlechts.
Dabei haben neuere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass Jungen eher häufiger als Mädchen im Unterricht von der Lehrkraft beachtet werden, selbst wenn zu dieser "Beachtung" auch die vielen Disziplintadel gehören. Häufigere Beachtung führt aber nicht automatisch zu höherer Unterrichtsbeteiligung, nicht zu besseren Schulleistungen. Es wäre auch grundsätzlich verfehlt, den zweifellos vorhandenen Zusammenhang zwischen fehlenden männlichen Ansprechpartnern im Erziehungsprozess und den zunehmenden schulischen Schwierigkeiten von Jungen als einen Automatismus zu sehen, der kaum durch Schule beeinflussbar sei. Es gibt auch eine Reihe weiterer Gründe, die für den Rückzug vielen Jungen aus der Schule verantwortlich sind:
- Die Faszination für Computerspiele, neueste Technik im Konsumbereich ist bei Jungen höher als bei Mädchen. Buben verbringen doppelt so viel Zeit mit Videos und Computerspielen, als gleichaltrige Mädchen
- In engem Zusammenhang damit ist der Rückzug vom Bücherlesen bei Jungen erheblich stärker ausgeprägt als bei Mädchen. Nach der Pisa-Studie geben nur knapp dreißig Prozent der Mädchen, aber über fünfzig Prozent der Jungen an, dass sie nur lesen, wenn es unbedingt sein muss.
- Körperliche Betätigung, das Austoben ist für Jungen in bestimmten Altersstufen besonders wichtig. Überfüllte Klassenzimmer, ständige Kürzungen des Sportunterrichts, fehlende Ausgleichsphasen engen den Bewegungsspielraum von Jungen (und Mädchen) immer mehr ein.
Quelle: Dannenböck, Kornelia & Meidinger, Heinz-Peter (2003). Geraten die Jungen in unserem Bildungssystem immer mehr ins Abseits?
WWW: http://www.dphv.de/informationen/Profil32003S8.cfm (04-05-17)
Frauen sind bessere Fahrer
Frauen sind die besseren Autofahrer - selbst wenn sie sich vor einen Simulator setzen, der als Videospiel-Domäne von Männern gilt. Das ergab ein Simulatinstest eines britischen Autoversicherers mit 1200 TeilnehmerInen. Frauen richten weniger Schäden an ihren Fahrzeugen an, gehen geringere Risiken ein und schätzen Gefahren besser ein. Zudem handelten sich Frauen weniger Strafmandate wegen Geschwindigkeitsübertretungen ein als Männer und machten sich mehr Mühe die simulierte Fahrt durch eine Stadt zu planen. Kartenlesen ist demnach ebenfalls keine Männersache. 84 Prozent der Frauen blickten auf die Straßenkarte, hingegen nur 64 Prozent der Männer.
Quelle: OÖNachrichten vom 05.09.2005
Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.
Peter Bamm
Geschlechterabhängige Hirnreaktionen auf Humor
Männer sprechen im Durchschnitt um die 25.000 Wörter pro Tag
und Frauen etwa 30.000. Das Dumme ist nur, dass ich abends,
wenn ich nach Hause komme, meine 25.000 Wörter schon vergeben habe,
während meine Frau mit ihren 30.000 noch
anfängt.
Michael Collins
Allan Reiss et al. (University of Stanford) führte zehn Frauen und zehn Männern siebzig Schwarz-Weiß- Zeichentrickfilme vor und maß dabei die neuronale Aktivität verschiedener Hirnbereiche. Im Anschluss bewerteten die Teilnehmer die Filme auf einer Skala von eins bis zehn hinsichtlich der "Witzigkeit".
Den Ergebnissen zufolge ähneln sich beide Geschlechter im Gebrauch der Hirnareale, die für Sprachbedeutung und Wortbildung verantwortlich sind. Bei Frauen regen sich aber verstärkt Bereiche, die der analytischen Verarbeitung dienen: der präfrontale Cortex, der vermutlich auf eine stärkere Analyse von Sprache und Wahrnehmung verweist, und der Nucleus accumbens, ein Teil des Belohnungssystems. Vermutlich erwarten Frauen weniger eine Belohnung durch den Film als Männer. Dementsprechend reagiert ihr Belohnungssystem stärker, wenn der Zeichentrickstreifen sie tatsächlich zum Lachen bringt. Dies traf für Männer, die von Beginn an mit einem witzigen Film rechneten, nicht zu.
Einer Metastudie von britischen und US-amerikanischen Forschenden zufolge sind Männer das witzigere Geschlecht. Dafür haben sie 28 Studien mit mehr als 5.000 Probanden analysiert, in denen Menschen Humor bewerten mussten, ohne vorher zu wissen, ob der von einem Mann oder einer Frau stammt. Die "Humorproduktionsfähigkeit" von Männern, so die Studie im Ergebnis trocken, ist etwas höher als die von Frauen. Die Erklärung: Im Tierreich müssen sich die Männchen anstrengen, um die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu ziehen. Das geschieht etwa durch prächtige Federkleider oder Machtkämpfe. Vielleicht hat oder hatte Humor eine ähnliche Funktion? Dafür spricht, dass Humor tatsächlich mit Intelligenz verbunden und somit ein Fitnessindikator ist. Männer stellen den Humor eher zur Schau, um Frauen zu gefallen. Dieses Zur-Schau-Stellen von Humor kann aber auch schnell peinlich werden, wenn nämlich jemand nicht merkt, dass andere seine Witze gar nicht so witzig finden, was daran liegt, dass es für Männer einfacher ist, kein Feedback zu bekommen. Frauen und Männer setzen Humor aber anders ein. Studien haben gezeigt, wobei Frauen Humor eher benutzen, um Solidaritätszwecke zu erfüllen und zu verbinden, während Männer ihn eher einsetzen, um Wettbewerb zu schaffen oder zu gewinnen. Und hier kommt dann das ins Spiel, was man "negativen Humor" nennt, also Humor, der auf Kosten anderer geht und aggressiver ist.
Literatur
http://ww.wissenschaft-online.de/09. November 2005
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/psychologie-maenner-das-humorvollere-geschlecht (20-01-09)
Kleine Männer sind eifersüchtiger
Forschungen an der Universität Groningen mit 549 Männern und Frauen über die Einschätzung des Ausmaßes ihrer Eifersucht, brachte das erwartete Ergebnis: je größer die Männer sind, desto weniger eifersüchtig sind sie. Das sei logisch, da größe Männer durch ihre Körpergröße im Werben um Frauen einen Vorteil haben. Je kleiner Männer hingegen sind, desto schneller werden sie eifersüchtig. Bei den Frauen zeigte sich, dass eine mittlere Größe mit der geringsten Eifersucht einhergeht, da Frauen dieser Größe die höchste Anziehungskraft auf Männer besitzen.
Vielleicht hat dieses Forschungsergebnis mit Resultaten einer Studie von Darren Burke und Danielle Sulikowski zu tun, die in Evolutionary Psychology (2010, 8, pp 573-585) berichten, dass sich der Umstand, dass Männer in der Regel etwas größer als Frauen sind, auch in deren Wahrnehmung widerspiegelt, denn ihre ProbandInnen stuften Portraitfotos, die sie aus einer leicht erhöhten Perspektive betrachteten, im Durchschnitt als weiblicher ein als leicht von unten betrachtete Gesichter, die als männlicher eingestuft wurden. Diese spezifische Geschlechtswahrnehmung ging häufig auch mit einer höheren Attraktivitätsbewertung einher, worin ein möglicher Grund für die typischen Unterschiede in den Kopf- und Gesichtsformen von Männern und Frauen liegen könnte. Die Forscher vermuten, dass die schmalere Stirn- und Augenpartie und der kräftige Kiefer der Männer einerseits und die größeren Augen und das schmalere Kinn der Frauen andererseits sich auch deshalb evolutionär entwickelt haben könnten, weil sie den Effekt der leicht unterschiedlichen Perspektive verstärken.
Quelle: OÖnachrichten vom 14.03.2008
soll man sie auf keinen Fall unterbrechen.
Clint Eastwood
Geschlechtsspezifische Kommunikationmuster
Für Frauen hat Kommunikation in erster Linie das Ziel Symmetrie zu erzeugen, denn sie möchten auf einer Metaebene vermitteln: "Wir sind gleich, wir sind uns nahe". Der Austausch von Intimitäten ist für sie aus diesem Grunde wichtig, wobei die dadurch entstehende Abhängigkeit von den Kommunikationspartnern positiv erlebt wird. Intimität ist die Grundlage für die sozialen Bindungen der Frau. Kommunikationszweck der Männer hingegen ist es, mit einem Gesprächspartner den Status auszuhandeln und festzulegen, d.h. sein Kommunikationsverhalten geht zunächst von Asymmetrie aus: "Wer übernimmt die Führung im Gespräch? Wer besitzt mehr Ressourcen und Informationen? Wer hat die dominierende Position inne?" Die Metamitteilung des Mannes ist also: "Wie ist unser Verhältnis? Wer hat den höheren Status?"
Aus diesem Grunde entziehen sich Männer gerne Kommunikationssituationen, in denen von vornherein feststeht, dass sie unterlegen sein werden, etwa Gespräche mit einem Vorgesetzten oder einem Fachmann. Für Männer ist es also wichtig, seine Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen und deshalb die dominierende Rolle zu haben.
Männer formulieren ihre Wünsche unbewusst oft als Forderungen, wodurch sich Frauen häufig verletzt fühlen, da sich ihnen das Gefühl aufdrängt, dass der Mann sie unterdrücken will. Ähnlich ist es mit dem Austausch von Gefühlen zwischen Frauen und Männern. Frauen werden von Kindheit an daran gewöhnt und geübt, Gefühle mit den ihnen vertrauten Personen auszutauschen, wodurch ihre Beziehungen gefestigt werden, sodass immer wieder die Gleichheit, die Symmetrie betont wird, indem die eine von ihren Problemen berichtet und die andere, indem sie von ähnlichen Erfahrungen mit ähnlichen Gefühlen spricht, ihr das Gefühl gibt, verstanden zu werden.
Für Männer erhält der Austausch von Gefühlen keinen solchen Wert, da ihnen nur selten die richtigen Vokabeln zum Ausdruck ihrer Gefühle beigebracht werden. Das führt dazu, dass Probleme lediglich als Herausforderung angesehen werden, die es zu meistern gilt. Sie erzählen einander Probleme, um eine Lösung dafür zu finden. Diese Herausforderung ist um so größer, da der, der eine Lösung für das Problem eines anderen anbieten kann, dadurch seinen Status gegenüber dem anderen erhöht, da er eine wichtige Information besitzt, die der andere nicht hat. Kann keine Lösung gefunden werden, werden die Probleme des anderen beschwichtigt und als "halb so wild" abgetan. Für Männer zählt also hauptsächlich die Vermittlung von Information, sie haben kein direktes Interesse am Ausdruck von Mitgefühl.
Daher fällt es Frauen und Männern schwer, miteinander über Probleme zu reden, da sie dabei unterschiedliche Ziele haben. Ein Mann fühlt sich oft verletzt, wenn eine Frau, nachdem er ihr von seinem Problem berichtet hat, von ähnlichen Problemen erzählt. Er hört darin die Metamitteilung: "Dein Problem ist doch gar nicht so schlimm. Sieh mal, ich habe dieselben Probleme und werde auch damit fertig, also stell dich nicht so an". Er denkt auf der "Statusebene", während die Frau auf ihrer "Gleichheitsebene" denkt. Ebenso fühlt sich eine Frau vor den Kopf gestoßen, wenn sie einem Mann von ihren Problemen erzählt und er dafür sofort eine Lösung parat hat. Während sie gerne von ihm hören wollte, dass er sie versteht und vielleicht ähnliche Sorgen hat, gab er ihr eine Antwort, die Asymmetrie hervorrief. Seine Metamitteilung ist: "Siehst du, wie einfach ich dein Problem lösen kann? Das ist doch gar kein echtes Problem!" Er übernimmt aus Sicht der Frau wieder eine dominante Rolle und gibt ihr das Gefühl, belehrt zu werden. Probleme werden daher eher in gleichgeschlechtlichen Kreisen besprochen, da es auf Grund der lebenslangen Sozialisation beinahe unmöglich ist, sich von diesen verfestigten Denk- und Sprachmustern zu lösen.
Männer sind nachtragender
Psychologen der Case-Western-Universität in Cleveland fanden auf Basis von sieben Studien an mehr als 1400 Studenten heraus, dass Männer auf Beleidigungen grundsätzlich nachtragender reagiere nals Frauen. Dies gleicht sich aber aus, wenn man die Beleidigten mit ähnlichen Verfehlungen konfrontiert, die sie selbst einmal begangen haben. Erinnerten sich Männer, die beleidigt wurden, an selbst ausgestoßene Beschimpfungen, nahmen ihre Rachegefühle deutlich ab. Bei Frauen trat eine solche Nachsicht kaum auf.
Literatur: Tannen, Deborah (1990). You just don't understand. Women and Men in Conversation. New York: William Morrow and Company.
Mitgefühl zeigt sich bei Männern in anderen Gehirnregionen als bei Frauen
Mexikanische Wissenschaftler zeigten beiden Geschlechtern Bilder von kranken Kindern und analysierten die entstehenden Prozesse in den Gehirnen der Testpersonen. Dabei zeigte sich, dass männliches Mitgefühl eher als rationaler Prozess entsteht, während bei Frauen war die Empathie eher emotional bedingt. Die Aufnahmen der Frauengehirne waren auf den ersten Blick reicher und komplexer aus, während in den Männergehirnen nur an wenigen, fokussierten Stellen Aktivität zu sehen war.
Bei Partnerschaftsproblemen sind Frauen und Männer gleich rational und emotional
Das Institut für Psychologie der Universität Göttingen befragte 2000 Männer und Frauen, wie sich der jeweilige Partner bei Diskussionen von Problemen in der Partnerschaft verhält, und die Ergebnisse zeigten ein anderes Bild als erwartet, denn 38 Prozent der Frauen machen nach Aussagen ihres Partners bei Problemen konkrete Lösungsvorschläge. Nach Ansicht ihrer Partnerin gehen aber nur 36 Prozent der Männer lösungsorientiert vor, doch nach der gängigen Vorstellung, das Männer die besseren Problemlöser wären, müsste der Anteil der Männer, der sich Probleme vornimmt, höher sein als bei Frauen. Auch bei der Frage nach dem Mitgefühl zeigten Frauen laut Aussage der Männer dieses in 28 Prozent der Fälle, und sind somit in der Studie nicht stärker gefühlsbetont als lösungsorientiert. Immerhin bescheinigten die Frauen zu 24 Prozent ihrem Partner, Gefühle nachvollziehen zu können. Offensichtlich sind bei partnerschaftlichen Problemen beide Geschlechter zunächst vor allem mit ihren eigenen Gefühlen beschäftig, sodass es ihnen schwer fällt, die Emotionen des anderen nachzuvollziehen.
Quelle: http://www.usinger-anzeiger.de/ratgeber/frauen_familie_senioren/meldungen/11069500.htm (11-08-21)
Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften
Eine Studie von Faltin & Fatke (1997, S. 182) untersuchte die Qualitäten von Freundschaften im Geschlechtervergleich. Die Qualitäten von Freundschaften beinhalten die Variable Intimität, die sich aus den Items "sich anvertrauen", "Selbstoffenbarung" und "Selbstentblößung" zusammensetzt. Danach stellen beide Geschlechter hohe Ansprüche an die Intimität der Freundschaftsbeziehung , mit dem Unterschied, dass Intimität bei Männern eher an Grenzen stößt. Männer würden die Intimität mit höheren Gefahren und Kosten verbunden sehen. Als Folge von Intimität nannten die Interviewten Schalheit und Überdruss. Eine Rolle spielt auch die Befürchtung, dass eine Preisgabe intimer Informationen zu ihrem Schaden verwendet werden könnte. "Freundschaft scheint für einige Männer ein Ort zu sein, der analog zur Geschäftswelt und zu einer Welt des Kampfes strukturiert ist." In Frauenfreundschaften stellten sie hingegen eine größere Intimität fest. "Frauen stellen im Vergleich zu Männern höhere Ansprüche an Bindung, Intimität, Selbstenthüllung und emotionale Unterstützung in ihren Freundschaftsbeziehungen." Die Selbstenthüllung stellt für Männer vermutlich eine größere Schwierigkeit dar als für Frauen. Da diese ein wesentlicher Faktor für die Entstehung von Intimität und Vertrauen ist, wird deutlich, warum Männerfreundschaften nicht so intim sein können wie Frauenfreundschaften. Ein Dresdener Psychologieprofessor konstatierte: "Wenn meine Frau vom Tennis-Training nach Hause kommt, erfahre ich alles aus den Familien der Mitspielerinnen. Wenn ich zurückkomme, weiß ich oft nicht einmal, ob die anderen Männer verheiratet sind" (Stern 2001/4, S. 46).
Literatur: Valtin, Renate & Fatke, Reinhard (1997). Freundschaft und Liebe. Persönliche Beziehungen im Ost/West und im Geschlechtervergleich. Donauwörth: Auer.
Quelle: http://www.freundschaft-diplomarbeiten.de/ (06-02-02)
Single-Frauen sind glücklich, Single-Männer sind auf der Suche
Das Ergebnis der "Europäischen Single-Studie 2006" der Online-Partneragentur Parship zeigte, dass Männer das Single-Dasein anders bewältigen als Frauen, denn letztere sind meist mit ihrer Situation recht zufrieden, während allein lebende Männer aktiv nach einer Partnerin suchen. 18 Prozent der weiblichen Singles aus Österreich gaben an, "sehr zufrieden" zu sein, bei den Männern waren es nur elf Prozent. In England sagen sogar 28 Prozent der Frauen: "Ich bin ein vollkommen glücklicher Single." Am meisten leiden die romantischen Franzosen, denn nur sechs Prozent der Männer zählen sich zu den überzeugten allein Lebenden. "Frauen betrachten das Ende einer Beziehung häufig als Befreiung. Sie genießen ihr Single-Dasein bewusster als Männer", sagt Psychologin Sabine Wery. "Das starke Geschlecht hingegen empfindet es vielfach als eine Art Versagen, keine Partnerin zu haben, und forciert die Suche stark." Die Anzahl derjenigen, die besonders aktiv und zielstrebig nach einer Partnerin suchen, ist unter männlichen Singles mit 13 % fast doppelt so hoch wie unter den Frauen (7 %). Frauen seien zwar zu 60 % offen für eine Partnerschaft, ließen aber das Glück auf sich zukommen.
Siehe dazu die verschiedenen "Single-Typologien"
Quelle: OÖnachrichten vom 01.06.2006
Männer erkennen Seitensprünge früher als Frauen
Männer können nach einer US-Studie besser als Frauen erkennen, ob ihr Partner fremdgeht. Forscher der Virginia Commonwealth University (Richmond. USA) hatten Paare befragt. Diese sollten angeben, ob sie jemals fremdgegangen waren und ob sie Seitensprünge bei ihrem Partner vermuteten. Studien in den USA zeigten nun, dass Männer es auch früher als Frauen merken, wenn der Partner sie betrügt. 75 Prozent der Männer schöpfen in einer Beziehung Verdacht, wenn ihre Partnerin fremdgeht, hingegen verdächtigen nur 41 Prozent der Frauen ihre untreuen Partner. Männer liegen mit 90 Prozent zutreffenden Vermutungen gegenüber Frauen mit 80 Prozent auch öfter mit ihrem Verdacht richtig, allerdings haben Frauen deutlich mehr Grund für Misstrauen, denn sie werden öfter betrogen als Männer, wobei man jedoch davon ausgehen muss, dass Frauen Seitensprünge eher verschweigen.
Quelle: "New Scientist".
Frauen sieht man den Charakter an, Männern nicht
Psychologen der Universität Glasgow hatten tausend LeserInnen des britischen „Newscientist“-Magazins gebeten, ihre Passfotos einzusenden und ihre Persöönlichkeit in einem Fragebogen zu beschreiben: Je nachdem, wie humorvoll, glücklich, religiös, vertrauenswürdig sich die Einsender selbst einschätzten, wurden sie in Gruppen nach Männern und Frauen getrennt sortiert. Anschließend bekamen die Bilder elektronisch veränderte Kunstgesichter. An 6500 Leser wurde im Internet die Frage gestellt: Sehen Sie diesen Kunstgesichtern ihre Persönlichkeit an? Die Frauengesichter erwiesen sich für die Befragten als gut leserlich: 70 Prozent der TeilnehmerInnen fanden das Glücksgesicht auf Anhieb, 73 Prozent landeten einen Volltreffer bei der Religiosität, und ebenfalls die Mehrheit lag bei der Vertrauenswürdigkeit richtig, nur Humor waren in den weiblichen Gesichtern kaum zu erkennen. Bei den Männerbildern war hingegen die Persönlichkeit so gut wie nie aus der Miene heraus zu erkennen.
Aus Experimenten weiß man übrigens, dass Gesichter, die Zorn ausdrücken, männlicher wirken, spiegeln sie hingegen Angst, erscheinen sie wéuben Betrachter weiblicher. ProbandInnen mussten von einem Computer erzeugte Gesichter einem Geschlecht zuordnen, was ihnen leicht fiel, wenn die abgebildeten Frauen ängstlich oder fröhlich schauten und die Männer zornig. Länger brauchten die ProbandInnen, um ein zorniges Gesicht als weiblich und ein ängstliches oder fröhliches als männlich zu identifizieren. Auch bei der Gesichtererkennung spielen offensichtlich Geschlechtsstereotype eine gewichtige Rolle.
Übrigens: WissenschaftlerInnen an der Universität von Quebec (Kanada) ließen Versuchspersonen vom Computer erzeugten männlichen und weiblichen Gesichtenr dem richtigen Geschlecht zuzuordnen, wobei es den ProbandInnen leicht fiel, wenn die Frauen ängstlich oder fröhlich und die Männer zornig dreinschauten. Die Studienteilnehmer brauchten deutlich länger, ein zorniges Gesicht als weiblich und ein ängstliches oder fröhliches als männlich zu erkennen. Gesichter, die Zorn ausdrücken, wirken offensichtlich männlicher, spiegeln sie Angst, erscheinen sie weiblicher.
Quelle: http://www.welt.de/wissenschaft/psychologie/article3213974/Charakter-steht-der-Frau-ins-Gesicht-geschrieben.html (09-02-16)
Wenn Männer und Frauen nebeneinander schlafen …
Schlafstudien zeigen, dass 65 Prozent der Frauen unter Schlafstörungen leiden, aber nur rund 20 Prozent der Männer. Wiener Forscher fanden nun, dass Männer und Frauen beim Einschlafen und Schlafen grundsätzlich nicht gut zusammenpassen, denn Frauen schlafen mit einem Partner an ihrer Seite deutlich unruhiger und kommen insgesamt auf eine geringere Nettoschlafzeit. Bei Männern ist es umgekehrt, denn diese können deutlich besser ein- und durchschlafen, wenn eine Frau neben ihnen liegt. Wie der Verhaltensbiologe John Dittami mit Messgeräten zeigte, reagieren Frauen in ihrem Schlafverhalten auf die Anwesenheit eines Bettpartners wesentlich sensitiver als Männer. Man vermutet, dass die Schlafstörungen von Frauen evolutionär bedingt sind, denn der niedrigere Schwellenwert für Umweltreize sei deshalb notwendig, da sie für den Nachwuchs sorgen müssten. Männer besitzen diese Empfindlichkeit für Bewegungen des Nachwuchses nicht, sondern sie reagieren auf den Paarschlaf wie auf einen Gruppenschlaf in der Herde, in der sie sich besonders sicher fühlen.Vorteilhaft für beide Geschlechter sei dabei der Geschlechtsverkehr vor dem Schlafen, denn in den 67 Untersuchungsnächten, in denen sexueller Kontakt stattfand, wirkte sich das sowohl bei Frauen als auch bei Männern positiv auf den Schlaf aus.
Übrigens: Männer schnarchen auch deshalb mehr als Frauen, da nachts, wenn die Spannung der Rachenmuskeln nachlässt, Gaumensegel und Zäpfchen zu vibrieren beginnen. Das lliegt an der unterschiedlichen Beschaffenheit des Rachenraums bei Männern und Frauen, denn bei Männern ist der Rachen enger und sie besitzen eine weichere Muskulatur in diesem Bereich, was beides das Schnarchen begünstigt. Im Alter, wenn die Rachenmuskulatur allgemein bei allen Menschen erschlafft, gleichen sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aus und beide schnarchen gleich häufig.
Eine andere Erklärung findet sich hier: Warum Männer schlafloser sind als Frauen
Quelle: OÖnachrichten vom 08.09.2006 und vom 22.05.2007
Übrigens: Schlafforscher der Universität Loughborough haben festgestellt, dass Frauen im Durchschnitt 20 Minuten pro Nacht mehr Schlaf als Männer brauchen. Da Menschen, die ihrem natürlichen Schlafbedürfnis nachgeben und dem Gehirn genügend Erholung bieten, altern geistig langsamer, sodass im Durchschnitt der Gehirnzustand einer 75-jährigen Frau jenem eines 70-jährigen Mannes entspricht. Da die meisten Frauen gewohnheitsmäßig gleichzeitig mehrere Aufgaben erledigen und ihr Hirn dadurch auf komplexere Art belasten, braucht es eine längere Erholungsphase, d.h., mehr Schlaf. Allerdings haben Frauen auch öfter Schlafprobleme, da sie hellhöriger sind und weniger tief schlafen, wenn sie etwa im Schlaf auf Geräusche ihrer Kinder achten müssen. Auch Manager oder Wissenschaftler, die viele Entscheidungen treffen und komplex denken müssen, benötigen ebenfalls mehr Schlaf als Menschen mit anspruchsloseren Aufgaben.
Übrigens: Bei männlichen Gehirnen ist auch in den Ruhephasen ein Teil im Schläfenlappen aktiv, der zum limbischen System zählt. Diese Hirnregion ist entwicklungsgeschichtlich sehr alt - "Reptilienhirn" - und kontrolliert fundamentale Reaktionen wie Fressen, Fortpflanzung, Wutausbrüche und Kampf und Flucht. Bei den meisten Frauen hingegen sind in den Ruhephasen mehr die Neuronen der evolutionär jungen Großhirnrinde aktiv, wo viele der höheren, der Zivilisation förderlichen Gehirnfunktionen angesiedelt sind. Männer sind also auch in Ruhephasen stets aggressionsbereit und neigen möglicherweise auch deshalb eher zur Gewalt als Frauen.
Pankhurst, F.L. & Horne, J.A (1994). The influence of bed partners on movement during sleep. Sleep, 17, 305-315.
Kapoor, Pankhuri(2010). Women need 20 minutes' more sleep than men, suggests study.
WWW: http://www.themedguru.com/20100127/newsfeature/women-need-20-minutes-more-sleep-men-suggests-study-86131952.html (10-01-30)
Unterschiede im intelligenten Denken
Frauen und Männer mit dem gleichen Intelligenzquotienten aktivieren unterschiedliche Gehirnregionen. Besonders die graue und weiße Gehirnsubstanz sind unterschiedlich verteilt: So verfügen Frauen über zehn Mal mehr weiße Masse als Männer, in den Hirnen letzterer ist hingegen sieben Mal mehr graue Substanz als in jenen von Frauen. Die graue Substanz besteht überwiegend aus den Zellkörpern, die weiße Substanz dagegen aus den Ausläufern der Nervenzellen. Auch räumlich sind die Aktivitätszentren bei den beiden Geschlechtern unterschiedlich verteilt: Frauen aktivieren hauptsächlich den Frontallappen, während Männer neben dem Frontal- auch den Parietallappen beanspruchen. Es gibt also nicht eine einzige neuro-anatomische Grundlage für Intelligenz.
Quelle: science.ORF.at vom25.1.05.
Unterschiede in der Wahrnehmung von Gegenständen
Für eine Studie sollten sich männliche und weibliche Probanden Bilder von Blättern, Eulen, Schmetterlingen, Watvögeln, Pilzen, Autos, Flugzeugen und Motorrädern einprägen. Danach mussten sie diese Bilder unter ähnlichen, aber unbekannten Bildern derselben Kategorien wiedererkennen. Nach dem gleichen Prinzip führten die Forscher anschließend Wiedererkennungstests mit Gesichtern durch, bei denen sich zeigte, dass die besten Autoerkenner und Vogelspezialistinnen gleichzeitig auch die erfolgreichsten Kandidaten bei Wiedererkennungstests von Gesichtern waren. Dies ist nach Ansicht der Wissenschaftler insofern überraschend, da bisher angenommen worden war, dass die Wahrnehmung von Gesichtern anders funktioniert als die von Objekten. Man vermutet hinter den geschlechtsspezifischen Wahrnehmungsfähigkeiten Grundinteressen, in denen sich Männern und Frauen unterscheiden.
Unterschiede im Tastsinn: Frauen haben mehr Fingerspitzengefühl
Frauen haben nach neueren Erkenntnissen mehr Fingerspitzengefühl, da ihre Hände bzw. Finger im Durchschnitt kleiner sind, und je kleiner die Fingerspitze, desto feinere Strukturen können auf einer Oberfläche erkannt werden. Auf den Fingerspitzen gleichaltriger Menschen ist die Zahl der Merkel-Zellen (Nervenzellen, die den Druck wahrnehmen und um die Schweißporen verteilt sind) ähnlich hoch, damit sitzen diese Sensoren auf kleinen Fingern besonders dicht beieinander und liefern dem Gehirn daher mehr detaillierte Eindrücke.
Unterschiede in mathematischen Fähigkeiten?
Eine Reanalyse PISA-Studie von 2003, in der die Ergebnisse von 270.000 SchülerInnen zeigte, dass Mädchen in der Mathematik insgesamt durchschnittlich etwas schlechtere Leistungen erbracht hatten als die Jungen, aber die Resultate spiegelten vor allem den Einfluss kultureller Unterschiede wider: Auf dem letzten Platz landete die Türkei, wo die Mädchen in der Mathematik 22,6 weniger Punkte erreichten, in den skandinavischen Ländern war praktisch kein Unterschied mehr vorhanden, und in Island schnitten die Mädchen sogar um 14,5 Punkte besser ab. Der Vergleich mit Indices zur Chancengleichheit in den verschiedenen Ländern zeigte eine deutliche Korrelation: Je emanzipierter die Frauen in einem Staat, desto besser können die Mädchen rechnen. Eine aktuelle Untersuchung aus den USA von Janet S. Hyde (University of Wisconsin, University of California) verglich die Leistungsdaten von mehr als sieben Millionen SchülerInnen aus zehn verschiedenen US-Staaten. Das Resultat: Mädchen und Jungen sind praktisch gleich gut in Mathematik.
Nicole Else-Quest analysierte 2009 ebenfalls die beinahe 500000 Datensätze der TIMSS- und der Pisa-Studie von 2003 aus 69 Ländern, wobei die Ergebnisse zeigen, dass Mädchen die gleiche Leistung bringen wie Knaben, wenn sie die richtige pädagogische Unterstützung bekommen und sich an weiblichen Vorbildern orientieren können. Männliche Jugendliche bringen zwar in der Regel bessere Leistungen, was aber an den stärkerem Selbstbewusstsein und der Überzeugung, dass Mathematik später für den Beruf wichtig sei, liegt. Unterschiede zwischen den Geschlechtern differierten von Land zu Land erheblich, da die Stellung der Frau in der Gesellschaft und ihr Lebensstandard eine große Rolle spielen. In Ländern, in denen Frauen wichtige Funktionen im Bereich der Wissenschaft übernehmen, zeigen auch Mädchen bessere mathematische Fähigkeiten. Die Analyse von englischsprachigen wissenschaftlichen Arbeiten zwischen 1990 und 2007, in denen mathematische Fähigkeiten von Männern und Frauen verschiedenen Alters, von der Grund- bis zur Oberschule und darüber hinaus, vergleichen worden waren, und die Ergebnisse mehrerer Langzeitstudien ergab, dass die Unterschiede in den Rechenleistungen zwischen den Geschlechtern sehr gering waren. Offensichtlich haben beide Geschlechter annähernd gleiche mathematische Fähigkeiten, doch dringt diese Erkenntnis nur langsam zu LehrerInnen und Eltern durch, denn diese senden unterschwellige Botschaften, welche Leistungen sie von jungen Mädchen oder Buben in welchen Fächern erwarten, was einen ernormen Einfluss auf ihre eigene Meinung von ihren Fähigkeiten hat.
Literatur
Else-Quest, Nicole M., Hyde, Janet Shibley & Linn, Marcia C. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 103-127.
Unterschied beim räumlichen Orientierungsvermögen zwischen den Geschlechtern auch bei Hunden
Müller et al. studierten am Beispiel Hund, ob es bei Säugetieren geschlechtsbedingte Wahrnehmungsunterschiede gibt. Dafür ließen sie in einem Experiment 50 Hunde (je 25 weibliche und 25 männliche) zwischen den Beinen ihres Herrchens Platz nehmen. Während die Hundebesitzer mit verbundenen Augen dasaßen, konnten die Tiere beobachten, wie ein blauer Ball vor ihren Augen dahinrollte, kurz hinter einem Sichtschirm verschwand und jedes zweite Mal gegen einen doppelt so großen ausgetauscht wurde. Männliche Hunde schauten im Durchschnitt 17 Sekunden dem wiederaufgetauchten Ball nach, ganz egal, ob er nun seine Größe änderte oder nicht. Hündinnen hingegen schenkten dem normalen Ball nur etwa 11 Sekunden Aufmerksamkeit, war der Ball doppelt so groß, schauten sie ihm 35 Sekunden nach.
Müller, C. A., Mayer, C., Dörrenberg, S., Huber, L. & Range, F. (2011). Female but not male dogs respond to a size constancy violation. Biol Lett 2011 : rsbl.2011.0287v1-rsbl20110287.
Geschlechtsunterschiede in der Gehirngröße bei Singvögeln
Bisher dachte man, dass die Geschlechtsunterschiede beim Gesangsverhalten sich im Gehirn der Tiere widerspiegeln, wobei man dies bei den Arten, bei denen sich auch das Gesangsverhalten stark unterscheide bzw. bei denen nur die Männchen singen, auf Strukturunterschiede im Gehirn von Männchen und Weibchen zurückführte. Bei Untersuchungen zeigte sich aber ein vom sozialen Status abhängiger Geschlechtsunterschied, denn die dominanten Männchen hatten ein fast dreimal so großes Gesangszentrum wie die weiblichen Tiere. Verglichen sie jedoch subdominante Männchen mit Weibchen, die beide denselben Duettgesang singen, so war der männliche Gehirnabschnitt immer noch doppelt so groß wie der weibliche. Die Größenunterschiede kommen hauptsächlich durch eine höhere Anzahl von Nervenzellen in diesen Arealen zustande, wobei sich keinerlei Geschlechtsunterschiede in jener Region feststellen ließ, die beim Gesangslernen eine Rolle spielt.
Quelle:
http://www.mpg.de/4337884/gehirngroesse_bei_singvoegeln?filter_order=L (11-06-11)
Sprechen Frauen mehr als Männer?
Die Ergebnisse einer Studie, in der 400 Teilnehmer mit tragbaren Aufnahmegeräten ausgestattet worden waren zeigte, dass zwar Frauen im Durchschnitt 16 215 Wörter gegenüber 15 669 Worten bei Männern pro Tag äußern, was aber eine angesichts der hohen individuellen Unterschiede statistisch nicht signifikant ist.
Quelle:
Naica-Loebell, Andrea (2008). Frauen können Mathe, Männer auch.
WWW:http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28408/1.html (08-08-08)
Unterschiede beim Ausziehen der Oberbekleidung
Männer und Frauen unterscheiden sich auch in der Choreografie der Textilentledigung grundlegend: Eine Frau kreuzt die Arme bäuchlings und lüpft, ein Mann fasst die Wäsche rücklings und rupft. Sie macht es aufrecht, er eher buckelnd. Die beim Ausziehen eingenommene Demutshaltung der Männer dient in der Tat der Unterwerfung und gleichzeitig dem Schutz des Gemächts. Die Frauen hingegen bleiben ungebeugt und senken ihren Blick nicht, denn so können sie ihr Gegenüber länger im Auge behalten und gegebenenfalls schnell flüchten. Daher knickst die Frau bei Hofe auch, da die Herrschaft jederzeit handanlegend maßregeln könnte.
Quelle: OÖN vom 29.11.2008
 Frauen sind grün, Männer rot
Frauen sind grün, Männer rot
Michael J. Tarr & Adrian Nestor (Brown-Universität in Providence, Rhode Island) mischte 200 Gesichter von Menschen beiderlei Geschlechts digital und erstellte daraus ein androgynes Durchschnittsgesicht. Darüber wurde ein bewusst kaum wahrnehmbares grünes und rotes Farbrauschen gelegt, Testpersonen sollten beurteilen, welches weiblich und welches männlich ist. Die Probanden sagten mehrheitlich, dass das grüne Gesicht weiblich und das rote männlich ist. In einer Farbanalyse weiterer normaler Gesichtsfotos bestätigte sich, dass Männergesichter etwas mehr Rottöne enthalten, Frauengesichter etwas mehr Grüntöne.
In einem weiteren, eher kurios anmutenden Versuch ließ Michael Slepian seine ProbandInnen ebenfalls mittels Bildbearbeitung auf ein geschlechtsneutrales Aussehen getrimmte Gesichter nach ihrem Geschlecht einschätzen, drückte seinen ProbandInnen aber entweder einen weichen oder einen harten Ball in die Hand, und ließ sie während der Betrachtung der Bilder durch drücken des Balles angeben, ob die jeweils gezeigte Person ein Mann oder eine Frau wäre. VersuchsteilnehmerInnen, die einen weichen Ball in der Hand gehabt hatten, hielten die abgebildeten Gesichter tendenziell für eher weiblich, während die dieselben Gesichter mit einem harten Ball in der Hand eher als männlich wahrgenommen wurden. Offensichtlich spielt das Gefühl, das man beim Halten von etwas Hartem oder Weichem hat, ebenfalls die Gesichtswahrnehmung beeinflussen kann.
Quellen: http://www.physorg.com/news147955343.html (08-12-11)
http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/2008/maleorfemale.jpg (08-12-11)
Mädchen haben einen feineren Geschmackssinn und Geruchssinn als Buben
Eine Studie der Universität Kopenhagen an 8900 Kindern ab dem Grundschulalter zum Geschmacksempfinden zeigte, dass Mädchen sowohl süße als auch saure Nuancen bei Lebensmitteln besser erkennen können als gleichaltrige Burschen. Deren Fähigkeit zum Differenzieren von Lebensmitteln ist bei Saurem um etwa zehn Prozent und bei Süßem sogar um 20 Prozent schwächer ausgeprägt. Die größere Sensibilität der Mädchen basiert vermutlich nicht auf der Zahl der Geschmacksknospen im Mundraum, sondern auf der Signalverarbeitung im Gehirn. Mit steigendem Alter verfeinert sich der Geschmackssinn bei Kindern geerell.
Mädchen reagieren nach der Pubertät sensibler auf Gerüche als zuvor. Das ergaben Versuche der Uni Dresden. Während Buben und Mädchen mit zehn Jahren Gerüche noch gleich wahrnehmen, geraten 17- bis 20-jährige Frauen bei Wohlgerüchen in Verzückung und rümpfen bei Gestank die Nase. Junge Männer interessieren sich kaum für Düfte.
Quelle: OÖN vom 8.1.2009 und vom 17.4.2009
Durch die Ehe werden Wissenschaftler unkreativ
Satoshi Kanazawa erforschte die Lebensläufe von 280 kreativen und erfolgreichen Wissenschaftlern und stellte dabei fest, dass den Gelehrten ihre wichtigsten Beiträge vor allem in ihrem ungebundenen Jahren gelang, wobei das Alter der Wissenschaftler dabei keine Rolle spielte, denn einige ereichten noch bis ins hohe Alter Spitzenleistungen. Solche Spitzenleistungen gehören nach der Heirat der Vergangenheit an und die WissenschaftlerInnen wurden lediglich mittelmäßige Forscher. Die Ursache für den Leistungsabfall sieht der Forscher in der Evolution der Menschhei begründet, denn Männer sind nur so lange Kreativ und im Beruf voller Tatendrang, um Frauen zu beeindrucken. Nach der Gründung einer Familie läßt dieser Elan nach und andere Gefühle und Verhaltensweisen wie etwa der Schutz der Familie treten in den Vordergrund.
Die Männer beteuern immer, sie lieben die innere Schönheit der Frau –
komischerweise gucken sie aber ganz woanders hin.
Marlene Dietrich
Schönheit erhöht Reproduktionsrate stärker bei Frauen als bei Männern
Markus Jokela hat die Fotografien von 1244 Frauen und 997 Männern der Wisconsin-Longitudinalstudie analysiert. Diese Männer und Frauen wurden zwischen 1937 und 1940 geboren, wobei ihre Fotos im Alter rund um 18 angefertigt worden waren. Bei den Frauen gab es einen positiven Zusammenhang zwischen der den Personen zugeschriebenen Attraktivität und der Reproduktionsrate, d.h., Frauen, die auf den Fotos als überdurchschnittlich schön beurteilt wurden, bekamen signifikant mehr Kinder als weniger gut aussehende Frauen. Die besonders schönen hatten sechs Prozent mehr Nachwuchs und die zweitschönsten um 16 Prozent mehr als die weniger attraktiven. Bei den Männern hatten nur die besonders unattraktiven weniger Kinder, und zwar um 13 Prozent als der Rest, ansonsten unterschieden sich die Männer nicht in ihrem reproduktiven Erfolg. Für diesen Zusammenhang von Attraktivität und Fruchtbarkeit gibt es mehrere Erklärungen: Attraktivität könnte mit einem stärkeren Kinderwunsch in Beziehung stehen. Sie könnte aber auch die Kriterien der Partnerwahl verändern oder die Zuschreibung beeinflussen, ob jemand als potenzieller Vater oder potenzielle Mutter erachtet wird.
Quelle: Klaus Taschwer (2009). DER STANDARD, Printausgabe, 30. 7. 2009.
Weinen und Geschlecht
Bis zum 13. Lebensjahr weinen Buben und Mädchen noch ungefähr gleich häufig, später weinen Männer 6 bis 17 Mal pro Jahr, Frauen hingegen 30 bis 64 Mal, wobei diese dabei auch ausdauernder sind, denn sie weinen sechs Minuten lang, während Männer es maximal auf vier Minuten bringen. Weinen geht auch nur bei 6 Prozent der Männer in Schluchzen über, bei Frauen jedoch in 65 Prozent, wodurch weibliches Weinen länger, dramatischer und herzzerreißender wirkt. Frauen weinen am ehesten, wenn sie sich unzulänglich fühlen, vor schwer lösbaren Konflikten stehen oder sich an vergangene Zeiten erinnern, Männer hingegen weinen häufig aus Mitgefühl oder wenn die eigene Beziehung gescheitert ist.
Silvesterraketen
Nach Ansicht des Psychologen Alfred Gebert mögen Männer und Frauen unterschiedliche Silvesterraketen denn Männer lieben alles, was laut knallt, während Frauen mehr auf Glitzerfontänen, Goldregen oder Leuchtkugeln stehen. Der Unterschied zwischen dem, was Männer und Frauen für Silvesterknaller ausgeben, ist allerdings nicht nicht riesengroß. Männer suchen Feuerwerkskörper aus, die laut knallen und Lärm machen, Frauen hingegen solche, die schön aussehen. Männer wollen beim Abschießen außerdem den Reiz des Risikos, während eine Frau gar nicht auf diese Idee kommt. Männer denken für den Moment: Wenn sie an Silvester draußen in der Kälte stehen und es knallt, dann genießen sie diesen Moment, denn Männer leben im Hier und Jetzt, während Frauen eher auf Planung und Vorausschau bedacht sind. Frauen sind durch die Erziehung immer noch höflicher und zurückhaltender, sie nehmen auch mehr Rücksicht auf andere, d.h., das alte Rollenmuster schlägt auch bei diesen Dingen immer noch durch.
Frauen wechseln häufiger ihre Profilfotos in Social Networks
Einer nicht näher bezeichnete Untersuchung zufolge gibt es einen Unterschied nach Geschlechtern, wie oft Fotos in den persönlichen Profilen verändert werden, wobei Frauen deutlich schneller beim 'update' sind als Männer. Während Männer alle drei Wochen ein neues Profilfoto einsetzen, wird bei Frauen schon alle zwei Wochen gewechselt. Die Daten zeigen allerdings nur den Durchschnitt, denn es gibt bei Männern wie Frauen solche, die fast täglich neue Fotos verwenden und andere, die ein Bild das ganze Leben verwenden.
Empfehlenswerte Bücher zum Thema
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::




