Stress und andere psychologische Merkmale
- Definitionen, Klassifikationen, Messung, Erhebung, psychophysiologische Störungen etc.
- Definition Stress
- Klassische Stresstheorien
- Stress und andere psychologische Merkmale
- Persönlichkeitsvariablen im Zusammenhang mit physiologischen Variablen
- Typische Stressmerkmale
- Stress und Psychosomatik
- Stressforschung
- Stress und Gedächtnis
- Test der Stressbelastung
- Mit Stress leben
- Stress und Person
- Stressbewältigung beim Lernen und Studieren
- Methoden der Stressbewältigung
Wie gehen Sie in stressigen Zeiten
mit sich selber um?
Finden Sie es gleich heraus
mit dem neuen

SAT-Test
Persönlichkeitsvariablen im Zusammenhang mit physiologischen Variablen
Extraversion und Introversion
Bei zunehmender Stärke von akustischen Reizen nach vorangegangenem Stress nahm die Hautleitfähigkeit bei Exravertierten ab und bei den Introvertierten nicht. Bei leisen akustischen Signalen ohne Stressinduktion nahm die SCR (Hautleitfähigkeitsreaktion) bei allen Introvertierten zu. Bei mittlerer Aktivierung gab es keine Unterschiede hinsichtlich der SCR bei Extravertierten und Introvertierten. Introvertierte zeigten nach Schönpflug und Schulz eine größere Selbstbetroffenheit durch Stress, verstärkte eigene Anspannung und stärkere physiologische Reaktionswerte als Extravertierte. Extravertierte schreiben Mißerfolge eher externen Einflüssen zu, welches eine stressentlastende Wirkung innehat.
Feldabhängigkeit versus Feldunabhängigkeit und physiologische Reaktionen
- Feldabhängigkeit (FA) = Flucht und Verleugnung bei Stress.
- Feldunabhängigkeit (FU) = Intellektualisierung und Situationsstellung.
Bei unmöglicher Stressvermeidung (aversive Bildinhalte konnten nicht abgeschaltet werden) zeigten die FA schwächer ausgeprägte Senkung der HF als FU, die eine markante HF-Senkung zeigten. Bei möglicher Stressvermeidung zeigten die FA einen erneuten HR-Abfall, während die FU mit einer Erhöhung der HR reagierten.
Erklärung: FU verfügen über einen Verarbeitungsstil und stärkerer Differenzierung der Situation und weisen dementsprechend abgestuftere physiologische Reaktionen auf.
Trait-Anxiety
Als Folge eines Teufelskreislaufes neigen angstdisponierte Personen zu einer erhöhten Stressreaktivität. Als Maß können die Muskelaktionspotentiale, die EDA und die Fingermotorik angesehen werden. Erläuterung des Teufelskreislaufes: Es werden Stressoren als Bedrohung wahrgenommen. Infolge kommt es zur Angst. Weiterhin bekommen die Personen weiche Knie. Diese physiologische Reaktion wird wahrgenommen und interpretiert. Die Folge ist eine Verstärkung der Angst, welches wiederum die physiologischen Reaktionen verstärkt usw. Der Teufelskreis aus Kognitionen und physiologischen Reaktionen ist entstanden.
Represser und Sensitizer
Der Represser verleugnet Angst, weist eine übertrieben positive Selbst- und Fremdeinschätzung auf und reagiert im Sinne der sozialen Erwünschtheit. Der Sensitizer wittert überall Angstauslöser und will sich diesen aktiv entgegenstellen. Represser zeigen eine erhöhte SRR-Frequenz, gesteigerte Aggressivität und motorische Erregtheit.Sensitizer zeigen eine niedrige SRR-Frequenz.
Kritik: Die Angstskalen erfassen möglicherweise eher defensive Bewältigungsformen als Zustände der Angst.
Yin Bun Cheung (Singapur) wertete die Daten von 9000 Briten im Alter von 42 Jahren aus und verglich das Ausmaß ihrer psychischen Probleme mit ihrem Geburtsgewicht, dem Wachstum bis zum Alter von sieben Jahren und Faktoren wie dem sozialen Status des Vaters. Es zeigte sich, daß Menschen mit geringem Geburtsgewicht und mit geringer Gewichtszunahme deutlich häufiger unter psychischem Stress litten als Menschen mit "gewichtigerem" Vorleben (British Medical Journal, 325, S. 749).Weitere mit Stress in Zusammenhang gebrachten Krankheiten und Beeinträchtigungen sind Konzentrationsstörungen, Nervosität, Depressivität, Angst, Schlafstörungen, Migräne, Muskelverspannungen, Allergien, Gefäßerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Asthma, Suchtkrankheiten wie Alkohol- und Medikamentenmissbrauch.
In letzter Zeit wird diese Liste immer häufiger ergänzt durch das sogenannte Chronische Erschöpfungssyndrom (Chronique Fatique Syndrom, CFS), bei dem vielfältige körperliche Beschwerden mit massiven Konzentrationsstörungen, allgemeiner Leistungs- und Antriebsschwäche und einer ständigen, starken Müdigkeit einhergehen.
Es gilt heute als erwiesen, dass nichtbewältigter Stress vor allem auf längere Sicht die Gesundheit beeinträchtigt und das Auftreten von Krankheiten begünstigt, allerding ist die Frage, auf welchem Wege dies geschieht, noch weitgehend unbeantwortet. Die von Selye aus den Ergebnissen seiner Tierversuche abgeleitete These, dass zwischen Reizhäufigkeit, Reizintensität und gesundheitlicher Beeinträchtigung ein direkter kausaler Zusammenhang besteht, scheint zwar für physischen Stress (Lärm, extreme Temperatur-schwankungen, Umweltgifte etc.) zuzutreffen, bei psychischem Stress sind die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aber wesentlich komplizierter. Vermutlich ist jeder Mensch nur begrenzt dazu in der Lage, langanhaltende, starke psychische Belastungen völlig ohne gesundheitliche Schädigung zu ertragen.
Nach Aussagen von Immunologen gibt es eine wachsende wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass starker und chronischer Stress direkt das Immunsystem schwächt und so unmittelbar zu gesundheitlichen Störungen führt oder den Verlauf bestehender Krankheiten negativ beeinflusst. Ein zehnwöchiges therapeutisches Antistresstraining bei Frauen mit Brustkrebs führte zu deutlich verbesserten Cortisol- und Immunwerten. Stressbefunde gibt es auch in der Herzmedizin, wonach akuter Stress die Blutgefäße blockiert und zur Plaquebildung beiträgt. Während 80 Prozent aller Menschen mit Helicobacter keine Magengeschwüre entwickeln, zeigt gleichzeitig jeder dritte Ulkuspatient keinerlei Helicobacterspuren. Stress kann somit die Entwicklung eines Magengeschwürs ebenso fördern wie seine Heilung beeinträchtigen.
Wichtig in diesem Zusammenhang scheint auch die Tatsache, daß Stressoren und Stressreaktionen auf längere Sicht bei vielen Menschen zu kritischen Veränderungen ihres Gesundheitsverhaltens führen und damit auch indirekt das psychosomatische Erkrankungsrisiko erhöhen:
- schneller Griff zu "alltäglichen Beruhigungsmitteln" wie Zigaretten, Alkohol, Schlafmittel;
- nicht genügend Zeit für Erholungspausen, unregelmäßige Einnahme der Mahlzeiten und unausgewogene Zusammensetzung der Nahrung (fast food);
- zu wenig Schlaf;
- zu wenig Bewegung (Freizeitaktivitäten, Ausgleichssport).
Durch eine solche gesundheitsabträgliche Lebensweise verursachte Erkrankungen vermindern nicht nur die eigenen Leistungsmöglichkeiten und setzen damit die persönliche Belastbarkeit und Stresstoleranz herab, sie wirken auch ihrerseits wieder als belastendes Lebensereignis und Stresssituation. Es entsteht ein Teufelskreis, bei dem Ursache und Wirkung bald nicht mehr voneinander zu trennen sind. Man fühlt sich unsicher, nervös, gereizt, emotional angespannt, innerlich unausgeglichen, häufigen und starken Stimmungsschwankungen zwischen Euphorie und Depression ausgesetzt, kann nicht mehr klar denken, fühlt sich getrieben und gehetzt. Man merkt, daß einem die Kontrolle über sich selbst zu entgleiten droht und fühlt sich gleichzeitig hilflos. Man weiß, daß man anderen gegenüber aggressiver und ungeduldiger reagiert als früher und damit zwischenmenschliche Beziehungen aufs Spiel setzt. Viele verlieren auch das Vertrauen in die eigene Kraft und Leistungsfähigkeit, Welt- und Selbstsicht werden zunehmend pessimistischer. Die Lebensfreude geht verloren. Das Selbstwertgefühl wird instabil. Ängste nehmen mehr und mehr zu (vor beruflichem Mißerfolg, von anderen als Versager angesehen zu werden, vom Partner verlassen zu werden etc.). Das Endstadium sind dann Verzweiflung, Depression, Gefühle völliger Hilflosigkeit, manchmal sogar Selbstmordgedanken.
Je länger solche Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens anhalten und je weniger Hoffnungen die betroffene Person hat, daß die auslösenden Umstände sich in absehbarer Zeit ins Positive verändern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie irgendwann auch organisch erkranken wird. In manchen Fällen scheint es, als habe sich der Organismus auf diese Weise eine Erholungspause erzwingen und gleichzeitig ein eindeutiges Warnsignal geben wollen. Werden solche Warnsignale ignoriert manifestiert sich u. U. sogar eine Tendenz zur Selbstzerstörung, daß sich die betroffene Person zu "tot arbeitet", der in Japan als "Karoshi" bezeichnet wird.
Quelle:
http://members.chello.at/guenther.holmann/stress/stress.doc (03-01-24)
Hören Sie hinein in die neueste Folge unseres Podcasts:
Empfehlen Sie unsere Podcasts weiter!
Stress und Sprache
Stresssymptome verbergen sich auch im Sprachgebrauch. Die links stehende Abbildung weist auf verschiedene Ausdrücke aus dem "Volksmund" hin, die körperlichen Reaktionen und Zusammenhänge bei Stress beschreiben.
Auf der Website des Diplompsychologen Mark Kefel (![]() www.stress-kurs.de) finden sich in Form eines "virtuellen Stress-Kurses" zahlreiche nützliche Informationen zum Thema Stress und Stressbewältigung.
www.stress-kurs.de) finden sich in Form eines "virtuellen Stress-Kurses" zahlreiche nützliche Informationen zum Thema Stress und Stressbewältigung.
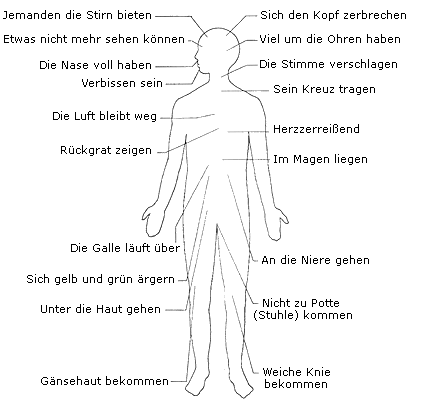
Bildquelle: IG Metall (Hg.), Mobbing, Frankfurt/M. 1997
WWW: http://www.sozialnetz.de/ (06-03-07)
Stress und Musik
Der Linzer Psychologe Rainer Holzinger, Musikpädagoge an der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz, betont die Bedeutung von Musik bei der Entspannung und Stressbewältigung. Musik stimuliert den Nervus vagus bei Mensch und Tier, wobei dieser Nerv die Aktivität der inneren Organe reguliert, indem sie entweder belebt oder beruhigt. Welche der beiden Wirkungen erwünscht ist, hängt von der Befindlichkeit ab. Musikhören kann helfen, die Stimmung in den optimalen Bereich zu bringen. In der Regel gilt: Ruhige Musik holt das vegetative System "herunter". Laut Holzingers Erfahrungen ist klassische Musik nicht unbedingt zur Entstressung geeignet, denn eine klassische Sinfonie hat sowohl beruhigende als auch erregende Momente. Gute Erfahrungen hat der Psychologie in seiner Praxis auch mit langsamen Sätzen von Vivaldi-Flötenkonzerten gemacht oder aus Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur. Holzinger: "Wichtig beim Musikhören ist, dass man schon in etwa vorwegnehmen kann, wie sich der nächste Ton gestalten wird. Wenn er dann kommt, ist das wie eine Belohnung fürs Gemüt."
Er gibt einige praktische Tipps zur Auswahl der richtigen Musik:
- Musik, bei der Gesang im Vordergrund steht, ist zur Entspannung eher ungeeignet. Sie wirkt besonders auf der rational-analytischen Ebene, das vegetative System bleibt davon unberührt.
- Der Takt sollte gleichmäßig und langsam sein. Experten empfehlen eine Taktfrequenz, die etwas unterhalb der Schlagfrequenz des Herzens liegt (70 Schläge pro Minute).
- Sehr wirksam zum Entspannen ist Meditationsmusik. Allein schon Titel wie "Sich der Liebe öffnen" oder "Kreativ sein" schaffen eine positive Erwartungshaltung. Wichtig: Der Hörer muss sich ganz "hingeben"!
- Empfehlenswert sind Musikstücke mit sphärischem, hallendem Klang. Außerdem haben Instrumente, die der Tonlage der menschlichen Stimme ähneln (Cello, Oboe), eine beruhigende Wirkung auf den Körper.
Patrik N. Juslin (Universität Uppsala) beobachtete seine ProbandInnen zwei Wochen zum Einfluss von Musik auf deren Gefühle, wobei diese auf einem kleinen Handheld, der mehrmals täglich einen Signalton abgab, einige Fragen zu der sie eventuell gerade umgebenden Musik und zu ihren Gefühlen beantworten mussten. In 37 Prozent der über 2000 Fälle wurde Musik gehört, in 64 Prozent dieser Zeiten mit Musik gaben die ProbandInnen positive Emotionen wie Freude und Sehnsucht zu Protokoll, die mit Musik häufiger vorkamen als negative und auch häufiger auftraten als ohne Musik. Ärger, Angst und Langeweile hingegen breiteten sich ohne Musik stärker aus. Glück, Vergnügen aber auch Ärger traten hingegen oft dann auf, wenn die Probanden mit Freunden oder Bekannten zusammen waren. Ruhe, Sehnsucht, Nostalgie, Traurigkeit und Melancholie traten indessen eher auf, wenn die Person allein war.
Thomas Biegl (Institut für Psychologie, Universität Wien) hat in einer Untersuchung festgestellt, dass der menschliche Körper beim Singen vermehrt Botenstoffe wie Serotonin, Noradrenalin, Adrenalin und das Beta-Endorphin ausschüttet. Auch das Allgemeinempfinden der Probanden hatte sich durchs Singen verbessert. Menschen, die etwa in Chören singen, wissen, dass Singen eine euphorisierende Wirkung haben kann. Die Wirkung von Singen betrifft besonders das vegetative Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus), das für die autonomen, nicht vom Willen gesteuerten Vorgänge im Körper wie Atmen, Herzschlag und Verdauung verantwortlich ist. Der Sympathikus ist für Aktivität, Leistung und Stressbewältigung und damit etwa für eine Steigerung etwa der Atem- oder Herzfrequenz zuständig ist, der Parasympathikus hingegen sorgt für Beruhigung, Entspannung und Erholung. Indem Singen auf dieses System wirkt wird Stress abgebaut. Da im Umgang mit der eigenen Stimme Synchronisation, Koordination und Ergonomisierung von Haltung, Atmung und Bewegung erforderlich ist, kann über Musik und Musiktherapie ein aus dem Lot geratener Organismus wieder stabilisiert werden.
Quellen:
OÖN vom 4. April 2007
DER STANDARD, 22.12.2008
|
|
|||
Kognitive Ebene
|
|
|
Vegetativ-hormonelle Ebene
|
|
|
|
||
Emotionale Ebene
|
|
|
Muskuläre Ebene
|
|
|
Stress und Psychosomatik
Seitdem auch die Paradeerklärung für Stressfolgen, das Magengeschwür, durch die Entdeckung des Helicobacter pylori ins Wanken geraten war, wurde der häufig auch von Laien angenommene Zusammenhang zwischen Stress und Krankheiten bzw. Krankheitsneigungen in Studien weiter erschüttert: Hodel & Grob (1993) unterzogen die bis 1993 erschienenen empirischen Studien zur Psychoimmulologie einer Metaanalyse und kamen zum Schluss, dass die oft vertretene Hypothese, dass Stress das Immunsystem schwache und dadurch eine größere Zahl von Erkrankungen auftrete, auf Basis der verfügbaren Daten weder bestätigt noch bestritten werden kann, und dass die berichteten Ergebnisse auch immer andere Interpretationen erlauben. Myrteks (2001) Metaanalyse Koronarerkrankungen umfasste alle prospektiven Studien bis Ende 1998. Sein Fazit: Es gibt keine signifikante Beziehung zwischen Typ-A-Persönlichkeit und koronaren Herzerkrankungen. Die Beziehung zwischen koronaren Herzerkrankungen und Feindseligkeit ist zwar statistisch signifikant, aber die Effektstärke ist zu gering, als dass ihr praktische Bedeutung zukäme.
Hodel, L. & Grob, P. J. (1993). Psyche und Immunität. Schweizer Medizinsiche Wochenschrift, 11. Dez., 123 (49), S. 323-341.
Myrtek, M. (2001). Meta-analyses of prospective studies on coronary heart disease, type A personality, and hostility. International Journal of Cardiology, 79 (2-3), p. 245-251.
Stress und Gedächtnis
David Beversdorf und Jessa Alexander (University of Ohio, Columbus) prüften bei 19 Studenten das Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Aufgabenstellungen zu lösen. Die Tests fanden jeweils direkt vor einem Universitätsexamen statt und wurden eine Woche nach dem Examen wiederholt. Vor dem Examen schnitten die Studenten gut bei Gedächtnistests ab, konnten jedoch schlechter komplizierte Aufgaben lösen. Eine Woche nach der Universitätsprüfung, als die Studenten weniger gestresst waren, schnitten sie weniger gut in den Erinnerungstests ab, waren aber besser in den Aufgaben, in denen sie bestimmte Probleme lösen sollten. Prüfungsangst bzw. Stress vor Prüfungen kann daher auch helfen, sich Fakten besser zu merken. Die Fähigkeit, komplizierte Aufgaben zu lösen, nimmt in Stresssituationen allerdings ab, sodass Prüfungen mit einem hohen Anspruch an das Problemlöseverhalten schlechter ausfallen als solche Prüfungen, die ein bloßes Reproduzieren verlangen.
Quelle: http://web.sfn.org/ (05-03-27)
Eis in Schrecksituationen wirksamer als Schokolade
Im Hirnforschungslabor der Universität Wien (Peter Walla) bekamen 20 Testpersonen Eis, Joghurt, Schokolade und gar kein Nahrungsmittel serviert, während man sie akustischen Schreckreizen aussetzte. Dabei wurde das Zucken der Augenlider (Schreckreflex) gemessen, wobei je positiver die Stimmungslage, desto geringer fällt der Reflex aus. Es sollte geprüft werdeb, welche Nahrungsmittel in einer Schrecksituation hemmend auf die Stimmungslage wirken. Eisgenuss sorgte in dieser Untersuchungssituation für den geringesten Reflex, gefolgt von Joghurt und Schokolade.
Quelle:
OÖnachrichten vom 14.06.2006
Stress und Darmflora
Australische Wissenschaftler untersuchten bei Studenten die Aktivität von Milchsäurebakterien im Darm sowie die Konzentration des Stresshormons Kortisol im Speichel. Diese Werte wurden sowohl zum Semesterbeginn als auch während der Prüfungsphase erhoben. Es zeigte sich, dass bei erhöhtem Stress die Zahl der Milchsäurebakterien zurückgeht, wobei eine Reduktion dieser Keime mit Magen-Darm-Infektionen in Verbindung gebracht wird.
Quelle:
OÖnachrichten vom 25.3.2008
Stress macht alt
Elissa Epel (University of California) konnte erstmals psychischen Stress direkt in Zusammenhang mit einem Indikator des Alterns in den Zellen bringen. Epel und ihr Team beobachteten 58 Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren über einen längeren Zeitraum. 39 dieser Frauen mussten chronisch kranke Kinder pflegen - Kinder, die etwa an Autismus litten. Die anderen 19 hatten je ein gesundes Kind. Zwar klagten die Mütter der kranken Kinder über mehr Stress, jedoch war ihnen der Stress äußerlich nicht anzumerken. Jedoch fand man im Erbgut “dramatische Unterschiede”– und zwar in Bereichen, die nicht nur eine Schlüsselrolle im Alterungsprozess der einzelnen Zellen spielen, sondern möglicherweise auch bei der Entstehung von Krankheiten. Je länger eine Frau für ein krankes Kind sorgen musste, desto kürzer waren ihre Telomere. Diese umhüllen die Enden der Chromosomen im menschlichen Erbgut wie eine Art Schutzkappe. Bei jeder Zellteilung werden diese Kappen etwas kürzer, bis sie am Ende so reduziert sind, dass sich die Zellen nicht mehr teilen können. Im Verlauf dieses Prozesses lassen die Muskelleistungen, das Denkvermögen und die Sehkraft nach, es bilden sich Falten. Eine wichtige Rolle spielte auch die Wahrnehmung der Frau: Bei jenen, die sich am stärksten belastet fühlten, stellten die Wissenschaftler im Vergleich zu wenig gestressten Frauen eine zusätzliche biologische Alterung um etwa ein Jahrzehnt fest.
Quelle: http://www.sueddeutsche.de/
panorama/artikel/897/43854/ (08-08-07)
Weitere
Quellen:http://www.stud.uni-wuppertal.de/~ya0023/phys_psy/stress.htm (01-12-24)
http://141.90.2.11/ergo-online/Krank-beschw/G_Stress.htm (02-05-26)
http://www.ibw.uni-hamburg.de/personen/studierende/appelt/files/ws2002/schmale-nitsch.doc (02-06-15)
Roth, Gerhard (2002). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig?
WWW: http://www.uni-koblenz.de/~odsssfg/seminar/wahlmodule2003/unterlagen/b07/b07.4.pdf (03-07-11)
Bildquelle:
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/paedsem/psych/medien/paedpsy/stress/Unter-htmls/selye3.jpg
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::