Aufbau des Gehirns
Schon von den Menschen der Vorzeit wurde der Kopf als Behausung böser Geister bei besessenen Menschen angesehen, deshalb wurden zu deren Entfernung Löcher in den Kopf geschabt. Sowohl bei Lebenden als auch bei Toten wurde in dieser vorgeschichtlichen Zeit ein scheibenförmiges Knochenstück aus dem Schädel entfernt und so Bereiche des Gehirns freigelegt. Vermutlich wollte man auf diese Weise Geisteskrankheiten heilen oder es sollte bei den Toten an dieser Stelle die Seele entweichen können. Schon griechische Anatomen wie Anaxagoras suchten nach dem Sitz des Geistes im menschlichen Körper und glaubten, dass die Hohlräume (Ventrikel) im Gehirn die Flüssigkeiten enthielten, welche den Hauch des Geistes darstellen. Der Grieche Alkmäon von Kroton erkannte bereits um 500 v.Chr. bei Tiersektionen, dass von den Sinnesorganen Nervenbahnen zum Gehirn ziehen. Er nahm daraufhin an, dass im Gehirn das Zentrum für die Sinneswahrnehmung und auch für das Denken liege. Er hat ebenso wie 150 Jahre später Hippokrates im Gehirn das Organ gesehen haben, das die Wahrnehmung des Hörens, Sehens und Riechens gestattet. Er war wohl auch einer der ersten, die Gehirnsektionen vornahmen, und zwar nicht nur bei toten, sondern auch bei lebenden Tieren. Den Ägyptern war lange davor bewusst, dass das Gehirn mit den Denkprozessen eines Menschen in Verbindung gebracht werden mußte. Erstmals schriftlich erwähnt wird das Gehirn im ägyptischen Papyrus Edvin Smith. Dass bei Mumifizierungen die Gehirne weitgehend entfernt wurden, lässt jedoch darauf schließen, dass die Bedeutung des Gehirns unbekannt war. Der schon genannte Grieche Alkmäon von Kroton erkannte um 500 v. Chr. bei Tiersektionen, dass von den Sinnesorganen Nervenbahnen zum Gehirn ziehen. Er nahm an, dass dort das Zentrum für die Sinneswahrnehmung und auch für das Denken liege. Allerdings hielt er das Gehirn für eine Drüse, die Gedanken absondere wie eine Tränendrüse Tränen. Herophilos (335 v. Chr) und Erasistratos (300 v. Chr) brachen erstmals das Tabu, Leichen zu sezieren, und fanden, dass ein Mensch dem bestimmte Nervenbahnen durchtrennt wurden, nicht mehr sehen kann. Sie entwickelten daher die Vorstellung eines zusammenhängenden Systems, von welchem das Gehirn das Zentrum bildet. Das Gehirn war für sie der Sitz der Seele und das Denkzentrum. Auch ihre Meinung konnte sich nicht durchsetzen. Sie beschrieben das Gehirn und die Nervenbahnen erstmals genauer (Groß- und Kleinhirn, Hirnhäute und -höhlen) und unterschieden schon zwischen Empfindungs- und Bewegungsnerven und folgerte beim Vergleich von Tier- und Menschenhirnen, dass der Mensch nur deswegen alle Tiere an Intelligenz übertreffe, weil sein Gehirn reicher an Windungen sei. Hippokrates (400 v. Chr.), der selber keine derartigen Untersuchungen vornahm, versuchte medizinisches Wissen naturwissenschaftlich zu ergründen, setzte sich jedoch mit seiner Idee, dass das Gehirn und nicht das Herz denkt, nicht durch. Für ihn war das Gehirn eine Art Dolmetscher des Bewusstseins und für alle Gefühle verantwortlich. Der römische Arzt Claudius Galenus sammelte schließlich zahlreiche Erfahrungen an verletzten Gladiatoren und verhalf allmählich der heute allgemein akzeptierten Vorstellung zum Durchbruch, dass das Gehirn das Zentrum menschlichen Denkens und des Gedächtnisses sei. Er entfernte auch bei verschiedenen Tieren systematisch bestimmte Gehirnteile, durchschnitt Rückenmark und Nerven und registrierte die darauf eintretenden Lähmungen. Die Nerven hielt er allerdings für ein Röhrensystem, in welches das Gehirn den "Seelengeist" (pneuma psychikon, spiritus animalis) aus den Hirnhöhlen pumpe wie das Herz das Blut in die Adern. Bis in die Neuzeit hinein hielt sich zudem die antike Lehre vom Pneuma, der ominösen Lebenskraft, die, einem Lufthauch gleich, angeblich alles durchströmte und für alle Vorgänge im Körper verantwortlich sein sollte. Galenus sah in den Hohlräumen des Gehirns, den Ventrikeln, den Hort des Denkens, und unterschied drei Höhlen, denen er verschiedene Funktionen zuwies: In der vordersten, zur Stirn hin gelegenen habe die Wahrnehmung ihren Sitz, in der Mitte der Verstand und in der hintersten das Gedächtnis. Diese Kammernlehre hatte fast anderthalb Jahrtausende lang Bestand, nicht zuletzt, weil sie die christliche Trinität von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist widerspiegelt. Der flämische Arzt A. Vesal etwa bezweifelte Jahrhunderte später nur die Bedeutung der Hirnhöhlen und nahm aufgrund eigener Untersuchungen an, dass der "Seelengeist" in der Hirnrinde entstehe. Er zeigte auch mittels kunstvoller Präparationen, dass das Gehirn vier Ventrikel besitzt. Aristoteles war hingegen der Meinung, dass der Mensch mit dem Herzen denke und das Gehirn lediglich als Kühlorgan gegen körperliche Überhitzung diene. Aristoteles hielt das Gehirn also für eine Art Kühlaggregat, das das von den Leidenschaften des Herzens erhitzte Blut kühlt. Das Kammernmodell von Anaxagoras wurde im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert, bis schließlich mittelalterliche Philosophen ein sehr anschauliches Modell aufstellten: die erste Kammer dient zur Wahrnehmung und Einsicht (cellula rationalis), die zweite Kammer erzeugt Erkenntnis und Urteil (cellula logistica) und der dritten Kammer wurden die Ergebnisse der vorigen Kammern abgelagert. Leonardo da Vinci goss die Hirnkammern mit flüssigem Wachs aus, um einen Abdruck zu erzeugen. Anders als erwartet stellte sich heraus, dass diese Kammern nicht säuberlich, sondern labyrinthartig voneinander getrennt waren. René Descartes betrachtete das menschliche Gehirn als Maschine, denn Funktionen wie Wachen, Schlafen, Gedächtnis, Verlangen oder Gefühl beruhten allein auf der Anordnung seiner Organe, nicht anders als die Bewegungen einer Uhr. Bewusstsein, Gewissen und Moral sind Funktionen einer Seele, die auf das Gehirn einwirkte. René Descartes unterschied übrigens genau zwischen dem, wie er sich vorstellte, mechanisch funktionierenden Organismus und der Seele des Menschen. Weil die im Gegensatz zu den Hirnhälften und paarweise angeordneten Gliedmaßen und Organen nur einmal vorhanden sei, müsse die Seele in jener Drüse sitzen, die in der Mitte zwischen den Hirnhälften angeordnet ist. Wir wissen heute, dass die Epiphyse ganz profan zuständig ist für die Produktion des Melatonin, das den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert.Der Engländer Thomas Willis sprach als erster von der Hirnsubstanz als Sitz der Hirnfunktionen und die Großhirnhemisphären wären für Wahrnehmung, Gedächtnis und Intelligenz zuständig. Siehe dazu Neuronen - Nervenzellen. Die Entdeckung Emil du Bois-Reymonds, dass Nerven mittels schwacher elektrischer Ströme kommunizieren, eröffnete ein neues Kapitel, sodass man sich im Zeitalter der Elektrophysiologie das Gehirn als einen elektrochemischen Apparat vorstellte, den man entschlüsseln wird können, wobei diese Vorstellung heute noch in der häufig gebrauchten Computermetapher fortlebt.
Vor etwa hundert Jahren veröffentlichte der deutsche Anatom Korbinian Brodmann den ersten Atlas der Großhirnrinde, in dem er fein säuberlich 52 Regionen des Cortex unterschieden und durchnummeriert hatte. Brodmanns Hirnkarte war nicht nur ein anatomisches Meisterstück, sondern sie war auch mit der Vision verbunden, dass die Forschung irgendwann den vollständigen Zugriff auf die intellektuelle und psychische Natur des Menschen haben kann. Brodmann betrachtete eingefärbten Hirnscheiben unter dem Mikroskop und nahm deutliche Dichteveränderungen in der Zellverteilung wahr. Er definierte sie als Grenzen zwischen verschiedenen Hirnarealen. Manchmal stimmten seine Grenzziehungen ziemlich gut mit klinischen Befunden überein, etwa mit der Entdeckung, dass jemand keine Wörter mehr artikulieren kann, wenn das Broca-Areal geschädigt ist. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein gab es wissenschaftliche Auseinandersetzungen darüber, ob das Gehirn, insbesondere die Hirnrinde, bei bestimmten Aufgaben wirklich lokal spezifisch an bestimmten Stellen reagiert oder ob es eine Leistung der gesamten Hirnrinde ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelingt es Wissenschaftlern zunehmend, geistige Leistungen in bestimmten Hirnregionen zu lokalisieren. Brodmanns Beitrag zur modernen Hirnforschung besteht darin, als Kartograph der Zellen und der Seele sehr genau hingeschaut zu haben und dabei vorsichtig geblieben zu sein, denn ihm war klar, dass geistige Leistungen wie Sprechen oder Intelligenz nicht vom ganzen Gehirn vollzogen werden, doch hütete er sich auch davor, sie eindeutig einzelnen Regionen zuzuordnen.
Zwar ist die Struktur des Gehirns nun schon seit etwa einem
Jahrhundert kartiert, beschrieben und dokumentiert, doch wie die
einzelnen Areale miteinander interagieren, um Denken
und Bewusstsein zu erzeugen, ist nach wie vor im Detail fraglich. Schon
seit einiger Zeit vermutet man, dass das Gehirn nicht hierarchisch organisiert ist und die meisten Regionen von höheren Zentren kontrolliert werden, sondern vermutet, dass es eher einem Netzwerk mit verteilten Knoten
entspricht. Wissenschaftler um Larry W. Swanson (University of Southern
California) haben dafür das "Circuit Tracing" entwickelt, um für jedes
Gehirnzentrum Signale aus beiden Richtungen zu kontrollieren. Mit dieser
Methode konnten sie bei Tieren ein Muster von Schleifen in der
Gehirnaktivität entdecken, also einer Struktur eines Netzwerks mit
verteilten Zentren, wobei es kein Oben und Unten gab. Diese
nicht-hierarchische Struktur könnte auch erklären, warum das Gehirn
flexibel auf lokale Schäden reagieren kann, denn beim Ausfall eines
Teiles bleibt der übrige Bereich dennoch funktionsfähig, d.h., es
alternative Signalwege gibt und es ist unentscheidbar, welcher Teil der
absolut zentrale ist. Das spricht für den alternativen Ansatz einer
nicht-hierarchischen Struktur des Gehirns in einigen Bereichen - von der
übrigens Wolf Singer schon seit einige Zeit überzeugt ist -, aber es
ist noch nicht bewiesen, ob andere Modellverstellungen über die Funktion
des Gehirns nicht ebenfalls möglich sind bzw. parallel nebeneinander
als Erklärungsmuster Gültigkeit haben.
Anmerkung: Lange Zeit nahm man ja generell an, dass Schäden am Gehirn irreversibel seien, doch inzwischen ist deutlich geworden, dass das Gehirn sehr wohl gewisse Verletzungen reparieren oder die verloren gegangenen Funktionen zumindest teilweise ausgleichen kann. Kurze Zeit nach einer Schädigung etwa durch einem Schlaganfall wird das Hirngewebe um die Läsion herum besonders flexibel, wobei neue Zellausläufer die Bereiche mit intakten Regionen verbinden und dafür sorgen, dass diese neue Aufgaben übernehmen können. Allerdings geschieht das nur, wenn dieser Prozess nicht durch zu frühe Rehabilitationsmaßnahmen gestört wird, d. h., das Gehirn muss sich erst eine Weile ungehindert regenerieren können, bevor man die neuen Netzwerke mit einer gezielten Therapie stabilisiert.
In ihren Grundzügen hat sich die Lokalisationstheorie des Gehirns bis heute bewährt und wird durch neue bildgebende Verfahren gestützt, doch sind die unterschiedlichen Areale in ihrer Funktionsweise nicht unabhängig voneinander, denn sie arbeiten bei Bedarf integrativ zusammen, um eine koordinierte psychophysische Leistung zu erbringen. Hinzu kommt eine große Plastizität des Gehirns, also die Fähigkeit von Synapsen und Nervenzellen, sich je nach Verwendung zu verändern, wobei dieser Prozess nicht nur im Kindesalter stattfindet, sondern die Architektur des erwachsenen Gehirns wird durch neue Erfahrungen und Eindrücke unentwegt verändert, so dass der Mensch lebenslang lernen kann. Allerdings ist die Regenerationsfähigkeit des Gehirns im Vergleich zu anderen Organen stark eingeschränkt, doch können nach Verletzungen gesunde Areale zumindest teilweise die Funktion von zerstörten übernehmen. Nicht zuletzt verhindert diese ausgedehnte Vernetzung der verschiedenen Gehirnregionen, dass im Schädigungsfall die ganze Erinnerung verloren geht, wodurch es oft schwierig ist, einen sich ankündigenden Ausfall bestimmter Funktionen früh zu erkennen.
Van Wedeen et al. (2012) haben mittels des Diffusions-Tensor-Bildgebungsverfahrens, eine Form der Magnetresonanztomografie, bei der die Bewegung von Wassermolekülen in den Nervensträngen erfasst wird und ihren Verlauf so sichtbar macht, eine dreidimensionale Geometrie der Nervennetze sichtbar gemacht, indem sie für einen beliebigen Nervenstrang alle anderen Nervenstränge, die ihn kreuzen, erfassten. Dabei wurde eine von rechten Winkeln geprägte regelmäßige Gitterstruktur der Neuronenverbindungen im Gehirn deutlich, wobei während der Embryonalentwicklung sich die Nervenbahnen entlang der drei Körperachsen (Längsachse von Kopf bis Fuß, der Sagittalachse vom Rücken zum Bauch und der Transversalachse von links nach rechts) ausbilden. Das Gehirn entwickelt sich aus einem zunächst zweidimensionalen Zelltuch, das dann entlang der drei Achsen komplex gefaltet wird, es also zu einer Krümmung der Gitter entlang der Falten und Windungen des Gehirngewebes kommt. Parallel verlaufende Nervenbahnen kreuzen also einander in geometrisch exakten rechten Winkeln und bilden Gitter und Gerüste. Vermutlich kann sich das Gehirn durch diese einfache geordnete Struktur der Verknüpfungen besonders gut an Veränderungen anpassen.
Technische Simulationen zeigen, dass die zahlreiche Furchen und Windungen, die die Faltenstruktur des menschlichen Gehirns bestimmen, vermutlich durch physikalische Kräfte beim Heranwachsen des ungeborenen Fötus bestimmten. Zum Zeitpunkt der 22. Schwangerschaftswoche ist die Hirnoberfläche noch weitestgehend glatt, die in der Simulation mit einem 3D-Drucker ausgedruckt wurde. Auf dieses Gel-Gehirn brachten man eine dünne Schicht eines flexiblen Kunststoffs auf, analog zur zeltreichen grauen Masse. In ein flüssiges Lösungsmittel getaucht, schwoll diese gelartige Masse an und übte dabei zunehmend starke Kompressionskräfte aus, wobei, um sich auf dem beschränkten Raum dennoch ausdehnen zu können, das Gel in zahlreiche Furchen und Windungen faltete, die verblüffende Ähnlichkeiten mit einem menschlichen Gehirn wiesen. Dieses Ergebnis könnte eine rein physykalische Erklärung zur Ausbildung der komplexen Hirnstrukturen stützen (Tallinen et al., 2016).
Die Entwicklung des menschlichen Gehirns
ist etwa mit Mitte 20 abgeschlossen. Die graue Substanz wächst bis etwa zum 25. Lebensjahr, die weiße Substanz bis zum 30. Zunächst nimmt die graue Substanz bis zum sechsten Lebensjahr deutlich an Volumen zu, was dem Menschen eine gute Anpassung an die Umgebung ermöglicht, in der er aufwächst, wobei die Zunahme häufig in den Hirnregionen beginnt, die sensorische Informationen verarbeiten.
Im Alter von etwa zwei Jahren wird eine solche Dichte der Nervenfasern erreicht, dass das Kleinkind in der Lage ist, auch komplexere Bewegungsvorgänge zu bewältigen, wobei die Vernetzung zwischen den Nervenzellen mit drei Jahren ihren Höhepunkt erreicht, da jede Nervenzelle mit Tausenden anderen verbunden ist. Ein Kind hat in diesem Alter etwa doppelt so viele Verbindungen wie Erwachsene, wobei die Art und Anzahl der sich formenden und bestehen bleibenden Synapsen stark mit der jeweiligen Umwelt und den in dieser erlernten Fähigkeiten zusammenhängt, d. h., Kinder sind einerseits zwar extrem anpassungs- und lernfähig, benötigen andererseits aber auch einen entsprechenden Input (rich learning environment). Es wurde in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen, dass sich ein Kind in einer anregungsreichen Umgebung besser entwickelt als in einer Umgebung, die arm ist an Anreizen.
Ab dem sechsten Lebensjahr stagniert das Wachstum und ab der Pubertät nimmt das Volumen der grauen Substanz sogar leicht ab, da das Gehirn nur die Zellen behält, die häufig gebraucht werden und bereits viele Verbindungen hergestellt haben, wodurch das Gehirn immer leistungsfähiger wird. Doch nicht alle Hirnregionen entwickeln sich gleich schnell, denn es gibt sensible oder kritische Phasen, in denen Kinder besonders empfänglich für bestimmte Reize sind, was das Erlernen neuer Fähigkeiten erleichtert. Vor allem schwierige Sprachen werden am besten bis zum zehnten Lebensjahr gelernt, für die Unterscheidung von Sprachlauten ist die sensible Phase sogar auf das erste Lebensjahr beschränkt.
In der Pubertät bis zum Alter von etwa 25 Jahren entwickelt sich unter anderem der frontale Kortex weiter, der eine wichtige Rolle beim Planen, Denken und Verarbeiten komplexer Informationen, beim Überwachen der Folgen des eigenen Verhaltens und vielem mehr spielt. In der Pubertät kann es zu einer Art Ungleichgewicht im Gehirn kommen, weil sich ein Bereich schneller entwickelt als ein anderer: So wächst der frontale Kortex eher langsam, während Amygdala, Striatum und Nucleus accumbens, also jene tiefer im Gehirn gelegenen Bereiche, die unter anderem für Emotionen, Motivation und Belohnungsempfinden zuständig sind, schneller wachsen. Dies führt dazu, dass Menschen in dieser Lebensphase besonders emotional und belohnungsempfindlich sind und mehr Risiken eingehen.
Zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn in sozialer Hinsicht höchstwahrscheinlich ähnlich weiter wie zuvor in der Adoleszenz, wobei noch nicht klar ist, ob es dafür im jungen Erwachsenenalter eine besonders sensible oder kritische Entwicklungsphase gibt. Möglicherweise gelingt es den Menschen in dieser Phase aber immer besser, sich an verschiedene soziale Situationen anzupassen, z.B. als Freund, als Partner, als Mitarbeiter und Teammitglied, manchmal auch als Vater oder Mutter. Außerdem scheint man in diesem Alter besser unterscheiden zu können zwischen dem, was man selbst will oder denkt, und dem, was die Umwelt von einem erwartet, da man mehr Rücksicht auf andere nimmt und das eigene Verhalten besser kontrollieren kann.
Nach dem 30. Lebensjahr baut das Gehirn nicht sofort ab, sondern bleibt plastisch, z.B. wenn Hirnareale nach Läsionen Funktionen voneinander übernehmen oder zusammenarbeiten, aber ob lebenslang neue Nervenzellen entstehen und dazu beitragen, ist umstritten. Lebensjahr beginnt das Gehirn leicht zu schrumpfen, ab etwa 70 Jahren beschleunigt sich der Abbau, d.h. Verbindungen gehen verloren und das Gedächtnis lässt nach.
Die Lateralisation des Gehirns
wird allgemein als entscheidend für die menschliche Gehirnfunktionen und insbesondere Kognitionen angesehen, wobei die funktionale Trennung der beiden Gehirnhälften und die damit verbundene Gehirnasymmetrie beim Menschen gut dokumentiert ist. Da vergleichende Studien bei Primaten bisher selten sind, ist nicht bekannt, welche Aspekte der Lateralisierung nun typisch menschlich sind. Gehirne von Menschenaffen sind in der Regel nur selten für Studien verfügbar, doch nun hat man Methoden entwickelt, um Daten zur Gehirnasymmetrie aus fossilen Schädeln zu extrahieren, die in größerer Zahl zur Verfügung stehen. Mithilfe von Abdrücken des Gehirns auf der Innenseite des Schädelknochens haben nun Neubauer et al. (2020) Menschen, Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans miteinander verglichen. Bisher vermutete man, dass sich viele Aspekte der Gehirnasymmetrie erst nach der Trennung der menschlichen Evolutionslinie von der Linie den Schimpansen, entwickelt haben. Es zeigte sich aber, dass nicht nur Menschen, sondern auch Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans schon das gleiche durchschnittliche Asymmetriemuster besitzen, das zuvor als typisch menschlich beschrieben angenommen wurde: der linke Hinterhauptlappen, der rechte Vorderhauptlappen sowie der rechte Pol des Schläfenlappens und der rechte Kleinhirnlappen stärker hervor als auf der anderen Seite. Dabei war bei Menschen diese Asymmetrie am wenigsten konsistent, d. h., sie zeigen eine viel größere individuellere Variation. Offenbar gab in der Entwicklung eine zunehmend funktionelle und entwicklungsbedingte Modularisierung des menschlichen Gehirns, sodass etwa die Asymmetrie von Hinterhauptlappen und Kleinhirn beim Menschen weniger als bei Menschenaffen miteinander zusammenhängt. Das ist insofern bemerkenswert, da sich das Kleinhirn des Menschen während der Evolution dramatisch verändert hat. Offenbar zeichnet die vermeintlich typisch menschliche Asymmetrie der Schädel auch schon die gemeinsamen Vorfahren von Primaten und Menschen aus, sie ist also evolutionär viel älter als angenommen.
Die drei Gehirne
Der Mensch besitzt im Grunde genommen drei Gehirne:
Das reptilische Gehirn
Schon unsere tierischen Vorfahren besaßen dieses Gehirn;
deshalb ist es auch für alle Grundfunktionen des Lebens
zuständig: Bewegung, Jagen, Pflegen, Revierabsteckung, Riten,
Paarungsdrang, Gewohnheit. Das reptilische Gehirn liebt keine
Veränderung. Es hat uralte Gewohnheiten und Verhaltensweisen (fast)
unabänderlich gespeichert. Es lernt nur äußerst langsam und vermittelt
uns das Gefühl der Routine und Sicherheit. Emotionen kennt das
reptilische Gehirn nicht.
Die Archetypen nach C.G. Jung (Verhaltensweisen, die wir seit der Frühzeit an den Tag legen), sollen im reptilischen Gehirn manifestiert sein.
Das emotionale Mammalia-Gehirn
Dieses "emotionale" Gehirn hat zentrale Bedeutung für unser Gedächtnis. Dieser Hirnteil, auch Mittelhirn genannt, enthält die Hypophyse und die Zirbeldrüse. Lachen und Weinen, Spieltrieb und Sexualität, Euphorie und Depressionen sind hier verankert. Alle Informationen, die im Langzeitgedächtnis gespeichert werden sollen, passieren zuerst einmal diesen Teil des Gehirns. Rationale Kognition und Gefühl treffen hier aufeinander.
Das denkende Neomammalia-Gehirn
Es ist der jüngste Teil des Gehirns in unserer Evolutionsgeschichte und befindet sich in der Großhirnrinde, der äußeren Hülle des Gehirns. In diesem Bereich wird gedacht und gespeichert. Logisches Denken, die Bildung von Denkstrukturen, Phantasie und Schöpfergeist, die Fähigkeit zu Schlußfolgerungen und neuen Erkenntnissen sowie die Langzeitspeicherung von Informationen, ist die Hauptaufgabe des Neomammalia-Gehirn.
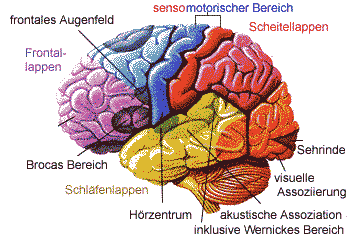
Siehe auch Anatomie des Gehirns und Methoden der Erforschung des Gehirns
Das Zentralnervensystem setzt sich aus Gehirn und Rückenmark (Medulla spinalis) zusammen. Die wichtigsten Regionen des Gehirns bestehen (von unten nach oben) aus dem
- Hirnstamm mit verlängertem Mark (Medulla oblongata),
- Brücke (Pons) und
- Mittelhirn (Mesencephalon), dem
- Kleinhirn (Cerebellum),
- Zwischenhirn (Diencephalon),
- Balken (Corpus Callosum),
- dem limbischen System (Archikortex, Paleokortex) und schließlich
- dem Großhirn (Cerebrum), das von
- der Großhirnrinde (Neokortex) überdeckt wird.
Das Mittelhirn fungiert als Koordinationszentrum, welches Informationen aus verschiedenen Sinnesbereichen sowie dem Großhirn erhält. Außerdem kontrolliert es Hirnnervenreflexe (z.B. Blinzelreflex) und Bewegungen. Das Kleinhirn ist für die sensomotorische Koordination zuständig und hat wegen seiner vielen Lappen und Furchen ähnlich wie das Großhirn ein stark gewundenes Aussehen. Im Zwischenhirn liegen unter anderem der Thalamus und der Hypothalamus. Der Thalamus mit seiner großen Ansammlung von Kernen ist übergeordnete Sammel- und Umschaltstelle für die wichtigsten sensorischen Systeme. Von hier werden Erregungen aus den Sinnesorganen zum Großhirn geleitet. Der Hypothalamus besteht aus einer kleineren Gruppe von Kernregionen und steht mit vielen Gehirnregionen in Verbindung. Dabei gilt er als Zentrum für Stoffwechselfunktionen, Hormonregulation und Sexualfunktionen etc. Er ist zudem eng mit dem limbischen Systems verknüpft. Das limbische System steht mit weiteren Regionen wie dem Thalamus und dem Cortex in enger Verbindung. Seine wichtigsten Teile sind Hippocampus und Amygdala, durch dieses werden alle aus der Umwelt eintreffenden Informationen affektiv gefärbt und bewertet. Das limbische System besteht aus mehreren Untereinheiten, die entscheidend an der Verarbeitung von Emotionen sowie an Lernprozessen beteiligt sind. Es liegt größtenteils in der Mitte des Gehirns, wo es den Hirnstamm wie einen Saum (limbus) umschließt. Ein mandelförmiger Teil des limbischen Systems (Amygdala oder Mandelkern) spielt eine wichtige Rolle für Lernen, Gedächtnis und Verarbeitung von Gefühlen, insbesondere von Angst. Der Hippocampus ist die Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Sind die Hippocampi in beiden Hemisphären zerstört, kann der Patient sich keine neuen Informationen einprägen (anterograde Amnesie), wobei im Hippocampus auch der menschliche Orientierungssinn sitzt.
Schließlich stellt das Großhirn bzw. die Großhirnrinde den phylogenetisch jüngsten aber auch den größten Teil dar und ist für die höheren psychischen Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Lernen, Denken und Sprache etc. unentbehrlich. Von seiner Lage her wölbt es sich über die anderen Gehirnabschnitte.. Die Großhirnrinde mit ca. 3mm Tiefe besteht aus vielen Falten bzw. Hirnwindungen (Gyri), wodurch die Fläche des Gehirns vergrößert wird. Sogenannte Sulci (Furchen) trennen die Hirnwindungen voneinander. So wird das Großhirn durch eine tiefe Längsfurche (Fissura longitudinalis) in zwei Hemisphären (linke - rechte) unterteilt, die alleine durch den Balken miteinander verbunden sind. Dieser macht eine effiziente Zusammenarbeit beider Hemisphären möglich. Bedeutsam dabei ist, dass er sich relativ spät entwickelt. Nur dadurch ist eine derartige Spezialisierung der linken und rechten Hälfte möglich, da eine gleichmäßige Entwicklung beider zu Leistungsminderung der ZNS führen würde. Beide Gehirnhälften lassen sich in vier Lappen unterteilen: Der Stirn- oder Frontallappen grenzt sich durch die Zentralfurche (sulcus centralis) vom dahinter liegenden Scheitel- bzw. Parietallappen ab. Von diesem wiederum zieht sich eine Seitenfurche (sulcus lateralis) herunter, an die der Schläfen- bzw. Temporallappen angrenzt. Diese wird auch Sylvische Furche genannt. Schließlich befindet sich am hinteren unteren Teil der Hinterhaupts- oder Okzipitallappen, der vom Parietal- und Temporallappen durch die sog. Scheitel-Hinterhauptsfurche (sulcus parieto-occipitalis) getrennt ist. Die Nervenzellen der Großhirnrinde lassen sich in größere Abschnitte (Rindenfelder) zusammenfassen, die jeweils ähnliche Aufgaben inne haben.
Dass es keine Gehirn-Zentren für spezielle Funktionen wie Neugier, Angst oder Sehnsucht gibt, sondern dass diese durch Vernetzung entstehen, wird durch neueste neurologische Forschungen bestätigt. Heute glaubt kein Forscher mehr an einen modularen Aufbau des Gehirns, vielmehr hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Vernetzung der Hirnregionen der entscheidende Faktor für ein spezielles Persönlichkeitsmerkmal ist. Auch dürfte der Einfluss der Gene auf die Struktur des Gehirnaufbaus bzw. der Vernetzung während der Entwickung relativ hoch sein.
Die Behauptung von manchen ExpertInnen, dass Gehirnforscher schätzten, dass der Durchschnittsmensch nur etwa 10 Prozent der Gesamtkapazität seines Gehirns nutzt, ist übrigens schlichter Unsinn, denn es gibt nicht einen ernstzunehmenden Neurowissenschaftler, der das in dieser Form behauptet. Seit der Nutzung bildgebender Verfahren ist bekannt, dass das gesamte menschliche Gehirn ständig in Aktion ist. Übrigens: Neuere Kartierungen der Gehirnareale zeigen, dass das Gehirn noch komplexer ist als angenommen, denn man hat jüngst 180 klar voneinander trennbare Bereiche im äußeren Mantel des Gehirns ausfindig machen können, das sind mehr als doppelt so viele wie bisher angenommen.
[Quelle: https://www.youtube.com/embed/UHDfvfYCY0U]
Wissenschaftler der Princeton University untersuchten die evolutionäre Entwicklung der Gehirne von Wirbeltieren, indem sie die Größenunterschiede von elf Gehirnarealen maßen und sie zueinander in Beziehung setzten. In Anlehnung an den aus der Genetik stammenden Begriff Genotyp prägten sie den Begriff des "Cerebrotyps", der die Größenverteilung der einzelnen Gehirnarreale zueinander beschreibt. Die Analyse zeigte, dass die Wirbeltiere ein breites Spektrum von Cerebrotypen aufweisen, mit den Menschen an dem einen Ende der Reihe und Insektenfressern wie Igeln am gegenüberliegenden. Mit Hilfe der Messungen entdeckten die Forscher, dass Tiere mit ähnlichen Größenverteilungen der einzelnen Gehirnregionen auch evolutionär nahe beieinander stehen. In verwandten Spezies variiert zwar manchmal die Gesamtgröße des Gehirns um 100 Prozent, aber die relative Größe der Areale bleibt im Allgemeinen konstant. Veränderungen der Cerebrotypen gehen offensichtlich mit der Entstehung neuer Arten einher. Die Arbeit bestätigte frühere Forschungsergebnisse, nach denen sich der Neocortex von allen Gehirnarrealen im Laufe der Evolution am stärksten entwickelt hatte. Während aber die Größenzunahme bei Insektenfressern nur 16 Prozent beträgt, liegt sie bei Menschen bei 80 Prozent. Dieser Gehirnbereich ist für soziale Interaktionen, Vernunft und andere kognitive Leistungen verantwortlich. Das legt die Vermutung nahe, dass die Entstehung der sozialen Intelligenz eine mächtige evolutionäre Kraft war und unterstützt die Hypothese, dass im Laufe der Evolution die Fähigkeit zur sozialen Intelligenz fürs Überleben immer wichtiger wurde.
Die umfangreichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen basieren also auf dem relativ großen Gehirn, das sich im Lauf der Evolution unter anderem durch die vermehrte Bildung und Vernetzung von Nervenzellen entwickelt hat. Experimente haben gezeigt, dass bestimmte Mutationen die Gehirnentwicklung beeinflussen, indem sie etwa während der Entwicklung des Neocortex die Bildung von Nervenzellen aus Vorläuferzellen fördern, weil sie deren Vermehrung anstoßen. Der Neocortex ist bekanntlich jener Teil der Großhirnrinde von Säugetieren, der für die kognitiven Fähigkeiten und komplexen Verhaltensweisen entscheidend ist. Untersuchungen haben nun gezeigt, dass möglicherweise eine kleine Mutation im Erbgut des Menschen dieses verstärkte Hirnwachstum ermöglicht. Florio et al. (2016) haben festgestellt, dass das Gen ARHGAP11B die Vermehrung der Vorläuferzellen im Neocortex natürlicherweise ankurbelt, wobei dieses Gen nur beim Menschen vorkommt und in dessen Abstammungslinie rund eine Million Jahre nach der Abspaltung vom Schimpansen auftauchte und durch eine teilweise Verdoppelung des Gens ARHGAP11A entstanden ist. Auf der Suche nach der Ursache für diesen Unterschied stellte man fest, dass der Boten-RNA von ARHGAP11B 55 Bausteine fehlen. Zwar sind diese Bausteine in der DNA-Sequenz des Gens durchaus noch vorhanden und gehen erst während der Bildung der Boten-RNA verloren, wobei eine einzigen veränderte Base der Gensequenz dafür verantwortlich zeichnet, indem sie als molekulare Schere die 55 Bausteine aus der entstehenden Boten-RNA entfernt. Eine Urversion des Gens ARHGAP11B ohne die Mutation produzierte eine Boten-RNA, die die 55 Nukleotide enthielt und dementsprechend eine ähnliche Proteinaktivität wie die Normalvariante des Gens, kurbelte aber nicht die Vermehrung der neuronalen Vorläuferzellen an. Diese Fähigkeit ist also nicht durch die Genverdoppelung vor rund fünf Millionen Jahren zustande gekommen ist, sondern muss jünger sein und erst die spätere Punktmutation hat die Vergrößerung des Neocortex ermöglicht.
Vertrauen basiert auf Gefühlen
Ein Forscherteam um Raymond Dolan am Universitätscollege London fand heraus, dass unsere Entscheidung, ob wir einen anderen Menschen vertrauenswürdig finden, vor allem eine emotionale ist. Die Probanden sollten in dem Versuch spontan bestimmte Fragen zu Bildern von Menschen beantworten. Dabei wurde gemessen, welche Regionen im Gehirn jeweils aktiv waren. Auf die Frage, welche der abgebildeten Personen vertrauenswürdig und sympathisch wirkt, war dies vor allem der so genannte "Mandelkern" (Amygdala), also der Teil des Gehirns, der sonst nur bei starken Emotionen, wie z.B. auch Angst aktiv ist. Daraus schließen die Forscher, dass unser Vertrauen vor allem auf unseren Emotionen beruht.
Quelle: http://www.wissenschaft.de/
Siehe dazu auch Rechte versus linke Gehirnhälfte?
Gehirn für Kinder ;-)
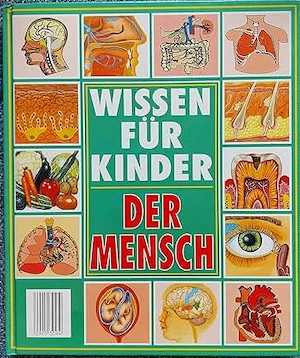 Eine nette Beschreibung des Gehirns fand sich in dem Buch
"Wissen für Kinder — Der Mensch" von Trevor Day: "Unser Gehirn ähnelt
von oben gesehen einer riesengroßen Walnuss. Es ist rosagrau und hat eine unebene Oberfläche. Das Gehirn fühlt sich weich an, wie Pudding. Das Gehirn ist unsere Steuerzentrale des Organismus. Es sendet Nachrichten an Organe und Gewebe und erhält von dort Informationen. Dank des Gehirns können wir lernen, überlegen und fühlen. Es steuert bewusste und unbewusste Vorgänge. Das Gehirn ist unsere Zentrale für Gedächtnis und Lernen. Es gibt drei Arten von Gedächtnis: das sogenannte "eidetische" Gedächtnis sagt etwas über die Welt im gleichen Augenblick, zum Beispiel wenn wir gehen, dass wir nirgends anstoßen. Im Kurzzeitgedächtnis können wir Dinge speichern, so dass wir beim Wählen eine Telefonnummer nicht vergessen. Unser Langzeitgedächtnis
speichert Erinnerungen über viele Jahre. Es kann viel Spaß machen,
unser Gehirn mit "Nahrung" in Form von Ratespielen und
Gedächtnistraining zu "füttern". Zum Beispiel könntet ihr euch einen
Artikel aus unserer Zeitung vorlesen lassen und diese Geschichte dann
eurer Familie mit eigenen Worten und aus der Erinnerung erzählen. Dann
habt ihr eure grauen Zellen im Gehirn trainiert."
Eine nette Beschreibung des Gehirns fand sich in dem Buch
"Wissen für Kinder — Der Mensch" von Trevor Day: "Unser Gehirn ähnelt
von oben gesehen einer riesengroßen Walnuss. Es ist rosagrau und hat eine unebene Oberfläche. Das Gehirn fühlt sich weich an, wie Pudding. Das Gehirn ist unsere Steuerzentrale des Organismus. Es sendet Nachrichten an Organe und Gewebe und erhält von dort Informationen. Dank des Gehirns können wir lernen, überlegen und fühlen. Es steuert bewusste und unbewusste Vorgänge. Das Gehirn ist unsere Zentrale für Gedächtnis und Lernen. Es gibt drei Arten von Gedächtnis: das sogenannte "eidetische" Gedächtnis sagt etwas über die Welt im gleichen Augenblick, zum Beispiel wenn wir gehen, dass wir nirgends anstoßen. Im Kurzzeitgedächtnis können wir Dinge speichern, so dass wir beim Wählen eine Telefonnummer nicht vergessen. Unser Langzeitgedächtnis
speichert Erinnerungen über viele Jahre. Es kann viel Spaß machen,
unser Gehirn mit "Nahrung" in Form von Ratespielen und
Gedächtnistraining zu "füttern". Zum Beispiel könntet ihr euch einen
Artikel aus unserer Zeitung vorlesen lassen und diese Geschichte dann
eurer Familie mit eigenen Worten und aus der Erinnerung erzählen. Dann
habt ihr eure grauen Zellen im Gehirn trainiert."
Anmerkung: Die Ähnlichkeit des Gehirns mit einer Walnuss gilt heute in der Alternativmedizin und Esoterik nach wie vor als Beleg dafür, dass in einer Nuss wesentliche Inhaltsstoffe zu finden sind, die die Funktion des Gehirns fördern. Dieses längst widerlegte Dogma basiert auf der Signaturenlehre von Paracelsus, nach der vor allem die Form einer Pflanze oder Frucht bei ihrer Heilkraft entscheidend ist. Da nun die Oberfläche einer Walnuss den Windungen des Gehirns sehr ähnlich ist, hat sie der Signaturenlehre zufolge auch etwas mit dem Gehirn zu tun. In der Weltsicht von Paracelsus und seiner Zeitgenossen ist der Mikrokosmos Mensch eingebettet in den Makrokosmos des Universums und spiegelt sich demzufolge darin, sodass etwa auf Grund der Form eine Bohne bei Nierenleiden wirksam sein muss, woraus sich gemäß der Signaturenlehre eine Therapie ableiten lässt. Dass sich die Form auf eine Funktion übertragen lässt, war aber bereits im späten Mittelalter verbreitet, doch konkret formuliert hat sie erst Paracelsus. Durch das naturwissenschaftliche Denkens wurde dieser Zusammenhang von Ursache und Wirkung allerdings eindeutig widerlegt. Berthold Neff schrieb dazu am 20. August 2019 in einer Kolumne der Süddeutschen Zeitung, dass "wer sich gelegentlich die Apotheken-Rundschau zu Gemüte führt, um trotz eines zugegeben ungesunden Lebenswandels halbwegs über die Runden zu kommen, kennt natürlich die heilbringende Kraft der Nuss. Ihr regelmäßiger Verzehr kann jene Hirnwellen stärken, die unsere geistigen Fähigkeiten befördern, insbesondere das Gedächtnis. Insofern wundert es einen schon, wie vergesslich das Eichhörnchen-Pärchen ist, das mit einer Wal- oder Haselnuss im Maul herumturnt, immer auf der Suche nach einem guten Versteck an der Guardinistraße. Sie buddeln ihre Beute in Beete und Blumenkästen, in den Rasen und in Schotterflächen und verlieren dann den Überblick. Im Jahr danach sprießt ein Walnussbaum aus einer vergessenen Schale und verdrängt die Tagetes, während sich mehrere Haselnusssträucher aus dem Unkraut im Rasen emporwinden. Das fördert zwar die Artenvielfalt, setzt dem gärtnerischen Gestalten aber klare Grenzen. Was die Eichhörnchen natürlich nicht wissen: Nicht alle Nüsse stärken das Gehirn. Es sind vor allem die Pistazien, deren Verzehr die Gammawellen anregt, die man zur Speicherung von Informationen benötigt. Und wie kommt ein deutsches Eichhörnchen an Pistazien? Man muss sie ihnen aus dem Supermarkt mitbringen. Falls man es nicht vergisst." ;-)
Literatur
Florio, Marta, Namba, Takashi, Pääbo, Svante, Hiller, Michael & Huttner, Wieland B. (2016). A single splice site mutation in human-specific ARHGAP11B causes basal progenitor amplification. Science Advances, 12, doi: 10.1126/sciadv.1601941.
Stangl, W. (2023, 11. Mai). Ein neues Modell des Gehirns: HIBALL. Psychologie-News.
https://psychologie-news.stangl.eu/4545/ein-neues-modell-des-gehirns-hiball.
Stangl, W. (2023, 20. Dezember). Die Entwicklung des menschlichen Gehirns. Stangl notiert ….
https://notiert.stangl-taller.at/gehirnforschung/die-entwicklung-des-menschlichen-gehirns/.
Tallinen, T., Chung, J. Y., Rousseau, F., Girard, N., Lefèvre, J.
& Mahadevan, L. (2016). On the growth and form of cortical
convolutions. Nature Physics, DOI: 10.1038/nphys3632.
https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/default-fd7f994153/ (23-05-11)
Überblick über weitere Arbeitsblätter zum Thema Gehirn
- Gehirn, Gefühle und Empfindungen
- Gehirn und Zeit
- Wie sich das Gehirn die Gegenwart strukturiert
- Das Problem der Gleichzeitigkeit
- Im Schlaf lernen funktioniert
- Zwei Untersuchungen zum tierischen Gedächtnis
- Gen RGS9 für Wahrnehmungsgeschwindigkeit verantwortlich
- Veränderung der Merkfähigkeit mit Tageszeit und innerer Uhr
- Gehirn und Größe
- Gehirn bei Tieren
- Gehirn und Sprache
- Gehirn und Lernen
- Gehirnforschung & Freiheit
- Gehirn und Computer
- Haben Pflanzen ein Gehirn?
- Quellen und Literatur
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::