Weitere lernpsychologisch relevante Behavioristen
Edwin R. Guthrie (1886-1959)
Edwin R. Guthtrie war ein Pawlow-Anhänger und entdeckte die Bedeutung der raumzeitlichen Nähe (Kontiguität) von Reiz und Reaktion: Diese und nicht das Effektgesetz, seien für Lernvorgänge verantwortlich.
Er vertrat die Meinung, dass jede auf einen Reiz folgende Reaktion diesem Reiz wieder folgt, wenn er wiederholt wird. Der Prozess des Lernens bedeutete für Guthrie die Aneignung von Reiz-Reaktions-Verbindungen. Kritische Einwände, der Mensch würde sich in gleichen Situationen oft anders verhalten, wies Guthrie zurück und behauptete, die Reaktionen könnten nur deshalb unterschiedlich sein, weil auch die Reize nicht genau identisch wären.
Guthries Theorie ist umstritten und wurden oft als "Ein-Schuss-Theorie" bezeichnet, da der ganze Lernprozess nach einem einzigen Durchgang abgeschlossen ist. Dennoch haben seine Ansichten darüber, wie man eine Gewohnheit durch eine andere ersetzen kann, in der Pädagogik Bedeutung gefunden. Er entwickelte drei Methoden um unerwünschtes Verhalten, abzustellen:
- Ermüdungsmethode: Bei dieser Methode wird ein Reiz, der eine bestimmte unerwünschte Reaktion hervorruft, wiederholt dargeboten. Diese Methode lässt sich am Beispiel des Rodeo-Reitens verdeutlichen. Nach einem langen Rodeo-Ritt ist das Pferd so müde, dass es die bisherige Reaktion des Buckelns nicht mehr zeigt und statt dessen eine neue - gewünschte-Reaktion zeigt.
- Schwellenmethode: Bei der Schwellenmethode werden Reize unterschwellig dargeboten, sodass die unerwünschte Reaktion nicht ausgelöst wird. Die Reizstärke wird langsam gesteigert, bis die unerwünschte Reaktion von der neuen Reaktion überlagert wird.
- Methode der inkompatiblen Reize: Bei dieser Methode wird der Reiz dann dargeboten, wenn die Reaktion nicht stattfinden kann (z.B. durch fest binden des Pferdes). Auch hier wird die alte unerwünschte Reaktion durch eine neue ersetzt.
Guthries Ansatz ist die natürliche Fortsetzung von Thorndike und Pawlow, er legte aber weniger Wert auf Experimente als vielmehr auf die plausible Interpretation von Alltagsverhalten (z.B. Mantelaufhängen). Guthrie hatte lediglich ein einziges Lerngesetz:
„Eine Kombination von Reizen, die mit einer Bewegung einhergeht, pflegt beim erneuten Auftreten diese Bewegung nach sich zu ziehen."
Guthrie versuchte zu beweisen, dass sein einfaches Gesetz für alle Lernformen gilt. Wegen der starken Kontiguität gibt es für ihn keine Verzögerung zwischen Reiz und Reaktion (kein optimales Intervall). Die Reaktion beginnt gleichzeitig mit dem Reiz und verläuft in Unterschritten verdeckt, bis sie in die offene Reaktion mündet. Diese verdeckten Abläufe seinen die eigentlichen konditionierenden Ereignisse. Da man diese immer in sich mitführt, ermöglichen sie eine recht variable Reaktion auf verschiedene Umweltreize.
Guthries Theorie gilt allgemein als eher unvollständig. Um die so sicher dargelegten Theorien auf experimentelle Befunde zu beziehen, waren zahlreiche Zusatzannahmen und Konstruktionen notwendig. Trotzdem sind sie eine Bereicherung für die Psychologie, da sie konkretes Alltagsverhalten plausibel und einfach erklären.
Edward L. Thorndike (1874-1949)
Thorndike formulierte das "Gesetz der Wirkung (Effekt)", das den Begriff "Lernen am Erfolg" beinhaltet. Zufällige Aktionen, die zu einer positiven Konsequenz für das Individuum führen, werden seiner Meinung nach selektiert und öfter eingesetzt.
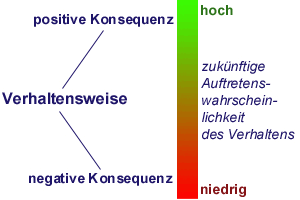
 Für ihn war die Verknüpfung von Reiz und
Reaktion, nicht einfach nur durch Wiederholung und
Kontiguität vorhanden, sondern ebenfalls an eine
Verstärkung gebunden.
Für ihn war die Verknüpfung von Reiz und
Reaktion, nicht einfach nur durch Wiederholung und
Kontiguität vorhanden, sondern ebenfalls an eine
Verstärkung gebunden.
Diese Verstärkung bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung des Lernenden. Wenn die Verknüpfung von Reiz und Reaktion einen Zustand der Befriedigung (verstärkender Effekt) für das Individuum darstellt, wird die Verknüpfung gestärkt. Im Gegensatz dazu zieht der Effekt einer Nichtbefriedigung eine Schwächung der Verknüpfung nach sich.
Neben dem Effektgesetz postulierte Thorndike noch weitere fünf Lerngesetze:
- Multiple Reaktion: Der Organismus reagiert in einer gegebenen Situation mit einer Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen, wenn die erste Reaktion nicht zu einem befriedigendem Zustand führt. Man kann diesen Prozess auch als Versuch-Irrtum-Verhalten bezeichnen. Menschen lernen also situationsgerechte Reaktionen im Wesentlichen durch ausprobieren,.
- Set oder Einstellung: Dieses Gesetz besagt, dass es zum Teil abhängig von einer Kultur oder Einstellung ist, welche Reaktion in einer Situation gezeigt wird.
- Die Vorherrschaft von wichtigen Elementen: Der Lernende geht nur auf die zur Problemlösung relevanten Elemente ein. Irrelevante Aspekte werden selektiert.
- Analoge Reaktion: Dieses Gesetz besagt, dass eine Reaktion übertragbar ist. Eine Person kann in einer für sie neuen Situation Reaktionen zeigen, die sie in anderen Situationen mit einigen identischen Elementen auch zeigen würde.
- Assoziatives Wechseln: Eine Reaktion kann ihre assoziativen Bindungen von einem Reiz zu einem anderen verlagern. Diese Reaktionen resultieren aus einem Konditionierungsprozess.
Quelle der Grafik:
http://www.lern-psychologie.de/
E. L. Thorndike war fasziniert von der Darwinschen Evolutionstheorie, die erklärt, wie sich Lebewesen im Verlauf von Millionen Jahren den sich ständig verändernden Bedingungen angepasst haben. Er promovierte über die Intelligenz von Tieren. In seinen Experimente versuchte er einen Zusammenhang zwischen Lernen und der Darwinschen Theorie zu finde, weshalb Tiere sich durch Lernen an ihre Umwelt anpassen, um besser mit und in ihr agieren zu können. Thorndike gehört zu den ersten Psychologen, die versuchten, Lernen auf experimentellem Wege zu erforschen, wobei er mit Katzen experimentierte um herauszufinden, wie sich Verhaltenskonsequenzen auf das Verhalten selbst auswirken.
Donald Olding Hebb (1904-1985)
Hebb nahm aufgrund von Beobachtungen an, dass zwischen Reiz und Reaktion "höhere Prozesse" ablaufen. Diese Prozesse kann man als Denkprozesse oder Denken bezeichnen, die nach Hebb unabhängig vom unmittelbaren sensorischen Input sind, aber mit diesem zusammenarbeiten, um zu bestimmen, welche der möglichen Reaktionen stattfinden soll und zu welcher Zeit. Er versuchte, diese These neurologisch und physiologisch zu belegen.
Die Überlegung, dass zwischen Reiz und Reaktion höhere Prozesse ablaufen müssen, kam ihm durch Beobachtung. So stellte er fest, dass man zum Beispiel die Fangreaktion aufgrund eines auf einen zufliegenden Gegenstandes durchaus sehr gut anhand des S-R-Modells erklären kann, es bei komplexeren Aufgaben jedoch schwerer ist, da häufig zwischen Reiz und Reaktion eine längere Zeit vergeht.
Wird ein Reiz vom menschlichen Organismus empfangen, so wird eine Nervenzelle erregt, die nun weitere Zellen erregt (innerviert), bis letztlich eine Reaktion erfolgt. Hebbs Vorschlag basiert nun auf der Annahme, dass eine häufige Reizübertragung zwischen zwei Zellen die Übertragung auf Dauer erleichtert. Er bezeichnet diese Erleichterung der Impulsübertragung als Bahnung. Besteht eine solche Bahnung zwischen zwei Zellen, so ist es wahrscheinlicher, dass eine Impulsübertragung zu dieser Zelle statt findet, als zu einer anderen benachbarten Zelle.
Werden nun regelmäßig bestimmte Zellen gemeinsam erregt und es kommt zwischen diesen zu Bahnungen, so bilden sich sogenannte Zellgruppierungen. Diese Gruppierungen repräsentieren jeweils relativ einfache sensorische Inputs. Betrachte ich zum Beispiel einen Stift, so werden viele verschiedene Zellgruppierungen erregt, die jeweils ein anderes Merkmal repräsentieren. Es werden zum Beispiel die Gruppierungen "Farbe", "Form", "Material","Nutzen" etc. innerviert.
Hebb versuchte damit das klassische Konditionieren neurologisch erklären. Es kommt seiner Ansicht dadurch zu einer bestimmten Reaktion auf einen konditionierten Reiz, dass durch die wiederholte gemeinsame Darbietung von konditioniertem und unkonditioniertem Reiz eine Phasensequenz gebildet wurde, die beide Reize umfasste. Werden nun nur die Zellgruppierungen des konditionierten Reizes innerviert, so wird der Reiz über die gebahnten Nervenleitungen an die Zellgruppierungen des unkonditionierten Reizes vermittelt und es erfolgt eine Reaktion auf die gesamte Phasensequenz.
Diese Erklärung des Lernens durch das aktivierungsbedingte Verknüpfen wurde später neurologisch bestätigt: Die häufig wiederholte Aktivierung benachbarter Nervenzellen bewirkt die Überbrückung der Spalten zwischen diesen Neuronen diese Überbrückungen werden Synapsen genannt. Dieses Überbrücken geschieht dadurch, wenn die präsynaptische Nervenzelle, also jene vor dem Spalt, und die postsynaptische Zelle, also jene nach dem Spalt, zugleich aktiviert werden. Wenn das wiederholt geschieht, entsteht eine "verstärkte", aktivierungsabhängige relative Stabilisierung. Wiederholtes Feuern der Neuronen in Kontiguität, d.h. nebeneinander und praktisch gleichzeitig, verstärkt diese dynamisch verkörperte Verknüpfung. Durch eine solche Verstärkung von Synapsen zwischen feuernden Neuronen entsteht eine aktivierungsabhängige, relativ stabilisierte Musterbildung von Neuronennetzen (Neuronenassemblies). Man erhält somit ein dynamisches Gefüge in einem gemeinsam feuernden Neuronennetz, das sich auf bestimmte Reizmuster einspielt.
Früher dachte man, eine bestimmte Person wie die eigene Großmutter würde wie jedes andere Einzelwesen oder jeder Gegenstand in unserer Umwelt durch ein bestimmtes Neuron oder ein Neuronennetz gekennzeichnet, man sprach daher ironisch von einem "Großmutterneuron". Eine Realzuordnung, also die Referenz der Neuronen(aktivierungen) zu wirklichen Gegenständen der Außenwelt, geschieht aber nicht mit singulären "Gegenstandsneuronen", sondern ist wesentlich komplexer. Das Gefüge der Netzwerke ist vielmehr plastisch, jeweils zeitlich veränderbar und an Aktivierungsvorbedingungen angepasst. Christoph von der Malsburg hat die Hypothese aufgestellt, dass es plastischen Neuronennetze geben muss, die sehr schnell (d.h. aufgrund sehr weniger korrelierter Aktivierungen) verstärkt werden können. Diese können geradezu "blitzartig" eine relative, mehr oder minder kurzfristige Stabilität entwickeln. Er nahm an, dass das auf einer zu kombinierenden bzw. gemeinsamen Schwingungsgrundrate geschieht, der Grundschwingung von ca. 20-70 Hertz, mit denen die Neuronen gemeinsam feuern bzw. die Impulse im Neuron, im Axon, weitergegeben werden; es ist die sog. 40H-Schwingung. Dieser 40H-Schwingungen überlagern sich dann Modulierungen, die charakteristisch sind, und eine spezifische Modulierung entspricht einem bestimmten, dynamisch sich bildenden bzw. erhaltenden Netzwerk. Dabei schwingen dann entsprechende Neuronen gemeinsam, d.h. sie oszillieren kohärent und gehören in diesem Sinne "zusammen".
Siehe dazu auch ![]() Die
drei Gehirne
Die
drei Gehirne
Das "Bindungsproblem" der Neurowissenschaften
Hebbs Hypothesen sind daher auch für die Erklärung der parallelen Informationsverarbeitung im Gehirn wesentlich: Alle aufgenommenen (bzw. konstruierten) Informationen werden bekanntlich gleichzeitig in spezifischen Hirnarealen verarbeitet. Berücksichtigt man, dass wir zur Welt über verschiedene Sinneskanäle in Kontakt treten, stellt sich die Frage, wie es das Gehirn schafft, all die verschiedenen Informationen wieder zu einem kohärenten Ganzen zusammen zu setzen. Offensichtlich erleben wir die getrennten Wahrnehmungsaspekte eines Apfels (dessen Form, Farbe, Geschmack etc.) als zu ein und dem selben Objekt gehörend, also ganz anders, als es die Architektur unserer Hirnfunktionen erwarten ließe.
In den 1960er-Jahren entdeckten die Neurophysiologen David Hunter Hubel und Torsten Nils Wiesel, dass spezialisierte Nervenzellen im Hirn der Katze existieren, die nur durch visuelle Informationen über Objektkonturen - und sonst nichts - erregbar sind.
Zudem fand man in den 1980er-Jahren Nervenzellen, die sogar für optische Muster der Gesichtererkennung verantwortlich waren. Der polnische Neurotheoretiker Konorski folgerte aus solchen Befunden, dass das Gehirn in einer Art Hierarchie organisiert sein könnte. An der Basis dieser Hierarchie, so seine theoretische Überlegung, wären Nervenzellen, die mit allgemeine Eigenschaften - wie zum Beispiel Objektkonturen - beschäftigt seien. Weiter oben stünden dann Zellen, die speziellere Aspekte - wie zum Beispiel individuelle Personen - verarbeiten würden. Und an der Spitze wären dann Zellen zu suchen, an denen die gesamte parallel verteilte Information wieder zusammengeführt würde. Diese Zellen entsprächen dann in etwa dem von Descartes geforderten Zentrum, das gewissermaßen als Bühne des Bewusstseins fungierte.
Das Konzept der Informationspyramide ist aber zum Scheitern verurteilt, denn wenn es Neuronen gibt, die einzig damit beschäftigt sind, individuelle Objekte der Welt (z.B. Personen) zu repräsentieren, dann ergibt sich ein kombinatorisches Problem: Die Gegenstände der Welt sind so zahlreich, dass es unmöglich erscheint, dass diese durch eine begrenzte Zahl von Nervenzellen repräsentierbar wären. Berücksichtigt man zusätzlich, dass jedes Objekt unter Vielzahl von Blickwinkeln zu betrachten ist, dann erscheint es ausgeschlossen, dass sich unser Nervensystem einer solchen Strategie bedient.
Hebbs Lösung, dass das Gehirn die große Zahl an Umwelt-Objekten dann repräsentieren könnte, wenn Nervenzellen nicht einzeln, sondern im Verband gewisse Aspekte der Welt abarbeiteten und jede Nervenzelle in verschiedenen Neuronen-Teams mitarbeiten könnte, ist zwar eine Antwort auf das kombinatorische Problem,allerdings keine Antwort auf die Frage, wie das Gehirn "weiß", dass gewisse repräsentierte Eigenschaften zu ein und dem selben Objekt gehören, d.h., wie Form, Farbe, Geruch usw., die ja in verschiedenen Hirnarealen bearbeitet werden, letztlich zusammengeführt werden?
Die bekannteste Hypothese lautet: Die Bindung von Neuronen-Verbänden wird dadurch erreicht, dass diese einfach gleichzeitig aktiv sind. Mit anderen Worten, ihre Erregungsmuster sollten synchron ablaufen. Einer Arbeitsgruppe um Wolf Singer (Max Planck-Hirnforschungszentrum, Frankfurt) gelang es zum Ende des vorigen Jahrtausends, solche Synchronisationen in den Gehirnen von Katzen und Affen nachzuweisen. Bisher konnte allerdings noch nicht eindeutig gezeigt werden, dass diese Erregungsmuster notwendig unserer subjektiv empfundenen Einheit der Wahrnehmung zugrunde liegen.
Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Vorstellung einer "modularen Struktur", also einer bau(stein)kastenartigen Verfassung unseres Gehirns, das nach gewissen funktionsspezifisch bestimmten Einheiten strukturiert ist bzw. danach funktioniert. Jerry Fodor entwickelte 1983 in seinem Buch "The Modularity of Mind" die Grundgedanken für eine "Modulhaftigkeit" unseres Gehirns. Solche Module
- operieren relativ schnell, (wie z.B. die benachbart und/oder zugleich aktivierten Neuronenensembles),
- arbeiten relativ autonom,
- springen sogar automatisch ans (wie z.B. Reflexe),
- sind bereichsspezifisch unterschiedlich (Sehen, Hören, Fühlen),
- sind informationell geschlossen und
- sind auch noch "verbindlich", d. h., dass sie für jeden relevanten Reiz auch notwendig ansprechen müssen.
Anekdotisches
David Hubel und Torsten Wiesel führten als Jungforscher an der Harvard University mit Elektroden im Gehirn lebender Katzen Experimente durch, die in der Folge die Hirnforschung grundlegend verändern sollten bzw. das junge Fach der Neurobiologie mitformten. Hubel und Wiesel hatten ihre Elektrode in den visuellen Cortex von Katzen versenkt und versuchten, eine einzelne Zelle zum Leben zu erwecken, indem sie unterschiedliche Objekte auf die Netzhaut der Tiere projizierten. Doch so lange sie es auch probierten, die Zelle blieb stumm, selbst als die beiden mit Fotos von Models aus Magazinen versuchten. Erst ein Zufall brachte die entscheidende Wende: Beim Wechseln des Dias im Projektor begann die Zelle, in die sie ihre Elektrode platziert hatten, plötzlich heftig zu feuern, d. h., die Zelle hatte auf den Diarahmen angesprochen. Damit konnte man nachzuweisen, dass jede Zelle in diesem Teil der Sehrinde auf Balken ganz bestimmter Orientierung und Bewegung reagierte. Hubel und Wiesel waren also auf zelluläre Spezialisierungen des Erkennens bestimmter Elemente im Blickfeld gestoßen. Dieses Prinzip gilt inzwischen als Grundlage fast aller Sinnesverarbeitung: Zuerst werden die ins Gehirn gelangenden Reize anhand einfacher Kriterien in verschiedene Verarbeitungskanäle aufgespalten, etwa nach Farbe, Bewegung, Orientierung oder Kontur. Diese Information wird dann an eine Hierarche immer komplexerer Verarbeitungszentren weitergereicht, an deren Ende Zellen stehen, die Gesichter oder Orte erkennen können.
Hubel und Wiesel erhielten 1981 schließlich den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Danach entdeckten Wissenschaftler auch Nervenzellen, die auf andere Eigenschaften spezialisiert sind, etwa auf Farben, Bewegungsrichtungen oder gar auf ganz bestimmte Merkmale von Gesichtern. Nachgeschaltete Hirnregionen setzen dann aus einer Fülle solcher Informationen schließlich ein Bild der Welt um den Menschen herum zusammen. Doch beruhen diese Ergebnisse allerdings in erster Linie auf Aktivitätsmessungen bei wenigen einzelnen Nervenzellen. Neuere Untersuchungen in einem größeren Maßstab, die Daten von insgesamt rund 60 000 unterschiedlichen Neuronen im visuellen Cortex von Mäusen betrachteten, zeigten aber, dass sich gerade einmal zehn Prozent der Zellen tatsächlich so verhalten, wie man es auf Basis der Erkenntnisse von Hubel und Wiesel erwarten würde. Von den übrigen Neuronen reagierten zwei Drittel noch deutlich spezialisierter und ein Drittel zeigte Aktivitätsmuster, die zu keinem der zahlreichen visuellen Eindrücke passen wollten, die man den Tieren präsentierte. Möglicherweise sind diese Neuronen aber auf so spezifische Merkmale gepolt, dass sie erst im Zuge späterer Verarbeitungsschritte aktiv werden. Dabei sind die Ergebnisse der früheren Untersuchungen nicht falsch, sondern treffen lediglich auf einen sehr kleinen Teil der Nervenzellen im Cortex zu. Offenbar ist die Sehrinde von Mäusen deutlich komplexer aufgebaut, als man bislang dachte, und ob das auch für den visuellen Cortex etwa des Menschen gilt, ist ebenfalls noch ungeklärt (Zeibig, 2019).
Literatur
Edelmann, W. (1994). Lernpsychologie. Eine Einführung. München Weinheim.
Lefrancois, G. R. (1994). Psychologie des Lernens. Berlin: Springer.
Singer, Wolf (2002). Der Beobachter im Gehirn. Suhrkamp.
Zeibig, D. (2019). Wie die Welt im Kopf entsteht. Spektrum.de vom 17. Dezember 2019.
Bildquelle:
http://www.wagner.edu/faculty/users/lnolan/302/thorndike.jpg (03-09-02)
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::
