 Die frühkindliche Bindung an die Bezugsperson
Die frühkindliche Bindung an die Bezugsperson
Unter Verwendung von Kramar, T. & Tomasowsky, D. (2007). Entwicklungsbiologie: Es zählt die Qualität der Betreuung. Die Presse 23.02.2007, S. 3.
Brauer, J., Xiao, Y., Poulain, T., Friederici, A. & Schirmer, A. (2016). Frequency of maternal touch predicts resting activity and connectivity of the developing social brain. Cerebral Cortex, 26, 3544-3552.
Fearon, R. Pasco, Bakermans-Kranenburg Marian J., van IJzendoorn, .Marinus H., Lapsley, Anne-Marie & Roisman, Glenn I. (2010). The Significance of Insecure Attachment and Disorganization in the Development of Children's Externalizing Behavior: A Meta-Analytic Study. Child Development, 81, 435 - 456.
Grossmann, Karin & Grossmann, Klaus (2004). Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta.
Leder, M. (2004). Elterliche Fürsorge – ein vergessenes soziales Grundmotiv. Zeitschrift für Psychologie, 212, 10-24.
Medicus, G. (2007). Aspekte der frühkindlichen Bindung und ihrer Auswirkungen. Vorlesungsmanuskript.
WWW: http://homepage.uibk.ac.at/~c720126/humanethologie/ss/medicus/block2/BindungLoesung.pdf (18-08-08)
Nguyen, T., Kayhan, E., Schleihauf, H., Matthes, D., Vrticka, P., & Höhl, S. (2018). The effects of caregiving and attachment on neural synchrony in mother-child interactions. 4th International Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience, Leiden, Niederlande.
Schild, B. (Hrsg.) (2017). Fremdplatziert in der Bildungslandschaft – Förderung für Kinder und Jugendliche, die außerhalb der Herkunftsfamilie leben. Pabst.
Wolff, U. & Ziegenhain, U. (2000). Der Umgang mit Unvertrautem – Bindungsbeziehung und Krippeneintritt. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 177-188.
Bindung im Frühkindalter für ganzes Leben wichtig Frühes emotionales Verhältnis fördert die Gehirnentwicklung Kinder brauchen eine fixe Bezugsperson (pressetext austria vom 14.4.2009)
http://de.wikipedia.org/wiki/ Bindungstheorie (09-02-02)
https://derstandard.at/2000102886999/Wie-Mutter-und-Kind-auf-eine-Wellenlaenge-kommen (19-05-12)
OÖN vom 24. September 2019
Siehe dazu auch
Geschichte der Kindererziehung
Erziehung und Kultur
Wertewandel in der Kindererziehung
Neuere Entwicklungen
in der Kindererziehung
Auswirkungen von Schichtunterschieden
Mögliche Ursachen von Unterschieden
Erziehungsstile
Begriffsbestimmung und Begriffsabgrenzungen
Grenzen und Auswirkungen
der Erziehung
Elterliche Fürsorge – ein soziales Grundmotiv
Bindungsbeziehung und Krippeneintritt
Grundlegende Merkmale
von Erziehung und Unterricht
Praktische Tipps zur Kindererziehung
Wie mache ich es richtig?
Mit sechs Monaten beginnt die Bindung an die primäre Bezugsperson. Diese wird aber nach neueren Erkenntnissen durch eine zeitlich begrenzte außerfamiliäre Betreuung nicht grundlegend gestört. Der britische Arzt und Psychoanalytiker John Bowlby war der erste, der die kindliche Entwicklung konsequent aus evolutionärer, darwinistischer Sicht betrachtete. Dass Darwin so kränklich war, erklärte Bowlby durch den frühen Verlust seiner Mutter. Bowlby selbst klagte, dass seine Mutter ihn jeden Tag nur eine Stunde zum Tee gesehen und mit sechs Jahren ins Internat gesteckt hatte.
Auch wenn das Kind das aktive Element in dieser Bindung darstellt, haben Eltern für die Voraussetzungen zu sorgen, dass die Bindung aufrecht erhalten werden kann. Es handelt sich dabei um keine symmetrische Beziehung, denn die Eltern müssen den Kindern Schutz bieten und auf deren Bedürfnisse reagieren. Jede andere Haltung würde ein Kind überfordern. Die Münchner Frühpädagogin Becker-Stoll hebt dabei die Rolle des Vaters in den ersten Lebenswochen des Kindes hervor, denn die ersten zwei Wochen nach der Geburt sollte der Vater ganz der Familie gehören und die Mutter unterstützen, damit sie sich ganz dem Kind widmen kann. Dienstreisen haben ihrer Meinung nach hier nichts verloren. Förderlich für das elterliche Feingefühl ist aber auch ein Augenmerk auf die Paarbeziehung, denn Eltern können nur dann gute Eltern sein, wie es ihnen selbst gut geht, wobei gezielte Hilfe von außen und soziale Netzwerke sehr hilfreich sind.
Bowlby hat mit Mary Ainsworth die Bindungsentwicklung in den ersten Jahren nach der Geburt untersucht, wobei das Fürsorgeverhalten der Mutter zum sogenannten "Bonding" führt. "Bindung" bedeutet dabei , dass das Kind sich etwas "sagen lasst". Sie unterscheiden dabei verschiedene Phasen der Bindung, die unterschiedliche Auswirkungen bei einer Störung bedingen. In Längsschnittstudien wurden verschiedene Bindungstypen gefunden. Siehe dazu im Detail Frühkindliche Verletzlichkeit.
Diese Bindung, wie sie Bowlby etwa in "The Nature of the Child's Tie to his Mother" (1958) konstatierte, bildet sich jedoch wesentlich früher, denn im Alter von sechs bis 18 Monaten findet jene massive Entwicklung von Regionen in den Stirnlappen des Gehirns statt, die zum für Emotionen zuständigen limbischen System gehören. So beginnen Kinder mit frühestens sechs Monaten, Zeichen echter Zuneigung zu zeigen, denn erst sechs Monate nach der Geburt wird der Mensch "kommunikativ", da zu diesem Zeitpunkt der Stirnlappen aktiviert wird und es zur ersten echten wechselseitig empfundenen Beziehung kommt. Jetzt wird die Welt erstmals eingeteilt in nah und fern, in dazugehörig und fremd. Und fremd ist unangenehm. Das typische Fremdeln dauert etwa bis zum Alter von eineinhalb Jahren. Zwar können Kinder dieses Alters einem vollkommen Unbekannten durchaus ein Lächeln schenken, Hirnmessungen aber zeigen, dass dieses Lächeln nicht Ausdruck echt empfundener Zuneigung ist. Enge emotionale Kontakte mit Kleinkindern fördern die Entwicklung der neuronalen Netzwerke im Bereich des Emotionalen, während negative Erfahrungen zu fehlerhaften Netzwerken führen. Bindung an eine Bezugsperson ist der erste tiefgreifende emotionale Prozess, der das Gehirn eines Neugeborenen beeinflusst, und diese Erfahrung ist grundlegend, da Emotionen auch an allen späteren Lernprozessen beteiligt sind. Frühe Trennungserfahrungen von Kindern führen zu einem Anstieg der Stresshormone, die ihrerseits hohen Einfluss auf Strukturveränderungen im Gehirn haben, sodass eine traumatische Erfahrung oder ein Übermaß an Stress in frühen Entwicklungsphasen später zu Verhaltens- und Lernstörungen führen kann bis hin zu psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen.
Während John Bowlby auf der Grundlage seiner empirischen Befunde strikt die These vertrat, dass für den Aufbau einer stabilen Bindung die Beziehung des Kindes zu einer zentralen Bindungsperson konstitutiv sei, haben neuere Forschungen gezeigt, dass Kindern ein solcher Bindungsaufbau auch dann gelingt, wenn gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen bestehen. Dies betrifft in erster Linie eine Aufwertung der Bedeutung des Vaters, aber auch einer Pflegemutter, zu der Kinder oft intensive Beziehungen aufbauen. Hierbei wird jedoch beobachtet, dass das Kind eine deutliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen Bindungspersonen vornimmt, indem es ihnen unterschiedliche Funktionen zuordnet (z.B. bleibt die leibliche Mutter häufig die zentrale Bindungsperson, an die das Kind sich vorrangig wendet, wenn es sich schlecht fühlt). Selbst sehr kleine Kinder sind in der Lage, etwa die Beziehung zu einer Tagesmutter in einer Kindertagesstätte auf einen funktionalen Aspekt zu reduzieren, wenn sie vorher zu ihrer primären Bindungsperson eine sichere Bindung aufgebaut haben. Die Eingewöhnung gelingt nachweislich besser, wenn das Kind in der Anfangsphase von der Mutter begleitet und somit schonend in die neue Situation eingeführt wird.
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich bei Kleinstkindern die Gehirne von Mutter und Kind synchronisieren, denn in einem Experiment beobachteten die Kinder ihre Mutter, die entweder positiv oder negativ auf bestimmte Objekte reagierte. Anschließend wurden den Kindern die zuvor gezeigten Objekte zum Spielen angeboten. Babys, deren Gehirn sich mit dem der Mutter synchronisierte, richteten sich bei ihrer Spielentscheidung eher nach den mütterlichen Vorgaben, d. h., sie zogen jenes Spielzeug vor, auf das die Mutter positiv reagiert hatte und mieden solches, das mit negativen Reaktionen verknüpft war. Wie synchron die Gehirnaktivität war, hing dabei auch von der Qualität der Kommunikation zwischen Mutter und Nachwuchs ab, wobei soziale Signale wie häufiger Augenkontakt mit einer erhöhten Synchronität und einem besseren Lernerfolg einhergingen. In den ersten Lebensmonaten hängen der Aufbau einer stabilen Bindung mit den Bezugspersonen, die emotionale Entwicklung und das frühe Lernen eng zusammen. Wenn Mutter und Kind dabei in intensivem Kontakt sind, gleicht sich aber nicht nur deren Verhalten an, sondern auch deren Muster in den Gehirnaktivitäten. Über den Körperkontakt spürt das Kind den Herzschlag der Mutter, das Streicheln, Sprechen, Wiegen und Tragen erzeugt Rhythmen, die den Erregungspegel des Kindes beeinflussen und es meist beruhigen. Diese Synchronisation der Rhythmen ermöglicht es, dass sich Bezugsperson und Kind aufeinander einstellen und eine Bindung entsteht, wobei diese Synchronisation die Welt für das Baby vorhersagbarer macht. Dieser Takt der unmittelbaren Umgebung ist wohl eine erste Orientierungshilfe, mit der Neugeborene lernen, die überwältigenden Fülle an Sinneseindrücken zu ordnen. Dieses Aufeinandereinpegeln zweier Menschen zeigt sich somit nicht nur im Verhalten, sondern auch Herzfrequenz und Hormonspiegel gleichen sich bei beiden an. Nguyen et al. (2018) haben in Studien gezeigt, dass sich die Rhythmen der Gehirnströme aneinander angleichen, wenn sich eine Mutter mit ihrem Kind beschäftigt, d. h., beide sind auf einer Wellenlänge bzw. im selben Rhythmus. Das erhöht offenbar auch die Aufnahmebereitschaft für neue Informationen. So schauten sich in einer Studie neun Monate alte Säuglinge gemeinsam mit der Versuchsleiterin Bilder von Spielzeug auf einem Computermonitor an. Wenn die Versuchsleiterin direkten Blickkontakt mit dem Kind aufnahm, bevor das Spielzeug auf dem Bildschirm erschien, glich sich nicht nur der Rhythmus der Aktivität im Gehirn an, sondern die Kinder reagierten auch mit deutlich höherer Aufmerksamkeit auf die Bilder, als wenn beide einfach gemeinsam die Gegenstände ohne spezielle Zuwendung betrachteten. In einem weiteren Experiment mussten Fünfjährige mit ihren Müttern Puzzles lösen, wobei je mehr beide aufeinander eingingen, desto mehr passten sich deren Gehirnströme aneinander an. Je synchroner die neuronalen Rhythmen waren, desto schneller konnten sie übrigens auch die Rätsel lösen. Außerdem waren jene Kinder, die stärker von der Mutter eingebunden wurden, von sich aus aktiver bei der Lösung der Aufgaben.
In einer neueren Studie untersuchten Nguyen et al. (2024) daher, ob interpersonale neuronale und verhaltensbezogene Synchronie während der Eltern-Kind-Interaktion mit den Bindungsrepräsentationen von Eltern und Kind zusammenhängt. Dazu führten 140 Eltern (74 Mütter und 66 Väter) und ihre Kinder (im Alter von 5-6 Jahren; 60 Mädchen und 80 Jungen) kooperative und individuelle Problemlösungsaufgaben durch, während die frontalen und temporalen Regionen mit funktioneller Nahinfrarotspektroskopie (bei der auf einer Kappe angebrachte Sensoren aufzeichnen, wie stark die jeweiligen Gehirnregionen mit Sauerstoff versorgt werden) gemessen wurden. Die Hirnscans bestätigten, dass die Zusammenarbeit tatsächlich zu einer höheren neuronalen Synchronisation führt als das alleinige Lösen einer Aufgabe: Eltern und Kinder waren beim gemeinsamen Puzzeln neuronal stärker auf einer Wellenlänge, wobei die Hirnareale, die helfen, sich in den anderen hineinzuversetzen, und jene, die für die Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstregulation zuständig sind, synchronisiert waren. Beim Vergleich der Hirndaten zeigte sich zudem, dass die Hirnströme der Eltern-Kind-Paare nicht immer gleich synchron waren, denn das Ausmaß der neuronalen Synchronie variierte je nach Eltern-Kind-Beziehung, wobei überraschenderweise die Gehirne von Vätern und Müttern mit unsicherer Bindungserfahrung stärker mit ihren Kindern synchron waren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine hohe neuronale Synchronie nicht immer positiv bewertet werden sollte, da eine mittlere Synchronie möglicherweise ein besseres Zeichen für eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung ist. Frühere Studien deuten darauf hin, dass unsicher gebundene Eltern eher Schwierigkeiten haben, sich auf die Interaktion mit ihren Kindern einzulassen, und dass solche Eltern-Kind-Paare daher weniger gut synchronisiert sind. Diese Befunde deuten darauf hin, dass bei Eltern-Kind-Paaren mit unsicher gebundenen Müttern eine stark ausgeprägte neuronale Synchronisation für eine gelingende Interaktion besonders notwendig ist, d.h. diese Paare müssen sich mental mehr anstrengen, um gut miteinander zu harmonieren. Neuronale Synchronisation kann also ein nützlicher, aber anstrengender Bindungsmechanismus sein.Heimkinder und Pflegekinder
Allerdings haben Kinder, die in Pflege- oder Adoptivfamilien aufwachsen, trotz aller öffentlichen Fürsorge dennoch gravierende Störungen ihres Gebundenseins erlitten, und entwickeln in der Folge Bindungs- und Vertrauensstörungen. Menschen sind dort zu Hause, wo sie verstanden werden, wobei die Feinfühligkeit der Eltern eine sichere Bindungsentwicklung fördert, denn das bedeutet Zuverlässigkeit, eine wesentliche Grundvoraussetzung für emotionales und soziales Wachsen, für Ordnung, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Für betreuende Pflegefamilien, Heimbetreuer und die Kinder selbst ergeben sich dadurch oft schwerwiegende Beziehungsprobleme, besonders wenn die Ersatzeltern darauf nicht ausreichend vorbereitet sind oder unrealistische Erwartungen an das Kind hegen. Fast ein Prozent der Kinder und Jugendlichen lebt außerhalb der Herkunftsfamilien, d. h., in einem Heim, bei Pflege- oder Adoptiveltern, wobei fast alle Betroffenen in ihren ersten Lebensjahren in irgendeiner Form verletzt worden ist, etwa mit einer nachhaltig andauernden Belastung und auch neuen kritischen Erlebnissen in der Fremdplatzierung. Untersuchungen zeigen, dass die Bildungschancen bei diesen Kindern und Jugendlichen damit wesentlich eingeschränkt sind. Vor allem hängt ihr Bildungserfolg nicht allein von ihren individuellen Begabungen und Fähigkeiten ab, sondern ist an spezifische Voraussetzungen geknüpft: Stabilität, Vertrauen und Wertschätzung vermittelnde soziale Beziehungen. Die Chance für einen erfolgreichen Bildungsverlauf ist dann umso größer, je mehr derartige Beziehungen mit Bildungssettings und bildungsförderlichen sozialen Orten verbunden sind. Außerdem scheint eine gute Kooperationsbasis zwischen Bildungssetting und Betreuungssetting wichtig zu sein, in die idealerweise auch die Herkunftsfamilie einbezogen wird. Internationale Befunde deuten darauf hin, dass Kinder in einer Pflegefamilie drei- bis viermal häufiger Gefährdung erfahren als der Durchschnitt aller Kinder. Nach einer englischen Studie haben Heim- und Pflegekinder aus unterschiedlichen Gründen ein mehrfach erhöhtes Risiko, während der Fremdbetreuung misshandelt oder ausgebeutet zu werden. Deshalb ist eine gute und stete Begleitung der Platzierungsverhältnisse und der betroffenen Kinder selber sowie die kontinuierliche Einbindung in ein Netz von Beteiligten aus Tagesstätte, Kindergarten, Schule, Elternhaus, Behörden, Personal der Fremdunterbringung, TherapeutIn notwendig (Schild, 2017).
Säuglinge, die in Heimen ohne Möglichkeit einer Bindung leben müssen, schreien im ersten Halbjahr besonders viel, beruhigen sich aber sehr rasch, wenn sie aus dem Bett genommen werden. Diese Säuglinge versuchen Bindungskontakt aufzunehmen, wenn aber die Bezugspersonen ständig wechseln, erlöschen im zweiten Halbjahr ihre Versuche, Kontakt aufzunehmen, wirken dann ernst und zeigen Merkmale einer depressiven Verstimmung, es entwickeln sich Verhaltensstereotypien, sie vermeiden häufig den direkten Blickkontakt und neigen auch dazu, sich wahllos an Erwachsene zu klammern um Hautkontakt zu suchen. In der Praxis sind Bindungsstörungen später oft verbunden mit ADHS und Störungen des Sozialverhaltens. Kinder, die in schwierige Verhältnisse hinein geboren werden, weisen allerdings oftmals bereits genetische Belastungsfaktoren auf, die ADHS oder kognitive Störungen begünstigen können. Diese Kinder zeigen schon in der frühen Kindheit Anpassungsstörungen, Regulationsstörungen, Fütterstörungen, Störungen des Schlaf-/Wachrhythmus, wobei ein Teufelskreis entsteht, denn das ist sehr oft anstrengend für die Eltern, was bei diesen nicht nur positive Gefühle auslöst, sondern auch negative problematische Reaktionen, die bis zu psychischer oder gar körperlicher Misshandlung gehen können. Kinder, die von Geburt oder der frühen Kindheit an unter solchen Risikofaktoren leben, erleiden in vielen Fällen fast zwangsläufig Bindungsstörungen, zu denen oft Traumatisierungen etwa durch Gewalterfahrungen hinzukommen. Im Jugendalter zeigen Heimkinder oft eine distanzlose Zutraulichkeit zu Unbekannten und können als Erwachsene infolge ihres Bindungstraumas sogar eine Depressionsneigung entwickeln.
Bindungsstile bei Haustieren
Diese Bindung ist der instinktiven Prägung, die Konrad Lorenz an Gänsen erforschte, zwar ähnlich, doch findet diese sofort nach dem Schlüpfen statt und betrifft automatisch die Figur, die das Küken als erstes erblickt, das kann auch ein bärtiger Forscher sein. Wieso beginnen Menschen erst so lange nach der Geburt, Bindungen zu entwickeln? Weil ihre Bindungen nicht nach automatisch ablaufenden Programmen gebildet werden und weil das menschliche Gehirn bei der Geburt ein ziemlich unfertiges Organ ist. Enten können bald nach der Geburt davonwatscheln, Menschen laufen der Mutter frühestens mit einem dreiviertel Jahr davon, wobei sich die selbstständige Fortbewegung und die emotionale Bindung an die Bezugsperson synchron entwickeln.
Bei aller Unabhängigkeit sind Katzen auch dafür bekannt, tiefe emotionale Bindungen mit ihrem Menschen einzugehen, wobei sich Katzen auf ähnliche Weise an ihre menschlichen Bezugspersonen binden wie kleine Kinder an ihre Eltern. In einer Studie mussten Besitzer ihre junge Katzen im Alter von drei bis acht Monaten in einen durch Kameras überwachten Raum mitnehmen, in dem sie zunächst zwei Minuten mit dem Tier zusammen waren, dann aber allein hinausgingen. Erst nach zwei Minuten kehrten die Besitzer zurück, wobei bei etwa 65 Prozent der Katzen der Stress durch die Rückkehr der Besitzer sofort nach ließ, d. h., sie suchten die Nähe und erkundeten dann weiter den Raum. Ein Verhaltensmuster, das bei Menschen als sichere Bindung bezeichnet wird, wobei sich dieser Prozentsatz mit dem bei Kindern deckt, während der Rest unsicher gebunden war und auf Trennung extrem verunsichert reagiert.

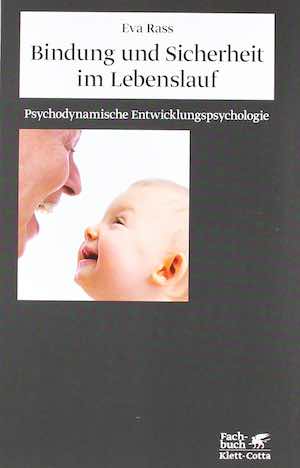 Die Bedeutung des "Urvertrauens" im Leben eines Kindes geht übrigens auf Forschungen des amerikanischen Psychologen Harry Harlow
zurück, der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Intelligenz und
Sozialverhalten von Rhesusaffen studierte. Harlow machte seine Studien
in einer Zeit, in der Forschung über die Bedeutung von Liebe und
Beziehungen in einer Wissenschaft und somit auch nicht in der
Psychologie etwas zu suchen hatten. Sie galten vor allem auf Grund des
herrschenden Behaviorismus nichts, da Beziehungen und andere emotionale
Regungen des Menschen als etwas betrachtet wurden, das der noch jungen
wissenschaftlichen Psychologie nur einen Ruf der Unseriosität
einbringen würde. Als der experimentelle arbeitende Psychologe Harlow
einen Lehrstuhl annimmt, dominiert gerade die Lehrmeinung von John B.
Watson und seiner Anhänger, die Mutterliebe als gefährliches Instrument
einstuften. Nach der hohen Säuglingssterblichkeit, die man zuvor in
Kinderheimen beobachtet hatte, setzte sich das Prinzip höchster und
damit auch emotionaler Sterilität in der Wissenschaft durch, denn wer
Kinder bemutterte, schwächte sie.
Die Bedeutung des "Urvertrauens" im Leben eines Kindes geht übrigens auf Forschungen des amerikanischen Psychologen Harry Harlow
zurück, der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Intelligenz und
Sozialverhalten von Rhesusaffen studierte. Harlow machte seine Studien
in einer Zeit, in der Forschung über die Bedeutung von Liebe und
Beziehungen in einer Wissenschaft und somit auch nicht in der
Psychologie etwas zu suchen hatten. Sie galten vor allem auf Grund des
herrschenden Behaviorismus nichts, da Beziehungen und andere emotionale
Regungen des Menschen als etwas betrachtet wurden, das der noch jungen
wissenschaftlichen Psychologie nur einen Ruf der Unseriosität
einbringen würde. Als der experimentelle arbeitende Psychologe Harlow
einen Lehrstuhl annimmt, dominiert gerade die Lehrmeinung von John B.
Watson und seiner Anhänger, die Mutterliebe als gefährliches Instrument
einstuften. Nach der hohen Säuglingssterblichkeit, die man zuvor in
Kinderheimen beobachtet hatte, setzte sich das Prinzip höchster und
damit auch emotionaler Sterilität in der Wissenschaft durch, denn wer
Kinder bemutterte, schwächte sie.
Allerdings ist Mutterliebe nach Ansicht von Medicus (2007) ein Säugererbe und nicht das Ergebnis der Zivilisation, sodass es sie in allen menschlichen Populationen gibt. Es wäre aus biologischer Sicht unverständlich, warum etwa Affen Mutterliebe zeigen sollten und ausgerechnet der nackte Affe Mensch nicht. Mutterliebe und die Bindung des Kindes an die Mutter sind etwas Natürliches und nicht eine durch Werbung für Babynahrung getriggerte kulturelle Errungenschaft. Stammesgeschichtlich jung ist hingegen die väterliche Brutpflege beim Menschen und stellt wohl eine Entwicklung aus dem Tier-Mensch-Übergangsfeld dar. In den meisten Fällen ist beim Menschen die Bindung des Kindes an seine Mutter stärker ausgeprägt als die an seinen Vater, vermutlich weil die Mutterbindung das Sicherheitssystem stärker anspricht, die Vaterbindung mehr das Erregungssystem betreffend Erkunden und Neugier.
Harlow ließ in seinen ethisch umstrittenen Versuchen die Tiere auch unsägliche emotionale Qualen leiden, um alles über deren Entwicklung zu erfahren. So isolierte er sie monatelang, machte sie depressiv. An der University of Wisconsin in Madison baute er eines der ersten Primatenlabors auf, wobei den Versuchstieren Teile der Hirnrinde entfernt oder starke Strahlendosen verpasst wurden, um zu sehen, wie sich das auf deren Lernvermögen auswirkt. Trennte man die Tiere unmittelbar nach der Geburt von ihren Müttern, zeigten sie extreme Anhänglichkeit zu Frotteehandtüchern, die auf dem Boden ihrer Käfige herumlagen. Nahm man sie ihnen fort, begannen sie zu schreien. Aus Stacheldraht, einer wärmenden Glühbirne und einem Saugnippel konstruierte Harlow eine Surrogatmutter, die bei Bedarf rund um die Uhr Milch spendete. Ein zweites Gestell war nur mit einem Frotteefell überzogen. Doch darauf stürzten sich die verwaisten Rhesusäffchen, als sei es die leibliche Mutter. Die Milchpuppe ließ sie, abgesehen von kurzen Besuchen zur Nahrungsaufnahme, vollkommen kalt. An dieser Präferenz änderte sich auch dann nichts, wenn die künstlichen Mütter mit allerlei Attributen versehen wurden; selbst wenn sie eiskalte Luft verströmten oder auf ihr Baby einstachen, wurden sie verzweifelt akzeptiert. Gestattete man nicht einmal diesen Kontakt, verfielen die kleinen Affen in tiefste Apathie. Harry Harlow war überzeugt, die messbare Komponente der Mutter-Kind-Liebe gefunden zu haben: den Grad an körperlicher Berührung, der einem Primatenkind zugestanden wurde. Er zog eine Schlussfolgerung, die weit über die experimentellen Befunde hinausreichte: Auch der Mann sei von Natur aus mit allen körperlichen Attributen ausgestattet, ein Kind aufzuziehen. Stillende Mütter würden zu Hause nicht mehr gebraucht, sie könnten stattdessen getrost zur Arbeit gehen. Später zeigte sich jedoch, dass die auf Frotteehandtücher fixierten Tiere schwere Verhaltensstörungen entwickelten.
Brauer et al. (2016) filmten in einem Experiment 43 Kinder im Alter von durchschnittlich fünfeinhalb Jahren und deren Mütter beim gemeinsamen Spiel, wobei die Mütter zwar wussten, dass sie gefilmt wurden, das Ziel der Studie jedoch nicht kannten. Auf Grundlage der Aufnahmen analysierten die Wissenschaftler die Berührungshäufigkeit zwischen Müttern und Kindern, wie oft sie also den körperlichen Kontakt mit dem jeweils anderen suchten. Bei der Betrachtung der kindlichen Gehirne zeigte sich, dass die Kinder, die während des Spiels häufiger von ihren Müttern berührt wurden, im Ruhezustand eine prinzipiell höhere Aktivität in jenen Hirnarealen aufwiesen, die mit Empathie, Perspektivübernahme sowie sozialen und emotionalen Fähigkeiten assoziiert sind. Dieser Effekt blieb auch bestehen, wenn die Berührungen, die vom Kind selbst ausgingen, herausgerechnet wurden. Zwar handelt es sich bei den Ergebnissen um Korrelationen, also Zusammenhänge, bei denen Ursache und Wirkung nicht klar bestimmbar sind, und dass auch eine Vielzahl möglicher Einflussfaktoren nicht berücksichtigt wurden, doch kann vor der Hintergrund der oben beschriebenen klassischen Bindungsstudien durchaus von einer kausalen Beziehung zwischen körperlicher Berührung und der Entwicklung des sozialen Gehirns ausgegangen werden.
Stört es die Bindung, wenn die Mutter während des Tages arbeitet?
Studien in den USA ergaben, dass bei Kleinkindern berufstätiger Mütter die Mutterbindung häufiger instabil ist als bei jenen von Hausfrauen, auch wenn der Unterschied nur gering war (z.B. 37% versus 29%). Darufhin startete das "National Institute of Child Health and Human Development" (NICHD) 1991 eine Langzeitstudie an über 1300 Kindern aus allen größeren ethnischen Gruppen und sozialen Schichten. Dabei wurde auch durch Fragen über Aktivitäten von Wickeln bis Trösten, aber auch über Gefühle die Qualität der Betreuung festgehalten. Man fand, dass es bei der Entwicklung einer Bindung eher auf die Qualität der Beziehung ankommt, vor allem darauf, wie einfühlsam die primäre Bezugsperson in den meisten Fällen die Mutter während der gemeinsamen Zeit auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Geringeren, aber immer noch signifikanten Einfluss hat die Qualität der außerfamiliären Betreuung. Diese ist umso besser, je seltener die Betreuungspersonen wechseln, je einfühlsamer sie sind und je kleiner die Gruppe ist. Kinder, die in Krippen mit mindestens vier Kinder waren, haben später im Kindergarten weniger Verhaltensprobleme.
Die Mutter-Kind-Beziehung wird nach diesen Ergebnissen durch eine frühe Fremdbetreuung jedenfalls nicht beeinfluss, sodass Eltern keine Schuldgefühle haben sollten, wenn Vater und Mutter außer Haus arbeiten. Wichtig ist hingegen ein fließender Übergang von familiärer in außerfamiliäre Betreuung, denn nach Ansicht von Wilfried Datler (Uni Wien) gibt es Hinweise darauf, dass es hilfreich ist, wenn mehrere Kinder gemeinsam den Neuanfang erleben, etwa beim Start der Kinderkrippe im Herbst. Jede Trennung ist eine Belastung für das Kind, aber nicht per se schlecht, denn Kinder müssen lernen, mit Belastungen umzugehen.
Bindung und spätere Entwicklung
Bindung beginnt letztlich bei der Geburt und ist dann gegeben, wenn sich ein Kind sicher und beschützt fühlt, wenn es die Umwelt erkundet, selbstständig wird und sich in psychologisch Sinn positiv entwickelt. Eine sichere Bindung fördert nach den Ergebnissen bisheriger Forschung die soziale Kompetenz, das Selbstvertrauen und auch die Selbstregulation, also alles Faktoren, die auch einen Schutz vor aggressivem Verhalten darstellen. Die emotionale Bindung eines Kleinkinds zu einer Bezugsperson bzw. zu seinen Eltern hat also eine hohe Bedeutung für dessen weitere Entwicklung, denn diese ist die beste Voraussetzung für ein Kind, auch im Jugend- oder Erwachsenenalter Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen zu können. Bindung bedeutet, dass das Kind ein Urvertrauen zu einer einzigen Person aufbaut, die nicht austauschbar ist, wobei dieses Bedürfnis des Kindes biologisch verankert ist und zu einer hohen Qualität der Beziehung führen kann, wenn die erwachsene Person darauf mit dem richtigen Verhalten antwortet. Wenn ein Erwachsener für ein Kind einschätzbar ist, dann ist auch das Kind für den Erwachsenen einschätzbar, sodass Bindung immer relational ist und für beide Seiten gilt. Unsicher gebundene Kinder haben später weniger Beziehungen, sind rigider im Denken und Handeln, zeigen eher Probleme in der Sprache und Kommunikationsentwicklung und verlassen sich mehr auf sich selbst als auf andere Menschen. Störungen durch fehlende Sicherheit und Stabilität im frühen Kindesalter begleiten einen Menschen oft durch sein ganzes weiteres Leben, und bei besonderen lebenskritischen Ereignissen wie dem Schuleintritt, der Pubertät oder dem Übergang zum eigenständigen Leben brechen diese wieder auf. Eine früh erworbene und verfestigte Bindung ist übrigens manchmal so fest, dass sie selbst gegenüber der betreffenden Person auch dann hält, wenn diese das Kind schlecht behandelt bzw. sogar misshandelt.
Man vermutet, dass das Zeitfenster für soziale Kompetenz oder emotionale Entwicklung mit einem bestimmten Kindesalter abgeschlossen ist, wobei solche verpassten Zeitfenster später nur mit einem erheblich höheren Aufwand nachzuholen sind. Die Trennung von der Bindungsperson bedeutet für jedes Kind großes seelisches Leid, sodass die Erschütterung und Trauer etwa beim Verlust der Eltern schon bei Kleinkindern feststellbar ist, wobei nach Studien die Trennung von der Mutter bei Säuglingen zur Regression und sogar zum Tod führen kann.
Wechsel und Übergänge zwischen Bindungspersonen sollten daher so gering wie möglich gehalten werden, denn ändert sich die Erziehungsperson, so sollte dies nur einen Übergang zu einer dann weiteren konstanten Person (z.B. Großeltern oder Pflegefamilien) sein, wobei nach einer Trennung gute Bedingungen in einer Pflegefamilie selbst traumatisierten Kindern die Chance eines Neuanfangs geben können.
Eine sichere Bindung zu entwickeln ist schützt vor Abhängigkeit und bildet die Grundlage für das Erkunden der Welt, für den emotionellen Ausdruck sowie für das eigene Bindungsverhalten während des späteren Lebens und fördert die soziale Kompetenz sowie die Belastbarkeit in der Schule, im Jugendalter und der Partnerschaft. Siehe dazu die Ausführungen zur Imago-Paartherapie.
In einer Langzeitstudie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim sowie der Universitäten Magdeburg, Potsdam und Dresden wurden 279 Frauen und Männer von der Geburt bis ins Erwachsenenalter hinein beobachtet. Als die Kinder drei Monate alt waren, interviewte man die Familien und registrierte, wie die Eltern in kritischen Situationen reagierten, etwa wenn das Kleinkind weinte oder sich nicht füttern ließ, wobei dabei eine große Rolle die Mimik der Eltern spielte und auch die Art und Weise, ob diese ihr Kind eher zart oder grob behandelten. Als diese Kinder nun 19 Jahre waren, war das Blutbild bei denjenigen auffällig, deren Eltern eher ungeduldig oder ruppig mit ihnen umgegangen waren. Man vermutet daher, dass sich sich schon der Umgang in den ersten Lebensmonaten auf die Gesundheit im Erwachsenenalter auswirken kann.
Unsichere Bindungen gehen mit späterer Verhaltensauffälligkeit einher
Fearon et al. (2010) analysierten 69 Studien (Methoden waren dabei im wesentlichen Fragebogen und Beobachtungen) mit insgesamt 6.000 Kindern, inwiefern Verhaltensprobleme wie Aggressionen und Feinseligkeiten bei Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren mit unsicherer Bindung zur Mutter im Kleinkindalter zusammenhängen. Das Ergebnis war für Buben eindeutig: Entwickelt eine Mutter zu ihrem Sohn in dessen ersten Lebensjahren keine sichere Bindung, sind bei ihm spätere Verhaltensprobleme wahrscheinlicher, auch wenn diese erst viele Jahre später gemessen wurden. Bei Mädchen werden hingegen Aggressionen eher indirekt manifest, etwa in den Sozialbeziehungen oder über Depressionen.
Literatur
Chang, H., Zhang, J., Huang, H.,
Aviles-Rosa, E. O., Huang, H., Guo, Y., Xiao, Z., Liu, Q., Deng, B.
& Zhang, L. (2025). The effects of owner-cat interaction on oxytocin
secretion in pet cats with different attachment styles. Applied Animal
Behaviour Science, 283, doi:10.1016/j.applanim.2025.106524
Nguyen, T., Kayhan, E., Schleihauf, H., Matthes, D., Vrticka, P.,
& Höhl, S. (2018). The effects of caregiving and attachment on
neural synchrony in mother-child interactions. 4th International
Conference of the European Society for Cognitive and Affective
Neuroscience, Leiden, Niederlande.
Nguyen, Trinh, Kungl, Melanie T., Hoehl, Stefanie, White, Lars O. &
Vrticka, Pascal ( 2024). Visualizing the invisible tie: Linking
parent–child neural synchrony to parents’ and children’s attachment
representations. Developmental Science, doi:10.1111/desc.13504.
Stangl, W. (2024, 4. Mai). Zeigt sich die Bindung zwischen Eltern und Kindern auch im Gehirn? was stangl bemerkt ….
https://bemerkt.stangl-taller.at/zeigt-sich-die-bindung-zwischen-eltern-und-kindern-auch-im-gehirn.
Stangl, W. (2025, 22. April). Bindungsstile bei Katzen. arbeitsblätter news.
https:// arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/bindungsstile-bei-katzen/.
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::