Prägung

In der Psychologie bezeichnet Prägung die Tatsache, dass sich bestimmt Einflüsse auf den Menschen, wie auch allgemein auf Organismen nachhaltig - gestaltend oder umgestaltend - auswirken (soziokulturelle Prägung: z. B. durch einen bestimmten Beruf, Lebensstandard oder durch eine bestimmte Erziehung).
In der Verhaltensforschung ist eine Prägung ein obligatorischer Lernvorgang, der in einigen Merkmalen von der Konditionierung abweicht. Charakteristisch für sie ist,
- dass sie sich auf eine einzige Bewegung oder auf eine bestimmte Gruppe von Verhaltensweisen bezieht,
- dass sie in der Ontogenese nur einmal, in einer sensiblen Phase, stattfinden kann und
- dass ein nachträgliches Umlernen unmöglich ist.
Man unterscheidet unter einer Objektprägung, bei der die auslösenden Reize für eine bestimmte Reaktion festgelegt werden, und der motorischen Prägung, bei der ein Bewegungsmuster erworben wird.
Siehe einige Definitionen von Prägung
Objektprägung
Das frischgeschlüpfte Entenküken läuft dem ersten, bewegten Gegenstand nach, der Töne von sich gibt. Nach sehr kurzer Zeit wird das Nachlaufen an weitere Merkmale des Objekts geknüpft, und das Küken ist nun nicht mehr dazu zu bewegen, einem Menschen zu folgen.
Versuche an einem Stockentenküken haben gezeigt, dass die sensible Phase für die Nachfolgeprägung 13 - 16 Stunden nach dem Schlüpfen ihr Maximum erreicht. Zu dieser Zeit wirkt das Präsentieren einer Mutterattrappe am nachhaltigsten. Innerhalb der folgenden 20 Stunden sinkt die Prägbarkeit auf fast Null ab. Ein auf Menschen geprägtes Küken kann mehreren Menschen nachlaufen. Die im Prägungsvorgang an die Reaktion geknüpften Merkmale sind also überindividuelle und meist Artmerkmale. Geprägt wird immer eine bestimmte Reaktion auf ein bestimmtes Objekt.
Eine erstaunliche Erscheinung im Zusammenhang mit der Nachfolgeprägung ist, dass Schmerzreize, die in der sensiblen Phase mit dem Prägungsobjekt simultan geboten werden, den Lernvorgang sogar fördern, während bei der Konditionierung ein Fluchverhalten bedingt würde.
Neben der Nachfolgeprägung gibt es bei manchen Arten eine sexuelle Prägung. Die Prägung kann in einer Entwicklungsphase stattfinden, in der die zugehörigen Bewegungen noch nicht ausgereift sind. dasselbe gilt auch für die motorische Prägung.

Zahme und halbzahme Stockenten bevölkern heute in großer Zahl die Parkgewässer und Teichanlagen von Stadt und Land.
Motorische Prägung
Das bestuntersuchte Beispiel ist die Gesangsprägung bei manchen Vögeln. Zebrafinken-Männchen lernen den Gesang vom Vater, den sie zu einer Zeit hören, in der sie selber noch nicht singen. Isoliert man sie, kurz bevor sie singen, so entwickeln sie trotzdem die arttypischen Laute.
Ob es sich bei der motorischen Prägung um einen grundsätzlich anderen Vorgang handelt als bei der Objektprägung, ist fraglich. Man kann sich vorstellen, dass ein Auslösemechanismus verändert oder gebildet wird, der zur Folge hat, dass später alle vom Vogel geäußerten Laute, die auf ihn passen, als Belohnung wirken.
Da die Irreversibilität der Prägung möglicherweise lediglich eine Folge der kurzen sensiblen Phase ist und weil sonst manche Parallelen zu anderen Lernvorgängen vorliegen, versucht man teilweise, die Prägung als einen Spezialfall der Konditionierung zu deuten.
Zum Begriff und dessen Ursprung
Konrad Lorenz selber wies 1935 ausdrücklich auf die Vorarbeiten von Oskar Heinroth hin, der den Begriff "Prägung" geprägt hatte. Aber auch Oskar Heinroth hatte in Douglas Alexander Spalding (1840-1877) einen Vorläufer, der diese Lernmethode schon 1873 wissenschaftlich korrekt beschrieb. William James zitierte schliießlich 1890 Spalding in seinen "Principles of Psycholoy" ausführlich, sodass Spalding im englischen Sprachraum als der "eigentliche" Entdecker der Prägung gilt. Das Phänomen selber war allerdings schon lange bekannt, so beschrieb es Thomas Morus in "Der utopische Staat" und auch Tierzüchtern ist das Phänomen des Unterschiebens von Küken nicht unbekannt.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4gung_%28Verhalten%29 (05-10-17)
Abgrenzung zwischen Lernen - Reifung - Prägung
|
Lernen
|
Reifung
|
Prägung
|
|
|---|---|---|---|
|
Definition
|
relativ überdauernde
Veränderung von Verhalten und
Verhaltenspotential, welche auf Erfahrung
(Informationsverarbeitung) und Übung beruht |
gengesteuerte Entfaltung
biologischer Strukturen und Funktionen (z.B.
Ausbildung sek. Geschlechtsmerkmale) |
Verknüpfung eines
genetisch bedingten, artspezifischen
Verhaltensmusters mit einem Auslösereiz (z.B.
Nachfolgeverhalten von Gänsen, Bindung) |
|
abgrenzende
Merkmale
|
nicht universell
reversibel (Vergessen)
nachholbar |
universell
irreversibel (Reihenfolge
festgelegt)
nachholbar |
universell
irreversibel
nicht nachholbar (sensible
Phasen) |
Quelle: http://www.inf.tu-dresden.de/~pn2/psy/1uebers.htm (01-12-03)
Instinkte
Instinkte sind angeborene, zweck- und zielgerichtete, überdauernde artspezifische Bewegungs- und Verhaltensmuster.
Instinkte werden zumeist als angeborene Triebe bzw. Bedürfnisdispositionen angesehen, die eine Spezies im Verlauf ihrer Evolution aus dem ständigen Wechselspiel von Mutation und Selektion erworben hat. Auch das menschliche Verhalten ist von Instinkten mitbestimmt (Beispiele: Saugen des Säuglings, Fluchtreaktionen in Angstzuständen, Schlaf, Geschlechtsakt).
Nach der Auffassung der Verhaltensforschung entwickeln sich Instinkte im Individuum gemäß einem im genetischen Code festgelegten Programm, das individualgeschichtlich gar nicht oder nur in sehr engen Grenzen durch umweltbezogene Anpassung verändert werden kann.
Nach der Auffassung der lerntheoretisch begründeten Verhaltenstherapie sowie der Psychoanalyse erscheinen die Instinkte beim Menschen jedoch weitgehend durch erworbene Lernvorgänge sowie durch Erfahrungen aus Objektbeziehungen überlagert zu sein. Auch in der Ethologie gilt heute allgemein, dass, je höher ein Tier im System steht, desto stärker seine Instinktbewegungen durch umweltbedingte Lernvorgänge überlagert werden können (Instinkt, Dressurverschränkung).
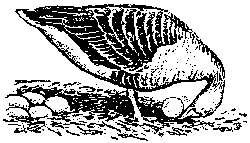 Das Eirückholverhalten der Graugans liefert ein paradigmatisches Bild
eines Instinktverhaltens: Bemerkt eine brütende
Graugans das Herausfallen eines Eies aus dem Nest, so
versucht sie mit der Unterseite ihres Schnabels das Ei
wieder ins Nest zurückzurollen. Das Tier bricht seine
Bewegung auch nicht ab, wenn das Ei auf halber Strecke
weggenommen wird. Erst wenn der Nestrand erreicht ist, wird
das Verhaltensmuster beendet. Damit verhält sich die
Graugans nach einer allgemein formulierbaren Regel: Wenn ein
Schlüsselreiz gegeben ist, dann starte eine bestimmte
Verhaltenssequenz. Der Reiz kann dabei durchaus komplexer
(zusammengesetzter) Natur sein. Analog kann die
Verhaltenssequenz ebenfalls kompliziert sein: Während
die Graugans das Ei zurückrollt, versucht sie
Unebenheiten des Bodens mit übersteuernden Bewegungen
des Schnabels in die entsprechende Richtung auszugleichen,
um damit das rollende Ei auf einem geraden Kurs zu halten.
Offensichtlich hat das Tier die Vermutung, dass das Ei
gerade zurückrollt, holt aber laufend
Bestätigungen dafür ein, um gegebenenfalls
korrigieren zu können. Im Falle der Graugans
unterbricht das Entfernen des Eies das Verhalten nicht. Das
deutet darauf hin, dass es während der Handlung zu
einer Reduzierung der Verarbeitung sensorischer Reize kommt.
Da normalerweise kein Ethologe das Ei entfernt, macht dieses
Ignorieren in evolutionärer Perspektive Sinn. Weiters
ist trotz dieser und anderer Einschränkungen das
Verhalten keineswegs starr, sondern weist kognitive
Flexibilität auf, die sich in der fortlaufenden
Kompensation für Seitwärtsrollen
äußert.
Das Eirückholverhalten der Graugans liefert ein paradigmatisches Bild
eines Instinktverhaltens: Bemerkt eine brütende
Graugans das Herausfallen eines Eies aus dem Nest, so
versucht sie mit der Unterseite ihres Schnabels das Ei
wieder ins Nest zurückzurollen. Das Tier bricht seine
Bewegung auch nicht ab, wenn das Ei auf halber Strecke
weggenommen wird. Erst wenn der Nestrand erreicht ist, wird
das Verhaltensmuster beendet. Damit verhält sich die
Graugans nach einer allgemein formulierbaren Regel: Wenn ein
Schlüsselreiz gegeben ist, dann starte eine bestimmte
Verhaltenssequenz. Der Reiz kann dabei durchaus komplexer
(zusammengesetzter) Natur sein. Analog kann die
Verhaltenssequenz ebenfalls kompliziert sein: Während
die Graugans das Ei zurückrollt, versucht sie
Unebenheiten des Bodens mit übersteuernden Bewegungen
des Schnabels in die entsprechende Richtung auszugleichen,
um damit das rollende Ei auf einem geraden Kurs zu halten.
Offensichtlich hat das Tier die Vermutung, dass das Ei
gerade zurückrollt, holt aber laufend
Bestätigungen dafür ein, um gegebenenfalls
korrigieren zu können. Im Falle der Graugans
unterbricht das Entfernen des Eies das Verhalten nicht. Das
deutet darauf hin, dass es während der Handlung zu
einer Reduzierung der Verarbeitung sensorischer Reize kommt.
Da normalerweise kein Ethologe das Ei entfernt, macht dieses
Ignorieren in evolutionärer Perspektive Sinn. Weiters
ist trotz dieser und anderer Einschränkungen das
Verhalten keineswegs starr, sondern weist kognitive
Flexibilität auf, die sich in der fortlaufenden
Kompensation für Seitwärtsrollen
äußert.
Lorenz, Konrad Z. & Tinbergen,
Nikolaus (1939). Taxis und Instinkthandlung in der
Eirollbewegung der Graugans. Zeitschrift für
Tierpsychologie 2 (1).
Bildquelle: http://home.arcor.de/saemmer/dis/abb7-1d.gif
Vögel mit Persönlichkeit
Auch unter Gänsen gibt es Rambos und Friedfertige, allerdings ist nicht die Art, sondern das Individuum die Einheit der Selektion. Männchen und Weibchen wählen einander und sorgen so dafür, dass die Nachkommen bestimmte Eigenschaften haben. 1993 hatte man in den USA enteckt, dass Vogelmütter die Chancen mancher Jungen dadurch fördern, dass sie die Eier mit Testosteron dotieren, was diesen Nachwuchs aggressiver macht. Bei Kanarienvögeln erhalten später Schlüpfende damit Chancengleichheit im Kampf um Futter, bei Reihern bekommen die Erstschlüpfenden die Dosis, worauf sie die anderen Nachkomende töten (obligatorischer Kainismus), denn diese sind nur Reserve für den Fall, dass die ersten die Brutzeit nicht überleben.
 Auch Möwen in dicht
besiedelten Kolonien heben mit Testosteron die Chancen ihrer
Jungen.
Auch Möwen in dicht
besiedelten Kolonien heben mit Testosteron die Chancen ihrer
Jungen.
Daher gibt es auch unter Vögeln Persönlichkeiten, "proaktive" und "reaktive", wobei erstere aggressiv und tatkräftig sind, letztere zurückhaltend und vorsichtig. Bei Gänsen und Wachteln wurde in einem Versuch in die Eier Testosteron gespritzt, woraus sich unterschiedliche Persönlichkeiten ergaben. Daher kann man vermuten, dass die emotionalen Seiten der Persönlichkeit ontogenetisch entstehen, also in der Individualgeschichte. Natürlich haben sie einen genetischem Hintergrund und stehen im sozialen Zusammenhang der Erziehung, aber das dritte Element ist die direkte Manipulation durch die Mütter.
Damit ist die Verhaltensforschung exakt dort angelangt, wo auch die Molekularbiologie gerade hin gekommen ist: bei der Einsicht, dass Gene und von ihnen gesteuertes Verhalten nicht das Letzte sind, sondern ihrerseits von der Umwelt beeinflusst werden ("Epigenetik"). Ungeklärt ist, warum Mütter das tun, welche Funktion in der Evolution die Ausbildung einer Persönlichkeiten gut sein sollte.
Langenbach, Jürgen (2003). Vögel mit Persönlichkeit.
Die Presse vom 04.10.2003, S. 39.
Siehe dazu ![]() Genetische
Faktoren der Aggression
Genetische
Faktoren der Aggression
Sensible Phasen und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns
Nach den Forschungen der Neuropsychologie ist die Existenz interner Bewertungssysteme von herausragender Bedeutung für die Beurteilung umweltabhängiger Lern- und Entwicklungsprozesse. Das Gehirn entscheidet, gesteuert von seinen eigenen Bewertungen, welche Aktivitätsmuster Veränderungen der Verschaltung induzieren dürfen. Das hierfür benötigte Vorwissen liegt in der funktionellen Architektur der Bewertungssysteme gespeichert und ist genetisch festgelegt, also angeboren. Ein verwandter Mechanismus sorgt ferner dafür, dass Sinnessignale nur dann strukturierend auf die Entwicklung einwirken können, wenn sie Folge aktiver Interaktion mit der Umwelt sind, bei denen der junge Organismus die Initiative hat. Diese Erkenntnis geht auf einen sehr eleganten und frühen Versuch von Hind und Held am MIT zurück. Die Forscher setzten zwei Kätzchen in ein Karussell. Das eine hatte die Pfoten auf dem Boden und konnte durch sein Laufen das Karussell bewegen. Das andere saß in der Gondel und wurde passiv transportiert. Beide sahen natürlich genau das Gleiche, bloß zu verschiedenen Zeiten. Die spätere Bestimmung der kognitiven Leistungen der beiden Tiere zeigte jedoch, dass nur das aktive Tier gelernt hatte, das nur beobachtende war nahezu blind und hinsichtlich seiner visuo-motorischen Koordination schwer gestört. Nur Zuschauen genügt also nicht, Selbermachen ist entscheidend, weil nur dann der interaktive Dialog mit der Umwelt einsetzen kann, der für die Optimierung von Entwicklungsprozessen unabdingbar ist.
Verschiedene Bereiche der Hirnrinde entwickeln sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, was sich in der sequenziellen Ausreifung kognitiver Leistungen widerspiegelt. Entsprechend benötigt das Gehirn in verschiedenen Entwicklungsphasen unterschiedliche Informationen aus der Umwelt, um seine Entwicklung optimieren zu können. Die elementaren Verschaltungen in der Sehrinde werden sehr früh ausgebildet und dann erfahrungsabhängig optimiert: Bei Kätzchen dauert diese kritische Phase etwa sechs Wochen, bei Primaten einige Monate und beim Menschen einige Jahre. Dabei ist die Plastizität und auch die Vulnerabilität der neuronalen Architekturen zu Beginn der kritischen Phase am höchsten und nimmt dann mit der Zeit kontinuierlich ab.
Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser Zusammenhang beim Spracherwerb. Die Erstsprache wird mühelos erlernt, wenn die Interaktionen mit einer sprachkompetenten Umwelt im richtigen Zeitfenster erfolgen. Die Zweitsprache, die meist erst im Schulalter, bei uns in der Regel erst im Gymnasialalter angeboten wird, erlernt sich sehr viel schwerer und auf ganz andere Weise als die Erstsprache. Lernen erfolgt jetzt regelbasiert und unter Kontrolle des Bewusstseins. Entsprechend bilden sich unbewusst ablaufende Automatismen für die Decodierung und Produktion von Sprache nur unvollkommen aus. Die Zweitsprache erreicht nur selten das Perfektionsniveau der Erstsprache. Die Prosodie - der Akzent und die Melodie der Erstsprache - hingegen, prägen sich so stark und irreversibel ein, dass sie ein Leben lang begleiten und meist auch die später erlernten Sprachen durchdringen. Beim Erlernen der Erstsprache werden neuronale Verarbeitungsroutinen ausgebildet, die sich später nicht mehr ändern lassen und auf denen alle anderen Lernprozesse aufbauen. Ein weiteres Beispiel für die frühe und irreversible Prägung der Phonemwahrnehmung ist das Unvermögen von Asiaten, die Phoneme "r" und "l" akustisch voneinander zu unterscheiden. Sie hören den Unterschied trotz deutlicher Aussprache nicht. Der Grund ist, dass in ihrem Sprachraum die Unterscheidung dieser Phoneme keine Rolle spielt. Als Babies verfügen sie über diese Fähigkeit, und wenn sie im westlichen Sprachraum aufwüchsen, würde sie auch erhalten bleiben. Exposition mit asiatischen Sprachen führt jedoch zu Verschaltungsänderungen, die diese Phonemkategorien zum Verschmelzen bringen. Ein weiteres Beispiel ist die Fähigkeit von Skandinavern, mehr als ein Dutzend verschiedener A-Schattierungen heraushören zu können. Auch dies ist Folge früher Prägung akustischen Unterscheidungsvermögens.
Aber auch höhere kognitive Leistungen wie z.B. die Abstraktionsfähigkeit scheinen prägbar. Dies folgt aus Untersuchungen von taubstummen Kindern, die Zeichensprache erlernt haben. Es gibt verschiedene Arten von Zeichensprachen: zum einen ist da die American-Signe-Language (ASL), die auf den gleichen syntaktischen und grammatischen Regeln aufbaut und ähnlich abstrakte Symbole verwendet wie die gesprochene Sprache. Hier ersetzen lediglich die Hände die Sprachwerkzeuge und die Augen die Ohren. Diese Sprache wird in den gleichen Hirnstrukturen analysiert und produziert wie die gesprochene Sprache. Es gibt aber auch Zeichensprachen, die sich mehr abbildender, mimetischer Strategien bedienen. Hier also läßt sich überprüfen, ob das Erlernen unterschiedlich abstrakter Sprachen Einfluss auf die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten hat. Die Antwort lautet ja. Kinder, die mimetische Sprachen erlernt haben, tun sich schwerer, logische Zusammenhänge höherer Ordnung zu durchschauen. Solche lassen sich mit mimetischen Sprachen nur unvollkommen darstellen, weil mangels abstrakter Symbole und differenzierter Syntax keine komplexen logischen Strukturen aufgebaut werden können. Offenbar kann man also durch den übenden Umgang mit einer differenzierten Sprache, die abstrakte Konstrukte auszudrücken erlaubt, erlernen, solche Konstrukte auch zu denken und sich vorzustellen. Aus diesem Grund werden mimetische Sprachen nicht mehr gelehrt. Heute versucht man zudem, wann immer möglich, tauben Kindern mit elektronischen Cochlea-Implantaten zu helfen. Diese vermitteln über direkte elektrische Reizung der Hörnerven eine rudimentäre Lautwahrnehmung und ermöglichen bei früher Anwendung das Verstehen gesprochener Sprache. Wenn dieses Verfahren versagt, wird die ASL mit deutschem Vokabular gelehrt.
Dass es auch sensible Entwicklungsphasen für den Erwerb motorischer Fertigkeiten gibt, ist Gemeingut der Alltagspsychologie. Fahrradfahren ist ein Beispiel. Menschen, die erst als Erwachsene Bekanntschaft mit dem Fahrrad machen, haben in der Regel größte Schwierigkeiten, im Sattel zu bleiben. Der Grund ist, dass Radfahren eine kontraintuitive Bewegungskontrolle erfordert. Will man eine Linkskurve fahren, muss man zunächst nach rechts lenken. Dies bewirkt eine Neigung nach links, die dann unter Ausnutzung der Zentrifugalkraft durch Lenken nach links abgefangen wird. Auch wenn diese komplizierte Dynamik durchschaut wird, gelingt es nur wenigen, die entsprechenden Bewegungsabläufe so zu koordinieren, dass aufgeschundene Knie vermieden werden.
Auch das Beherrschen von Musikinstrumenten muss früh erlernt werden, wenn Virtuosität das Ziel ist. Wenn die visuellen oder akustischen Signale nicht verfügbar sind, die während der entsprechenden sensiblen Entwicklungsphasen benötigt werden, so führt dies zu Strukturänderungen, die im Mikroskop sichtbar sind. Die Nervenzellen schrumpfen, ihre Fortsätze, mit denen sie Signale von anderen Zellen aufnehmen, die sogenannten Dendriten, bilden weniger Verzweigungen aus, und die Zahl der Kontakte zwischen den Nervenzellen, der Synapsen, nimmt dramatisch ab. Auch die Fläche der insgesamt für eine bestimmte Funktion zur Verfügung gestellten Bereiche der Großhirnrinde kann schrumpfen, wenn diese Funktion nicht trainiert oder nicht gebraucht wird. Bei früh Erblindeten kann es vorkommen, dass Hirnrindenareale, die eigentlich mit der Verarbeitung visueller Signale befasst sind, die Auswertung taktiler oder akustischer Signale übernehmen. Blinde, die Braille lernen - also mit den Händen lesen -, benutzen einen Teil der normalerweise für das Sehen zuständigen Hirnrindenareale, um die taktilen Muster zu dechiffrieren. Die Funktionen von Hirnrindenarealen sind also durch Deprivation in Grenzen verschiebbar. Entgegengesetzte Veränderungen lassen sich durch intensives Training oder durch Überexposition auf bestimmte Sinnesreize induzieren. Wer früh anfängt, intensiv Geige zu üben, kann erreichen, dass die Repräsentation der linken Hand, welche die Saiten greift, in der Großhirnrinde mehr Platz eingeräumt bekommt als bei Nicht-Übenden oder spät Berufenen. Ob dies auf Kosten anderer Funktionen geschieht, und falls ja, welcher, ist unbekannt. Weil es im Gehirn keine Leerstellen gibt, steht zu erwarten, dass sich das Eine nur auf Kosten des Anderen ausbreiten kann. Dies auch deshalb, weil die verfügbare Zeit nicht dehnbar ist. Wer Geige übt, kann nicht gleichzeitig sozial kommunizieren und umgekehrt. Übertraining und Deprivation gehen oft zusammen, weil die Zeit und die Lernfähigkeit von Gehirnen begrenzt sind. Es ist eine Mär, die von Wochenendtrainern gewinnträchtig vermarktet wird, dass der Mensch nur einen ganz kleinen Teil seiner neuronalen Ressourcen nutzt. Das ist Unsinn: es gibt nirgends im Gehirn Bereiche, die brachliegen. Wäre dem so, könnte man von dort Gewebe entnehmen, ohne Funktionseinbußen befürchten zu müssen. Dem aber ist nicht so.
Schliesslich gibt es Hinweise - aber hier ist die Beweislage schon schütterer - dass geschlechtsspezifische Verhaltensweisen und gewisse soziale Kompetenzen schon früh eingeprägt werden und dann nur noch schwer, wenn überhaupt, modifizierbar sind. Während es in vielen Fällen gelungen ist, für die Prägungsvorgänge im Bereich sensorischer und motorischer Leistungen entsprechende Veränderungen auf neuronaler Ebene dingfest zu machen, steht die Identifikation der neuronalen Grundlagen für diese sozialen Prägungs- und Lernvorgänge noch aus. Die naheliegende Vermutung ist jedoch, dass auch die Prägung dieser komplexeren Verhaltensdispositionen auf erfahrungsabhängigen Veränderungen neuronaler Architekturen in den jeweiligen Verarbeitungszentren beruht.
Solche Beispiele für frühe Prägungsphasen sollen jedoch nicht den Blick dafür verstellen, dass sich die Hirnentwicklung bis zum Abschluss der Pubertät hinzieht und dass es durchaus auch sehr späte sensible Entwicklungsphasen gibt. Diese verdanken sich der langsamen Ausreifung des sogenannten Präfrontalhirns. Es sind dies Areale der Großhirnrinde, die erst spät in der Evolution hinzutraten und an den vorderen Polen der Hirnhemisphären liegen. Auf ihren Funktionen beruhen die komplexen kognitiven Leistungen, die beim Menschen ihre höchste Differenzierung erreicht haben. Hierzu zählen die Fähigkeiten, die eigene Existenz in der Zeit zu begreifen, Handlungen aufzuschieben und von vorausgehenden Überlegungen abhängig zu machen, ein Konzept vom eigenen Ich zu entwickeln und sich in soziale Wertgefüge einzuordnen. Kinder entdecken sich erst spät als eigenständiges Ich. Erst ab dem zweiten oder dritten Lebensjahr suchen sie nicht hinter dem Spiegel, sondern erkennen sich in ihm und beginnen sich als autonome Agenten zu erfahren. Die Entwicklung dieser Fähigkeiten korreliert direkt mit der späten Ausreifung präfrontaler Hirnstrukturen. Erst wenn diese funktionstüchtig werden, gelingt es den Kindern, Handlungen aufzuschieben und vorher darüber nachzudenken, ob es opportun ist, jetzt oder später zu agieren. Wenn diese Entwicklungsprozesse behindert werden, etwa durch Verletzungen in den entsprechenden Hirnrindenregionen, dann kann die Entwicklung dieser kognitiven Leistungen irreversibel geschädigt werden. Es kann dann Probleme bei der Ausbildung sozial angepaßten Verhaltens und moralischer Verbindlichkeiten geben. Man kann nur vermuten, dass soziale Deprivation ähnliche Folgen hätte, doch fehlen hier gesicherte Daten, weil Vergleiche zwischen Gruppen mit wohl definierten, unterschiedlichen sozialen Erfahrungen notwendig wären, diese aber durch eine Flut unkontrollierbarer Variablen erschwert werden (Singer 2001).
Quelle:Singer, Wolf (2001). Was kann ein Mensch wann lernen? Werkstattgespräches der Initiative McKinsey bildet in der Deutschen Bibliothek, Frankfurt /Main am 12. Juni 2001.
Verhaltensprägung
Es sind vor allem die ersten Lebensjahre, in denen Grundsteine für die spätere Entwicklung eines Kindes gelegt werden, wobei in vielen Familien in dieser Phase vor allem die Mütter sehr präsent sind. Dadurch übernehmen z. B. Mädchen meist wesentlich mehr von der Mutter als vom Vater. Etwa mit zwei Jahren entdecken Mädchen und Buben, dass sie ein eigenes Ich besitzen und individuelle Wünsche haben, wobei diese Entwicklung mit einer Abgrenzung verbunden ist, die in der Pubertät schließlich zur Rebellion wird. Übereinstimmungen zwischen Tochter und Mutter fallen in jungen Jahren oft weniger stark auf, was unter anderem daran liegt, dass sich markante Gesichtszüge erst später entwickeln. Zudem haben Töchter das Bild der Mutter, wie sie als junge Frau aussah, nicht in der Erinnerung, sodass es für sie oft schwe istr, einen konkreten Vergleich zu ziehen. Mit zunehmendem Alter jedoch werden ähnliche Gesichtszüge immer offensichtlicher, wobei auch immer mehr Eigenschaften auffallen, in denen man die eigene Mutter erkennt. Einige davon sind genetisch bedingt wie Physiognomie, Stimme und Mimik, aber auch Gewichtsprobleme können erblich bedingt sein. Eigenheiten wie übertriebene Ordnungsliebe oder Putzwahn werden aber nicht vererbt, denn hier handelt es sich um gelernte Verhaltensmuster, die von der Mutter auf die Tochter übertragen wurden, was in der Regel unbewusst geschah. Daher fühlen sich viele Frauen später überrascht, wenn sie auf solche Ähnlichkeiten angesprochen werden.
Applet:
http://www.demon.co.uk/davidg/screen.htm
Bilder:
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/Lern&Ged_41.pdf
(01-10-24),
http://www.ecircle-solutions.com/custom/quelle/muttertag/bild.jpg
(02-05-05)
http://www.wasserziergefluegel.de/assets/images/stockente.bild.gif
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::
