Operante Konditionierung bei Skinner - Die behavioristischen Ansätze
Siehe dazu auch
Operante und instrumentelle Konditionierung
Videos zur operanten Konditionierung
Das Konzept der Verstärkung und der Bestrafung
Anwendung der operanten und instrumentellen Konditionierung
Operante Konditionierung bei Hunden mit einem Lobverstärker
Die Grundbegriffe des Operanten Konditionierens - ein Programmierter Unterricht
Das Scheitern des Programmierten Unterrichts
Signallernen, Reiz-Reaktionslernen, S-R-Lernen
Operante und instrumentelle Konditionierung
Burrhus Frederic Skinner"Burrhus Frederic Skinner führte in den USA Tierversuche mit Tauben und Ratten durch. Auch dazu wurde eine künstliche Experimentalsituation entwickelt, die Skinner-Box. Es war übrigens nicht Skinner selbst, der den Begriff prägte, doch der Name wurde schnell populär.
Das Versuchstier kann sich durch Drücken eines Hebels (Wirkreaktion) Futter beschaffen. Die Belohnungsgabe (Futter, Wasser) erfolgt nur unter bestimmten Bedingungen, die das Versuchstier zu erlernen hat. Ein äußerer Kasten schirmt den eigentlichen Versuchskasten gegen Störgeräusche von außen ab. Oft nimmt eine Fernsehkamera das Innere über einen Spiegel auf, um das Verhalten des Versuchstieres beobachten oder aufzeichnen zu können. Mit dieser Apparatur wurde die operante Konditionierung untersucht, also jene Lernform, die durch Verstärkung bzw. Belohnung gesteuert wird.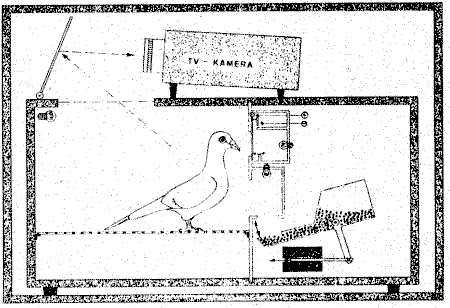 In seinem Hauptwerk "Science and Human Behavior" (1953) schloss Skinner im Gegensatz zu Watson und dem methodologischen Behaviorismus innerpsychische Prozesse bei der Erforschung von Verhalten nicht aus. Aussagen über "mentale" oder "psychische" Vorgänge könnten nämlich nie von Außenstehenden, also unabhängigen Beobachtern getroffen werden, sondern allenfalls vom sich selbst Beobachtenden. Daher trifft der häufig geäußerte Vorwurf an den Behaviorismus, er betrachte das Gehirn als bloße Black-Box, die wie ein Automat mit einer Reaktion antworte, auf Skinner nicht zu. Er lehnte die "Black Box"-Metapher ab, denn mentalistischen Aussagen wie "Er isst, weil er hungrig ist" wären nach Skinner gar keine Erklärungen für Verhalten, denn essen und hungrig sein beschrieben ein und den selben Sachverhalt. Eine Feststellung durch eine andere zu erklären sei vielmehr wissenschaftlich gefährlich, da sie den Eindruck erwecke, dass man der Ursache für ein Verhalten auf die Spur gekommen sei und deshalb nicht weiter zu suchen bräuchte. Skinner lehnte auch die Vorstellung eines cartesianischen Steuermannes ab, der im Innern des Kopfes sitzend den Menschen steuert, denn der Mensch verhält sich immer als ganzes Individuum aufgrund der Umwelteinflüsse, denen er in seiner aktuellen und vergangenen Umwelt unterworfen war und ist, und auf Grund der Umwelteinflüsse, denen seine Vorfahren in der Phylogenese unterworfen waren.
In seinem Hauptwerk "Science and Human Behavior" (1953) schloss Skinner im Gegensatz zu Watson und dem methodologischen Behaviorismus innerpsychische Prozesse bei der Erforschung von Verhalten nicht aus. Aussagen über "mentale" oder "psychische" Vorgänge könnten nämlich nie von Außenstehenden, also unabhängigen Beobachtern getroffen werden, sondern allenfalls vom sich selbst Beobachtenden. Daher trifft der häufig geäußerte Vorwurf an den Behaviorismus, er betrachte das Gehirn als bloße Black-Box, die wie ein Automat mit einer Reaktion antworte, auf Skinner nicht zu. Er lehnte die "Black Box"-Metapher ab, denn mentalistischen Aussagen wie "Er isst, weil er hungrig ist" wären nach Skinner gar keine Erklärungen für Verhalten, denn essen und hungrig sein beschrieben ein und den selben Sachverhalt. Eine Feststellung durch eine andere zu erklären sei vielmehr wissenschaftlich gefährlich, da sie den Eindruck erwecke, dass man der Ursache für ein Verhalten auf die Spur gekommen sei und deshalb nicht weiter zu suchen bräuchte. Skinner lehnte auch die Vorstellung eines cartesianischen Steuermannes ab, der im Innern des Kopfes sitzend den Menschen steuert, denn der Mensch verhält sich immer als ganzes Individuum aufgrund der Umwelteinflüsse, denen er in seiner aktuellen und vergangenen Umwelt unterworfen war und ist, und auf Grund der Umwelteinflüsse, denen seine Vorfahren in der Phylogenese unterworfen waren. Als im 2. Weltkrieg ferngesteuerte Bomben gegen Ziele in England eingesetzt wurden (V2-Raketen, die noch im Flug gelenkt werden konnten), verfügten die anglo-amerikanischen Alliierten noch nicht einmal über erste Ansätze für derart innovative Kriegsgeräte. Skinner ging auf die Suche nach finanzieller Unterstützung für ein heute eher grotesk anmutendes, damals aber streng geheimes militärisches Projekt. Er dressierte Tauben, deren Pickbewegungen dazu genutzt werden sollten, eine Fernrakete auf Kurs zu halten; offenbar plante er, jeder Rakete eine Taube beizugesellen – man entschied sich dann aber für radargestützte Fernlenksysteme. Gleichwohl blieben Tauben für Skinner auch in späteren Jahren die wichtigsten Modellorganismen für seine Verhaltensstudien; jedenfalls führte er niemals wieder Experimente mit Ratten durch. Es existieren außerordentlich einrucksvolle Filmaufnahmen von konditionierten Tauben, anhand derer man beispielsweise das Entstehen von abergläubischem Verhalten nachvollziehen kann.
Als im 2. Weltkrieg ferngesteuerte Bomben gegen Ziele in England eingesetzt wurden (V2-Raketen, die noch im Flug gelenkt werden konnten), verfügten die anglo-amerikanischen Alliierten noch nicht einmal über erste Ansätze für derart innovative Kriegsgeräte. Skinner ging auf die Suche nach finanzieller Unterstützung für ein heute eher grotesk anmutendes, damals aber streng geheimes militärisches Projekt. Er dressierte Tauben, deren Pickbewegungen dazu genutzt werden sollten, eine Fernrakete auf Kurs zu halten; offenbar plante er, jeder Rakete eine Taube beizugesellen – man entschied sich dann aber für radargestützte Fernlenksysteme. Gleichwohl blieben Tauben für Skinner auch in späteren Jahren die wichtigsten Modellorganismen für seine Verhaltensstudien; jedenfalls führte er niemals wieder Experimente mit Ratten durch. Es existieren außerordentlich einrucksvolle Filmaufnahmen von konditionierten Tauben, anhand derer man beispielsweise das Entstehen von abergläubischem Verhalten nachvollziehen kann.
Bildquelle: http://www.psychology.ru/romek/behavior/skinner&box.jpg (03-09-01)
 Auch eine "Skinnerbox?
Auch eine "Skinnerbox?
Skinner bastelte übrigens für seine Tochter Debbie eine Box, die von manchen fälschlich als Skinnerbox interpretiert wird, aber nur zur Entlastung seiner Frau bei der Betreuung des Mädchens dienen sollte, wobei durch eine eingebaute Heizung die Einengung durch Windeln und Bekleidung wegfiel. Später machte das Gerücht die Runde, Deborah sei in einer psychiatrischen Anstalt gelandet und habe sich umgebracht. Den Keim für diese moderne Legende legte im Oktober 1945 das Ladies' Home Journal. Die Frauenzeitschrift berichtete über diese schallgedämpfte, beheizte Kinderkrippe. Unglücklicherweise lautete der Titel des Beitrags "Baby in einer Box", woraus viele Leser schlossen, Deborah stecke in einer Skinnerbox, wo sie, wie die Ratten und Tauben ihres Vaters, an Experimenten teilnehmen müsse. Heute lebt Skinners Tochter als Künstlerin in London.Quelle: http://www.verrueckte-experimente.de/leseproben_d.html#story_07 (05-11-07)
Bildquelle: http://www.education.umd.edu/Depts/EDHD/geron/lifespan/DebbieSkinner-2.JPG (03-10-05)
Walden Two
Skinner hat seine Vorstellungen von einer idealen Welt in seinem Roman "Walden II" dargestellt. 1948 entstand dieser Roman noch unter dem Eindruck hunderttausender Kriegsheimkehrer, sein Roman, der das Leben einer durch operante Konditionierung geformten Gemeinschaft schildert. Dieser utopische Roman wurde Skinners bekanntestes Werk, wegen der in ihm propagierten, von vielen als manipulativ bewerteten Sozial- und Verhaltenstechniken wird er aber heute als "negative Utopie“ empfunden: Es handelt sich dabei um eine kleine Gemeinde mit etwa tausend Einwohnern. Die Kinder werden gemeinschaftlich auf Grundlage des Konditionierungsparadigmas, nach Möglichkeit durch positive Verhaltenskonsequenzen erzogen. Strafen sind nur "ultama ratio" und gelten als Unfreiheit. Frei ist ein Mensch, wenn er überwiegend durch für ihn positive Verhaltenskonsequenzen konditioniert wird. Es gibt kein Geld, nichts hat einen Preis, die Arbeit beschränkt sich auf vier Stunden am Tag und weniger. Die Menschen werden konditioniert, einen gerechten Anteil für ihre Arbeit zu fordern und nicht zum Konsumismus angeregt wie im Kapitalismus. Skinner meinte, dass viele Menschen auf der Welt weniger hätten als die Amerikaner und dennoch glücklicher seien. Skinner hat diese Mitte des vorigen Jahrhunderts verfasste Utopie später wiederholt aufgegriffen und weiterentwickelt. Der Roman lässt jedoch die Frage offen, wer das Recht haben soll, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen festzulegen, die das Zusammenleben der Angehörigen dieser Gesellschaft bis ins Kleinste bestimmen, also auch die ethischen Normen festlegt. Skinner sah darin vor allem auch einen Beitrag zu einer ökologisch vertretbaren Lebensweise, da in dieser Gesellschaft nicht zwanghaft um des Produzierens willen bzw. den Marktmechanismen gehorchend produziert wird, sondern nur soviel, wie zu einem zufriedenen Leben tatsächlich benötigt wird. Skinner, B.F. (1948). Walden Two (Futurum II). New York.PigeonRank™ - die Technologie hinter Googles Pagerank
Basierend auf den Forschungen von B. F. Skinner, haben Page and Brin preiswerte "pigeon clusters (PCs)" verwendet, um den Page Rank von Webseiten zu bestimmen, wobei dieses Verfahren effizienter als die üblichen mit menschliche Editoren gewesen waren. Heute bildet dieses Verfahren die Grundlage aller Suchmaschinenwerkzeuge von Google. Einen Einblick in ein solches Datencenter bietet das unten stehende Bild. Im Detail dazu: http://www.google.com/technology/pigeonrank.html Die wissenschaftliche Begründung für die Eignung von Tauben für Suchmaschinenzwecke: Neuseeländische Psychologen haben festgestellt, dass Tauben Mengen mit unterschiedlich vielen Objekten nicht nur unterscheiden, sondern auch in die richtige Reihenfolge bringen können, was bei Suchmaschinen von großer Bedeutung ist. Die Vögel können die einmal verinnerlichte Ordnungsregel auch auf Mengen neuer Objekte übertragen, wodurch sie für die sich ständig ändernden Inhalte des Internet prädestiniert sind. Zunächst trainierte man Tauben darauf, Bilder mit ein bis drei geometrischen Figuren in aufsteigender Folge zu sortieren, dann zeigten man ihnen je zwei Bilder mit ein bis neun Objekten. Selbst dann, wenn die Vögel die jeweiligen Objekte nie zuvor gesehen hatten, brachten sie die Bilder in mehr als 75 Prozent der Fälle in die richtige Reihenfolge. Das gelang ihnen umso schneller und umso zuverlässiger, je stärker sich die dargestellten Mengen in ihrer Mächtigkeit unterschieden. Da diese Untersuchungen bei Primaten wie auch bei den Menschen durchgeführt wurden, bestätigt sich eindrucksvoll, dass Gemeinsamkeiten in der Art und Weise bestehen, wie die Gehirne von Vögeln und Primaten mit Zahlen umgehen.Quelle und Bildquelle: http://www.google.com/technology/pigeonrank.html (06-10-10)
Im Detail dazu: http://www.google.com/technology/pigeonrank.html Die wissenschaftliche Begründung für die Eignung von Tauben für Suchmaschinenzwecke: Neuseeländische Psychologen haben festgestellt, dass Tauben Mengen mit unterschiedlich vielen Objekten nicht nur unterscheiden, sondern auch in die richtige Reihenfolge bringen können, was bei Suchmaschinen von großer Bedeutung ist. Die Vögel können die einmal verinnerlichte Ordnungsregel auch auf Mengen neuer Objekte übertragen, wodurch sie für die sich ständig ändernden Inhalte des Internet prädestiniert sind. Zunächst trainierte man Tauben darauf, Bilder mit ein bis drei geometrischen Figuren in aufsteigender Folge zu sortieren, dann zeigten man ihnen je zwei Bilder mit ein bis neun Objekten. Selbst dann, wenn die Vögel die jeweiligen Objekte nie zuvor gesehen hatten, brachten sie die Bilder in mehr als 75 Prozent der Fälle in die richtige Reihenfolge. Das gelang ihnen umso schneller und umso zuverlässiger, je stärker sich die dargestellten Mengen in ihrer Mächtigkeit unterschieden. Da diese Untersuchungen bei Primaten wie auch bei den Menschen durchgeführt wurden, bestätigt sich eindrucksvoll, dass Gemeinsamkeiten in der Art und Weise bestehen, wie die Gehirne von Vögeln und Primaten mit Zahlen umgehen.Quelle und Bildquelle: http://www.google.com/technology/pigeonrank.html (06-10-10)http://www.google.com/technology/pigeon_system.jpg (06-10-10)
Scarf, Damian, Hayne, Harlene & Colombo, Michael (2011). Pigeons on par with primates in numerical competence. Science, 334, 1664.
SCNR W. S.
Mon, 8 Dec 2008 22:18:58 Sehr geehrter Herr Stangl,Sie erwähnen im Arbeitsblatt über Operante und Instrumentelle Konditioniertung das Google PigeonRank verwenden würde. Das war aber Googles Aprilscherz 2002! Auf der Seite, auf die Ihr Link verweist, steht auch unten: "Note: This page was posted for April Fool's Day - 2002." Mit freundlichen Grüßen, M. K.-R.
Programmierter Unterricht
In den 1950er-Jahren entwickelte Skinner auf der Grundlage seiner tierexperimentellen Studien und seiner in "Futurum Zwei" beschriebenen lerntheoretischen Erwägungen "Lernmaschinen" und die Methode des "programmierten Lernens", die darauf beruhen, den gesamten Lernstoff in kleine Untereinheiten zu zerlegen, deren korrekte Wiedergabe "belohnt" wird durch die Erlaubnis, den nächsten Lernschritt zu unternehmen, so dass man im Selbststudium schrittweise sich Wissen selbst aneignen und den Lernerfolg auch selbst kontrollieren kann. Diese Vorgehensweise war in den 1960er-Jahren auch in Deutschland unter jungen Lehrkräften recht populär, geriet dann aber weitgehend in Vergessenheit und feierte erst durch die "modernen" PC-gestützten Sprachlernprogramme ein gewisses Comeback. Auch die sogenannten Sprachlabors verdanken ihre Existenz letztlich B. F. Skinner. Der programmierte Unterricht sollte es nach Skinner möglich machen, dass jeder Schüler - anders als im herkömmlichen Unterricht - Lernaktivitäten zeigen muss und unmittelbar nach jeder Reaktion oder Verhaltenssequenz eine Rückmeldung bzw. Verstärkung erhält. Dabei sollte jeder Lernschritt auf dem vorhergehenden aufbauen, so dass der Lerner schließlich zu dem angestrebten Wissensniveau geführt wird. Der anfänglich große Optimismus hinsichtlich der Möglichkeiten des programmierten Unterrichts ist bald zurückgegangen. Man hat erkannt, dass er den traditionellen Unterricht keineswegs ersetzen kann. Bestenfalls kann er eine Ergänzung darstellen. Allerdings hat die Entwicklung der Computertechnologie die Möglichkeiten zur Realisierung von Lernprogrammen enorm vergrößert. Anstelle von programmiertem Unterricht spricht man heute von computerunterstütztem Unterricht. Mit dieser Technologie ist es möglich geworden, Informationen über Reaktionen des Lerners zu speichern und am Ende einer Unterrichtseinheit auszuwerten. Es gelingt darüber hinaus zunehmend, adaptive Lernprogramme, die eine Vielzahl verschiedener "Lernwege" bereit halten, zu realisieren. Schließlich können mittlerweile auch audiovisuelle Medien in Lernprogramme (Multimedia) eingebaut werden. Während die ersten Lernprogramme noch sehr deutlich fremdgesteuerten Charakter hatten, gilt dies nicht mehr im gleichen Maße für den modernen computerunterstützten Unterricht. In dem Ausmaß, in dem es gelang, individuelle Lernwege zu realisieren, ist auch die Möglichkeit selbstgesteuerten Lernens größer geworden.
Siehe dazu auch ![]() Das Scheitern des Programmierten Unterrichts.
Das Scheitern des Programmierten Unterrichts.
https://www.stangl-taller.at/TESTEXPERIMENT/experimentbspconditioning.html (01-01-22)
http://www.uni-bielefeld.de/idm/personen/shorsman/lerntheorie.html (01-01-22)
http://www.psychologie.uni-bielefeld.de/ae/AE12/LEHRE/Lernen.htm (01-01-22)
http://lexikon.freenet.de/Behaviorismus (05-11-11))
Edelmann, W. (1995). Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union. .
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::
