Der emotionale Missbrauch und seine Aufarbeitung in der Therapie
Der systematische Missbrauch etwa in kirchlichen Einrichtungen oder
Internaten ist nur die Spitze des Eisbergs, denn neben dem sexuellen
Missbrauch ist auch der emotionale Missbrauch an solchen Institutionen
in Form von permanenten Beschimpfungen, Entwertungen, Ausschluss oder
Demütigungen durch Bezugspersonen oder Mitschüler systembedingt und
haben langfristig ähnlich schwerwiegende Folgen. Gedächtnisinhalte, die
unter massiver Bedrohung abgespeichert werden, verbleiben ohne
zeitlichen oder räumlichen Kontext in der Erinnerung, was dazu führt,
dass die Bedrohungsgefühle oft über Jahrzehnte und manchmal das ganze
Leben hinweg erhalten bleiben. Da hilft es nur, die Ereignisse im Detail
zu erzählen und neu zu verorten. Man muss daher in der Therapie die
Lebensgeschichten der Betroffenen aufarbeiten, denn gerade bei massiven
Missbrauchserfahrungen muss der Betroffene das Erlebte in die eigenen
Biografie erst einordnen. Ohne Therapie erleben viele Betroffene diese
Erfahrungen jeden Tag von Neuem in Form von Gefühlen und Bildern, was
alleine aber nicht zu einer Verarbeitung führt. In der narrativen
Expositionstherapie versucht man, die Lebensgeschichte der Patienten zu
rekonstruieren, wozu auch eine genaue Erzählung der Traumatisierung
gehört, denn die Betroffenen haben oft nur mehr eine sehr schwache
Erinnerung an ihre gesamte Kindheit. Wenn sie aber ihre eigene
Geschichte nicht kennen, können sie auch nicht klären, wer eigentlich
die Schuld trägt. Mit der Therapie kann man zwar die Ereignisse nicht
besser machen als sie waren, aber die KlientInnen lernen, dass der
Schrecken vorbei ist und es keine akute Bedrohung mehr gibt.
Untersuchungen zeigen auch, dass Missbrauch und Misshandlungen in der
Regel ein Kontinuum sind, das oft aus mehr als hundert Einzeltaten
bestehen kann, wobei es den Betroffenen selbst trotz der aktuellen
öffentlichen Debatten schwer fällt, darüber zu sprechen. Daher besteht
die Gefahr dieses Missbrauchs weiterhin, denn das Dilemma für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen bleibt, da viele das, was passiert,
als normal empfinden und nicht wissen, dass ihnen Unrecht geschieht.
Wenn man in Heimen oder Internaten aufwachsen ist, dann fehlt der
Vergleich zu einem "normalen" Familienleben und selbst wenn allmählich
klar wird, dass etwas Unrechtes geschieht, ist die Scham, darüber zu
reden, sehr groß. Die meisten missbrauchten Kinder und Jugendlichen
glauben, sie tragen eine Mitverantwortung für das, was passiert, was
aber oft letztlich auch ihre einzige Chance ist, eine Illusion von
Kontrolle aufrecht zu erhalten und nicht völlig im Gefühl der Ohnmacht
gegenüber den Tätern zu versinken. Auch in der Wissenschaft gibt es nach
wie vor Vorbehalte, sich mit den Themen Missbrauch, Misshandlung und
Trauma zu beschäftigen, wobei das ergänzt wird durch eine starke Tendenz
in der Gesellschaft, den alltäglichen Schrecken nicht wahrhaben zu
wollen, und die Angst lieber auf ein paar spektakuläre Einzelfälle zu
verlagern, was Gewalt in der Familie genauso betrifft wie Gewalt in
Institutionen.
Aus einem Interview von Katja Irle dem Psychotherapeutrn Frank Neuner in der Frankfurter Rundschau vom 25. Jänner 2011.
Schuldbekenntnis der Täterin bzw. des Täters kann dem Opfer helfen
Opfer sexueller Gewalt können ihre Verletzungen besser verarbeiten, wenn die Täter sich schuldig bekennen und Reue zeigen, denn dies ist ein wichtiger Schritt für die Opfer, sich von ihren eigenen Schuldgefühlen zu befreien. Mädchen und Jungen fühlen sich durch den sexuellen Missbrauch häufig gezeichnet und anders als die anderen Kinder, sie fühlen sich weniger wert, fühlen sich beschädigt und werden oft zur Geheimhaltung gezwungen, so dass das Gefühl entsteht, sie müssten sich schämen und nicht die Täter. Sexueller Missbrauch bedeutet immer Verwirrung, Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, Vertrauensverlust, Ohnmacht, Angst, Schmerz, Scham- und Schuldgefühle und Isolation. Gleichzeitig bestehen häufig Loyalitätsgefühle gegenüber dem Täter bzw. der Täterin. Diese ambivalenten Gefühle führen zu einer starken emotionalen Verwirrung, die der Missbrauch durch eine vertraute Person auslöst. Kinder und Jugendliche haben nicht selten Sorge, von Dritten Schuld zugewiesen zu bekommen, und zweifeln daran, dass ihnen geglaubt wird. Eine Erfahrung, die Opfer immer wieder machen müssen. Daher ist es heilsam, wenn der Täter - auch gegenüber Dritten - seine Verantwortung und Schuld bekennt. Ein Gespräch zwischen Täter und Opfer sollte allerdings nur auf Wunsch des Opfers stattfinden. Mädchen und Jungen, die die Kraft haben, dem Täter zu begegnen, ihn zu konfrontieren, befreien sich aus der Opferrolle, und für den Täter kann das Gespräch zu einem wertvollen Bestandteil seiner eigenen Therapie werden.
- Begriffsbestimmung
- Formen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen
- Sexueller Missbrauch im Internet
- Sexueller Missbrauch in der Geschichte
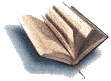 Quellen und verwendete Literatur
Quellen und verwendete Literatur
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::