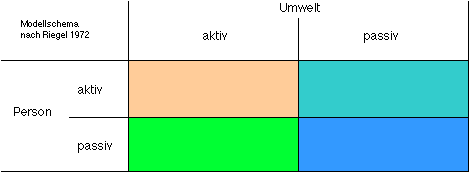Menschenmodelle der Entwicklungspsychologie
Die Geschichte der Entwicklungspsychologie ist auch als ein Ringen um die angemessenen anthropologischen Kernannahmen zu beschreiben: Was ist das Wesen des Menschen? Was ist das Wesen von Entwicklung? Die Antworten auf diese Fragen bestimmen erst, welche Fragen in Forschung und Praxis zu stellen und welche methodischen Zugangsweisen zu wählen sind. Vielfach wird diese Vorfrage nach dem Wesen des Menschen und dem seiner Entwicklung vom einzelnen Forscher weder explizit gestellt noch explizit beantwortet: Forscher bewegen sich oft in einer Forschungstradition, in die sie sozusagen hineinwachsen, ohne dass sie sich deren anthropologische Vorentscheidung bewußt machen. Im letzten Jahrzehnt hat aber weithin ein Nachdenken über die impliziten Anthropologien von Forschungstraditionen eingesetzt, so dass heute Entscheidungen getroffen werden, wo früher schulenspezifische Selbstverständlichkeiten herrschten.
Menschenbildhypothesen und anthropologische Kernannahmen
Es ist heute allgemeine Einsicht, dass Forschungsprogramme und Theorien eingebettet sind in Menschenbildhypothesen, die ein Vorverständnis über den Gegenstand schaffen, ja diesen Gegenstand als Ausschnitt oder Aspekt der Realität erst bestimmen. Da dies, bewußt oder nicht, eine Bestimmungs- oder Definitionsleistung im voraus ist, bleibt sie innerhalb des Forschungsprogramms selbst einer direkten empirischen Uberprüfung entzogen. Solche definitorischen Kernannahmen bestimmen die Forschungsfragen, die Wahl von Beschreibungs- und Erklärungsmodellen, die Datenerhebungs- und Auswertungsstrategien, und sie leiten vor allem die Interpretation der Befunde. Kernannahmen wirken selektiv und generativ: Sie bestimmen, was gefragt, gesehen, untersucht wird und wie interpretiert wird. Wir müssen also auf spezifische Voreingenommenheiten gefaßt sein. In der Entwicklungspsychologie wuchs das Wissen um die Bedeutung anthropologischer Kernannahmen mit der vergleichenden Würdigung von Entwicklungstheorien. Die Diskussion wurde durch die Perspektiven der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne sehr befruchtet.
Vorannahmen über Aktivität und Passivität des Subjektes
Je nachdem, ob dem Subjekt und/oder der Umwelt ein gestaltender Beitrag zur Entwicklung zugebilligt wird oder nicht, lassen sich vier prototypische Theoriefamilien unterscheiden:
Eine erste Kernfrage lautet: Ist das Subjekt Gestalter seiner Entwicklung oder wird seine Entwicklung von inneren und äußeren Kräften gelenkt? In Bezug auf das Subjekt sind manche überhaupt der Ansicht, dass es sinnvoller ist, von Subjektivität als von Subjekt zu sprechen, da sich der Subjektbegriff dadurch auszeichnet, keine substantialistischen Aussagen über den Menschen zu machen, wie dies in manchen Bereichen der Sozial- und Humanwissenschaften getan wird. Als gemeinsamen Nenner des vielschichtigen und unterschiedlich verwendeten Subjektbegriffs muss dabei die Doppelbedeutung von Subjekt als Unterworfenem und Handelnden erkannt werden, denn als sozial Geformtes und historisch Situiertes ist das Individuum seinen Lebensumständen unterworfen, und doch kann es diese im Rahmen gewisser Grenzen verändern. Das Subjekt ist einerseits Produkt seiner Umwelt, andererseits kann es diese auch gestalten. Die Gestaltung der Umwelt können Menschen sich zurechnen, d. h. aber auch, sie können für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden. Diese Verantwortlichkeit ist in die sprachliche und auch in die soziale Grammatik von Subjektivität eingeschrieben, denn bekanntlich bedeutet in der Grammatik Subjekt jenes Wort im Satz, das im Nominativ steht, d.h. auf die Frage „Wer…?“ antwortet. Die Struktur von Subjektivität zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass der Träger bzw. die Trägerin von Subjektivität stets in Diskurse bzw. Kommunikationen eingebettet ist, in denen er oder sie aufgefordert sind, sich in ihrer besonderen Ausprägung als Individuum zur Geltung zu bringen.
Exogenistisches Entwicklungsmodell
 Watsons berühmtes Angebot, man möge ihm ein Dutzend Kinder geben und eine Welt, in der er sie aufziehen könne, dann garantiere er, dass er jedes zu dem mache, was man wolle: Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, Unternehmer oder auch Bettler und Dieb, ist prägnanter Ausdruck des behavioristischen Menschenbildes: Der Mensch und seine Entwicklung werden als vollkommen durch externe Reize kontrollierbar angesehen, deren Manipulation jedes gewünschte Ergebnis bringt. Das Modell der mechanistischen Kausalität (der Wirkursache) besagt, dass der Anstoß zur Veränderung von außerhalb kommt. Die äußere Ursache ist unabhängige Variable, die Veränderung abhängige Variable. Das Grundmodell des Behaviorismus enthält die Annahme einer strikten Reizkontrolle des Verhaltens. Es sind die evokativen, die signalisierenden und verstärkenden Reize, durch die Verhalten und Verhaltensänderungen kontrolliert werden. Die Entwicklung wird je nach Einflüssen unterschiedliche Richtungen annehmen. Es handelt sich um ein radikal exogenistisches Entwicklungsmodell. Da Entwicklung unter Kontrolle externer Variablen steht, werden folgerichtig beliebige Interventionen in die Entwicklung für möglich gehalten.
Watsons berühmtes Angebot, man möge ihm ein Dutzend Kinder geben und eine Welt, in der er sie aufziehen könne, dann garantiere er, dass er jedes zu dem mache, was man wolle: Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, Unternehmer oder auch Bettler und Dieb, ist prägnanter Ausdruck des behavioristischen Menschenbildes: Der Mensch und seine Entwicklung werden als vollkommen durch externe Reize kontrollierbar angesehen, deren Manipulation jedes gewünschte Ergebnis bringt. Das Modell der mechanistischen Kausalität (der Wirkursache) besagt, dass der Anstoß zur Veränderung von außerhalb kommt. Die äußere Ursache ist unabhängige Variable, die Veränderung abhängige Variable. Das Grundmodell des Behaviorismus enthält die Annahme einer strikten Reizkontrolle des Verhaltens. Es sind die evokativen, die signalisierenden und verstärkenden Reize, durch die Verhalten und Verhaltensänderungen kontrolliert werden. Die Entwicklung wird je nach Einflüssen unterschiedliche Richtungen annehmen. Es handelt sich um ein radikal exogenistisches Entwicklungsmodell. Da Entwicklung unter Kontrolle externer Variablen steht, werden folgerichtig beliebige Interventionen in die Entwicklung für möglich gehalten.
Siehe dazu auch: Sozialisationstheorien
Endogenistisches Menschenmodell
Demgegenüber führen endogenistische Theorien Entwicklung auf Entfaltung eines angelegten Plans des Werdens zurück. Anlagen und Reifung sind die Erklärungen für Veränderungen. Das genetische Entwicklungsprogramm wird für jeweils spezifische äußere Einflüsse nur in bestimmten (sensiblen) Perioden offen angesehen. Sind die Einflüsse nicht kompatibel mit dem Programm, sind sie unwirksam, oder es ist ein Defekt zu erwarten. Normale Entwicklung wird nicht erklärt durch Einflüsse von außen: Sie ist nicht das Explanandum, das durch äußere Einflüsse erklärt würde. Die Entwicklung selbst erklärt, weshalb Einflüsse von außen veränderungswirksam werden: Sie ist Explanans, da spezifische äußere Faktoren nur bei bestimmtem Entwicklungsstand einwirken können.
Siehe dazu auch: Reifungstheorien
Konstruktivistisches Menschenmodell
Einer wachsenden Zahl von Forschern scheinen weder die exogenistischen noch die endogenistischen Grundannahmen für die Deutung der Mehrzahl der Entwicklungsvorgänge angemessen und durch die Datenlage gerechtfertigt. Der Mensch selbst wird als Gestalter seiner Entwicklung betrachtet. Er wird als erkennendes und selbstreflektierendes Wesen aufgefaßt, das ein Bild von sich und seiner Umwelt hat und beides im Zuge der Auswertung neuer und vorausgehender Erfahrungen modifiziert. Der reflexive Mensch reagiert nicht mechanisch auf äußere Reize. Seine Entwicklung ist auch nicht nur durch biologische Reifung bestimmt, er handelt ziel- und zukunftsorientiert und gestaltet damit seine eigene Entwicklung mit.
 Diese Position ist nicht gänzlich neu. Es gab Vorläufer. Elemente dieses Modells der Selbstgestaltung finden sich etwa in den organismischen Theorien von Jean Piaget (1896-1980) und Heinz Werner (1890-1964), die Entwicklung als weitgehend selbstgesteuerten Konstruktionsprozeß. Ausgangspunkt der Entwicklung sind für Piaget sensomotorische oder geistige Handlungen, die nicht zum erwünschten Ergebnis bzw. nicht zu widerspruchsfreien Problemlösungen führen. Dies macht eine Reorganisation der Ausgangsstrukturen notwendig. Die Veränderungsschritte erfolgen in einer sachlogisch notwendigen Sequenz. Es ist die analytische Aufgabe der Forschung, in Stadien- oder Stufenfolgen diese inneren Zusammenhänge zu erkennen. Eingriffe von außen in den Entwicklungsprozeß nach einem mechanistischen Grundmodell sind nur sehr dosiert möglich. Die Umwelt kann die Entwicklung nicht steuern, sie kann lediglich zum jeweils gegebenen Entwicklungsstand angemessene Anregungen geben, z.B. durch Fragen und Problemstellungen und Lösungsvorschläge, die aber - sollen sie wirksam werden - in eigener entdeckender und strukturierender Aktivität des Subjektes konstruktiv genutzt werden müssen.
Diese Position ist nicht gänzlich neu. Es gab Vorläufer. Elemente dieses Modells der Selbstgestaltung finden sich etwa in den organismischen Theorien von Jean Piaget (1896-1980) und Heinz Werner (1890-1964), die Entwicklung als weitgehend selbstgesteuerten Konstruktionsprozeß. Ausgangspunkt der Entwicklung sind für Piaget sensomotorische oder geistige Handlungen, die nicht zum erwünschten Ergebnis bzw. nicht zu widerspruchsfreien Problemlösungen führen. Dies macht eine Reorganisation der Ausgangsstrukturen notwendig. Die Veränderungsschritte erfolgen in einer sachlogisch notwendigen Sequenz. Es ist die analytische Aufgabe der Forschung, in Stadien- oder Stufenfolgen diese inneren Zusammenhänge zu erkennen. Eingriffe von außen in den Entwicklungsprozeß nach einem mechanistischen Grundmodell sind nur sehr dosiert möglich. Die Umwelt kann die Entwicklung nicht steuern, sie kann lediglich zum jeweils gegebenen Entwicklungsstand angemessene Anregungen geben, z.B. durch Fragen und Problemstellungen und Lösungsvorschläge, die aber - sollen sie wirksam werden - in eigener entdeckender und strukturierender Aktivität des Subjektes konstruktiv genutzt werden müssen.
Siehe dazu auch: Konstruktivismus
Das Denken dieser Autoren war schon systemisch, aber nur das Entwicklungssubjekt wurde als wirklich aktiv gestaltend wahrgenommen. Demgegenüber wird in interaktionistischen Konzeptionen sowohl dem Entwicklungssubjekt als auch dem Entwicklungskontext gestaltende Funktion zugebilligt. Es gibt mehrere Varianten, die hier nicht unterschieden werden. Allen gemeinsam ist: Die Teilsysteme Mensch und Umwelt stehen im Austausch und beeinflussen sich gegenseitig. Für diese Tatsache wurden verschiedene Bezeichnungen gewählt: Schmidt (1970) und Riegel (1975) sprechen von dialektischen Theorien der Entwicklung, Reese (1977) von kontextuellen, Sameroff (1975) von transaktionalen, Looft (1973) von relationalen Modellen der Entwicklung. Gemeinsame Kernannahme dieser Modelle ist, dass der Mensch und seine Umwelt ein Gesamtsystem bilden, und dass Mensch und Umwelt aktiv und in Veränderung begriffen sind. Die Aktivitäten und die Veränderung beider Systemteile sind verschränkt. Die Veränderungen eines Teils führen zu Veränderungen auch anderer Teile und/oder des Gesamtsystems und wirken wieder zurück, was Transaktion genannt wird.
Dieser Ansatz impliziert, dass die Strukturierung in antezedierende und abhängige Ereignisse ein gedankliches Modell ist, das die Interaktion nicht angemessen abbildet. Was folgt daraus? Wir sind daran gewöhnt, die komplexe Verschränkung gleichzeitiger Veränderungen des Individuums und seiner Umwelt zu vereinfachen, etwa indem wir die Aktivitäten und Veränderungen eines Teilsystems als antezedierende Bedingung nehmen, die anderer Teilsysteme als Folge. Zur Umsetzung des systemischen Denkens in Forschungsprogramme fehlt es nicht an methodischen Ansätzen. Aber Forschung im systemischen Entwicklungsmodell ist hoch komplex. Das neue Denken äußerte sich deshalb zunächst in neuen Interpretationen von Forschungsbefunden und in der Korrektur tradierter Einseitigkeiten. Hat man früher gefragt, wie das Kind durch seine familiäre Umwelt geformt wird, so fragt man heute auch umgekehrt, wie das Kind oder der Jugendliche auf die Familie rückwirken. Es wird also z.B. nicht nur gefragt, wie sich Scheidung auf die Kinder auswirkt, sondern auch, was Kinder zur Ehezufriedenheit oder zur Scheidungsneigung der Eltern beitragen. Man fragt nicht nur, was eine Mutter einem Kind Gutes oder Schlechtes antut, sondern auch, was ein Kind seiner Mutter Gutes oder Schlechtes antut, was dann wiederum auf das Kind rückwirken mag.
Siehe dazu auch: Entwicklungsaufgaben
Kinder sind eigenständige Menschen mit eigenen Vorstellungen, Erlebnissen und Sichtweisen über sich und ihre Umwelt.Sie leben in einem Umfeld, in dem sie organisatorisch, psychologisch, rechtlich, ökonomisch, geschichtlich und im täglichen Ablauf eingebettet sind. Darin orientieren sie sich, lernen wahrzunehmen, zu differenzieren, zu begreifen, zu spüren, vieles davon zu benennen und auch damit umzugehen. Sie lernen Verbindungen herzustellen zwischen dem, was um sie passiert und dem, was sie sich selber vorstellen, woraus sie sich selber einen Reim machen oder was sie durch ihre Phantasie und im Spiel mit anderen erschaffen. Ihre inneren Bilder werden immer wieder durch Erfahrungen angeglichen, um dann wieder differenzierter wahrzunehmen und zu handeln, was wiederum Feedback für ihre Sichtweisen von außen und über das Außen schafft. Kinder nehmen so wahr, wie sie eben wahrnehmen können, aus und mit ihrer eigenen Perspektive und ihren Vorstellungen von dem, was um sie geschieht, von den Menschen, deren Absichten und der Welt allgemein.
Je jünger das Kind ist, desto weniger kann es außer mit Protest, Symptom und "geschickter" Manipulation diese Umwelt miterzeugen bzw mitformen. Umso wichtiger ist es, dem Kind eine ihm bewältigbare Umwelt zu bieten bzw zu garantieren. Dies wird durch die Verantwortlichkeit von Erwachsenen für ein Kind geregelt. Jemand obsorgt das Kind. Jemand wird auch verantwortlich gemacht, wenn dies nicht in ausreichendem Maße passiert. Erst in vielen Jahren lernen sie, dass die Umwelt um sie auch veränderbar erscheint, sich Menschen aktiv um Veränderungen bemühen können und es nicht nur um das Lernen, Zurechtfinden, Anpassen und Arrangieren geht, wobei bei Nichtgelingen oft Versagensängste und Schuldgefühle entstehen. Die aktive Auseinandersetzung wird langsam immer mehr möglich und Alternativen werden sichtbar. (...) Je mehr Kinder unterschiedliche Erfahrungen machen, desto mehr Möglichkeiten der Wahl, der Einschätzung, wer und was ihnen gut tut, stehen den Kindern selber zur Verfügung. Doch diese Unterschiedlichkeiten gilt es erst einmal wahrzunehmen, zur Kenntnis zu nehmen, und durch Erfahrungen auch bestätigt zu bekommen, um sie als Alternativen überhaupt annehmen zu können.
Die innere Welt von Menschen ist nicht bloß Abbild der äußeren Wirklichkeit, sondern sie bildet sich im sozialen Wechselspiel, im grundsätzlich konflikthaften Spannungsfeld zwischen äußerer Realität und subjektiver innerer Realität. Systemiker und Sozialkonstruktionisten gehen so weit, dass sie die Spaltung von innen und außen als Intervention bereits begreifen und sagen, dass das Selbst, die inneren Prozesse sozial vermittelt und in sie eingebettet sind, ja sogar sozial erzeugt werden (Gergen 1994). Die Abgrenzung von ich und anderen wird erst in der Reflexion sichtbar. Das in Beziehung Sein ist ein gemeinsames Produkt. Umso wichtiger wird der Aspekt einer anschlußfähigen, respektvollen Umgang schaffenden, Platz gebenden Umwelt, mit der es gilt in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben.
Bei Kindern kommt noch ein weiterer Aspekt dazu - sie sehen die Welt nicht immer so rational und in gleicher Weise wie Erwachsene und sie verwenden vielfältigere Sprachen des Ausdrucks und unterschiedliche Kommunikationsformen. Sie sind sehr handlungsorientiert und knüpfen an ihre unmittelbaren Erfahrungen an. Kinder zu verstehen heißt oft auch, Verhalten und Symptome lesen zu lernen, ihre Anliegen zu enträtseln und diese dann auch in verantwortungsvoller Weise zu beantworten. Sie haben ein Recht auf Unterstützung und Lenkung, ohne dass sie dadurch eine Entmündigung erfahren. Oft sind Symptome und Eskalationen Ausdruck von Mißverstehen und geben Hinweise, dass es noch etwas zu verstehen und zu berücksichtigen gibt.
Was brauchen Kinder?
- Ein Kind versucht das, was es hört, erlebt, sieht und spürt, was es erhofft, was es erwartet und wovor es sich fürchtet, in Einklang zu bringen. Kognitive bzw emotionale Dissonanzen gilt es zu integrieren. Es braucht Spielraum, das zu werden, was es ist und sein möchte und auch sein kann.
- Seine innere Welt (Vorstellungen, Gefühle, Stimmungen) braucht Bestätigung und zumindest teilweise Übereinstimmung mit der äußeren. Es braucht Anerkennung, damit es sich wohl fühlen kann.
- Das Hineinwachsen in die Kultur, die Wissen und Orientierung vermittelt, und der Erwerb von Sprache, der gemeinsames Verstehen und sich verständlich machen bei seinen wichtigen Bezugspersonen und darüber hinaus mit der Umwelt, mit der es interagiert, ermöglicht, erlaubt ein sich Mitteilen und in Einklang bringen des Erlebten mit dem Gesagten und Vermittelten. Das Kind muß sich auskennen, damit es sich zurechtfinden kann.
- Es braucht auch relativ kontinuierliche und stabile "Visavis", die mit ihm Kontakt halten.
![]() Werner Stangl: Anlage und Umwelt in der kindlichen Entwicklung. Versuch über die Veränderung der psychologischen Perspektive
Werner Stangl: Anlage und Umwelt in der kindlichen Entwicklung. Versuch über die Veränderung der psychologischen Perspektive
Literatur
Gergen, Kenneth (1994). Realities and Relationships. Soundings in social construction. Harvard: University Press.
Klammer, Gerda (o.J.). Innere und äußere Realitäten des Kindes und Bewältigungshilfen - Strukturelle Überlegungen und narrative Haltungen. Psychologie in Österreich.
WWW: http://www.boep.or.at/html/artikel6.htm (02-01-16)
Oerter, Rolf & Montada, Leo (Hrsg.) (1995). Entwicklungspsychologie. Weinheim: PVU.
Stangl, W. (2001). Stichwort: Subjektivität.
WWW: https://lexikon.stangl.eu/1637/subjektivitaet/(2001-04-21)
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::