Der erkenntnistheoretische Ansatz Piagets
Der Empirismus will die Erkenntnis aus der
Sinneserfahrung ableiten, wobei das erlangte Wissen von den Objekten
selber ausgeht. Er geht davon aus, daß die äußere
Realität vor der Erkenntnis vorhanden ist und somit eine
Konstruktion neuer Realitäten nicht möglich ist. Das
Vorhandene in der objektiven Realität wird vom Subjekt
abgebildet und erweitert den Wissensvorrat des erkennenden Subjekts.
Dieser philosophischen Richtung steht ein passives
Menschenbild zugrunde, da das Subjekt nur zu erweitertem Wissen
kommt, indem es die Umwelt immer genauer abbildet, aber nicht in der
Lage ist, sich seine Realität selbst zu schaffen. Neben den
hauptsächlichen Vertretern dieser Richtung, John Lock und David
Hume, greift auch der ![]() Behaviorismus
als einflußreiche sozialwissenschaftliche Richtung auf diese
Position zurück, indem das menschliche Verhalten auf ein
stimulus-response-Schema reduziert wird. Piaget stellt sich in seinem
Werk entschieden gegen diese Passivität.
Behaviorismus
als einflußreiche sozialwissenschaftliche Richtung auf diese
Position zurück, indem das menschliche Verhalten auf ein
stimulus-response-Schema reduziert wird. Piaget stellt sich in seinem
Werk entschieden gegen diese Passivität.
Doch auch dem Apriorismus erteilt Piaget eine Absage. Dieser geht von prä-determinierten Strukturen im Subjekt aus, als Instrumente, die die Erkenntnis erst ermöglichen. Die gedanklichen Kategorien Raum, Zeit und Kausalität werden als a priori gegeben bestimmt, wobei die Erkenntnis somit als Kombination dieser Strukturen und der Wahrnehmung wird, einschließlich der Annahme, daß die Strukturen den Objekten der Wahrnehmung aufgezwungen werden. Diese philosophische Strömung stützt sich vor allem auf die aristotelische Kategorienlehre und Kants Erkenntniskritik, die Piaget zwar nicht grundsätzlich als falsch ansieht, aber er sieht jene Strukturen im Subjekt, die Erkenntnis ermöglichen, jedoch nicht als a priori gegeben an, vielmehr ist er der Auffassung, daß die Strukturen erst im handelnden Umgang des Subjekts mit den Objekten aufgebaut werden und nennt diese Modifikation der Kantschen Position einen "dynamischen Kantianismus".
Die konstruktive Bildung nicht-präformierter Strukturen geschieht durch eine handelnde Einwirkung eines Subjekts auf das Objekt, wodurch das Objekt und zugleich die vorhandene Erkenntnisstruktur transformiert werden. Piaget geht also davon aus, daß durch Erkenntnis sowohl das Objekt als auch die im Subjekt vorhandenen Strukturen verändert werden, und zwar nicht durch reines Abbilden der Realität, sondern durch beidseitiges Einwirken. Dabei werden Transformationsstrukturen konstruiert, die der Realität mehr oder weniger entsprechen und ihr mehr oder weniger adäquat sind. Die Transformationsstrukturen sind jedoch keine Abbilder der Transformationen in der Realität, sondern nur mögliche isomorphe Modelle, unter denen zu wählen den Menschen die Erfahrung befähigen kann. Erkenntnis ist also ein System von Transformationen die allmählich immer adäquater werden.
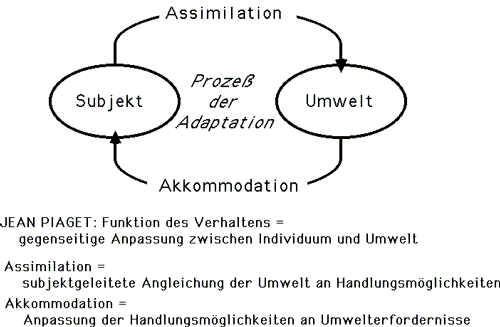
Beispiel für die Veränderung eines kognitiven Schemas durch Assimilation und Akkomodation
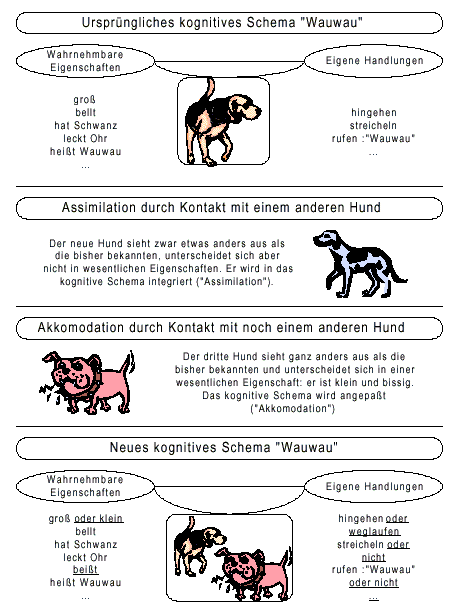
[Quelle: http://dueker.psycho.uni-osnabrueck.de/ewp/pdfs/abb_5-39.pdf]
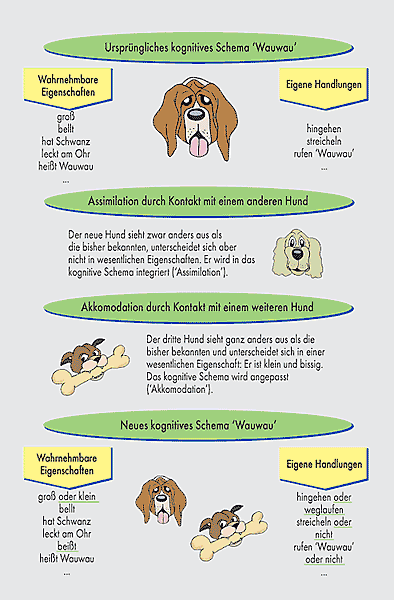 >
>
[Quelle: c't 10/2002, S. 104: IT und Entwicklungspsychologie]
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::