Lernstile - was ist dran?
Die mit dem Terminus "Lerntyp" verbundenen "Lerntypentheorien" suggerieren nichts desto weniger eine wissenschaftliche Fundierung, sind erstaunlich weit verbreitet und genießen eine anhaltende, teilweise sogar ansteigende Popularität. Diesbezügliche Vorstellungen vom Lernen finden sich neuerdings in Didaktiken, pädagogischen Zeitschriften, in der Ratgeberliteratur für SchülerInnen und LehrerInnen sowie immer häufiger auch in Schulbüchern: "Lernen mit allen Sinnen", "ganzheitliches Lernen" und "handlungsorientiertes Lernen". Folgerichtig finden sich diese Lerntypentheorien unter wechselnden Schlagworten in staatlichen Lehrplänen und in Lehrerfortbildungsangeboten, und es scheint, dass diese vor allem unter Schulpraktikern als plausible und praxisgeeignete Konzepte für eine effektive(re) Unterrichtsgestaltung anderen "neuen" Didaktiken deutlich den Rang ablaufen und mehr oder minder seit einiger Zeit unkritisch tradiert werden. Looß (2001) weist auf diese Problematik hin und hebt hervor, dass diese Begriffe oft in pauschalierender Abgrenzung zum traditionellen kognitiven Lernen benutzt werden. Nicht zuletzt werden diese Auseinandersetzungen manchmal auch auf einem ideologischen Hintergrund geführt, auf dem die Überlegenheit einer bestimmten Organisationsform von Bildungseinrichtungen bewiesen werden soll, worauf hier aber nicht eingegangen werden kann.
Im Folgenden verstehen wir Lernstile in Anlehnung an Keefe & Ferrell (1990, S. 16) als Komplexe von miteinander verbundenen Merkmalen, die in Summe mehr ergeben als die einzelnen Teile. Somit bildet ein individueller Lernstil eine "Gestalt" (im psychologischen Sinne) von internen und externen Abläufen, die sich aus der Neurobiologie, Persönlichkeit und Entwicklung des Individuums herleiten und im Lernverhalten widerspieglen.
In der einschlägigen (Fach)Literatur findet man die unterschiedlichsten Kategorisierungen von Lernenden, wobei sich solche Einteilungen in Lernstile bzw. -typen häufig immer stärker ausdifferenzieren und Überschneidungen bzw. Unstimmigkeiten in Kauf genommen werden. Einige solcher "Lerntypen" sollen hier am Beispiel der Vermittlung der Berechnung des Raumvolumens der Kugel demonstriert werden:
- Der visuelle Typ muss ein Bild vor sich haben, also etwa eine schematische Zeichnung einer Kugel mit den entsprechenden Bemaßungen.
- Der auditive oder akustische Typ kann sich die Formel durch bloßes Hören merken, nämlich indem er den Satz "Radius hoch drei zu nehmen und mit 4/3 Pi multiplizieren" mehrmals vernimmt.
- Der diskutierende Typ braucht jemanden, mit dem er über dieses mathematische Problem reden kann bzw. einen Lehrer, der die Formel dialogisch mit ihm erarbeitet.
- Der haptische oder motorische Typ braucht ein massives Kugelmodell, das er "begreifen" oder in das er einen Nagel stechen kann.
- Der psychomotorische Typ muss aktiv in Bewegung sein, also sollte er vermutlich beim Bowling oder Kugelstoßen lernen.
- Der olfaktorische oder gustatorische Typ muss an kugelförmigen Früchten riechen oder in diese hineinbeißen können.
- Der einsichtanstrebende Typ benötigt den Beweis; vor allem stört ihn die Zahl 4/3 oder Pi. Bekommt er den Beweis nicht, kann er sich die Formel kaum merken.
- Der kontakt- oder personenorientierte Typ benötigt einen Lehrer, den er mag, denn vom unsympathischen Lehrer nimmt er keine Erklärungen an.
- Dem abstrakt-verbal denkenden Typ genügt die Vorstellung von der Formel 4/3 Pi Radius hoch drei.
- Der medienorientierte Typ entwickelt die Formel lieber selbstständig am Computer im Rahmen eines animierten Lernprogramms.
Dazu wird meist ausgeführt, dass keiner dieser Typen für sich allein besteht, vielmehr gäbe es in der Praxis nur Mischtypen, die sich auch mehr oder weniger flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen könnten. Das führt dazu, dass dann etwa auch der audiovisuelle Typus postuliert wird, der besonders für unser Medienzeitalter geeignet sein sollte. Häufig fehlt in solchen Systemen auch nicht die Kritik, dass in unserem Bildungssystem einzelne Lerntypen bevorzugt und andere benachteiligt würden, dass manche den Anforderungen besser gerecht würden, da dieses System durch schriftliche Arbeiten, schnelle Informationsaufnahme und -verarbeitung gekennzeichnet sei, in welchem Tafel, Overhead, Schulbuch oder Mitschreiben dominieren.
Grob lassen sich zwei Gruppen von Theorien unterscheiden: Theorien mit eher unscharfer Befundlage und empirisch fundierte Theorien.
Theorien mit unscharfer Befundlage
Schon Ernst Meumann, ein Pionier der empirischen Pädagogik und pädagogischen Psychologie, fand am Beginn des 19. Jahrhunderts experimentell sinnesspezifische Unterschiede in der geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern, und postulierte, dass Menschen, die stärker visuell orientiert seien, entsprechende Lehrangebote bevorzugen würden, während andere Menschen auditive Reize präferierten.
In Bezug auf das schulische Lernen wies eine Untersuchung von Düker & Tausch (1957) nach, dass eine Veranschaulichung mit dem Behaltensgrad der Unterrichtsinhalte stark korreliert. Die Behaltensleistung lag bei einer Gruppe, die einen realen Gegenstand betrachten durfte, gegenüber der Kontrollgruppe um 32% höher. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass der Behaltensgrad dann ansteigt, wenn die sprachlich-akustische Vermittlungsform durch mediale Formen ergänzt wird. Die Behaltensleistung steigt an um 9,5% bei zusätzlichem Einsatz von Bildern, um 20% bei zusätzlicher Verwendung von Modellen, um 40,7% bei gleichzeitiger Verwendung eines realen Gegenstandes im Verhältnis zu der nur sprachlich-akustisch angesprochenen Kontrollgruppe.
Edgar Dale ordnete 1969 Medien und ihre Lernwirksamkeit in einer "Erfahrungspyramide" ein, an deren Spitze symbolische Medien (Sprach- und Bildsymbole) stehen. Danach folgen ikonische Medien (Foto, Film und Fernsehen) und an der Basis der Pyramide befinden sich direkte Erfahrungen, die aus Rollenspielen, Modellen oder zielgerichtetem Erleben gewonnen werden. Er ging davon aus, dass das Lernen umso leichter fällt, je direkter und konkreter die Erfahrungen sind.
Häufig taucht im Zusammenhang mit multimodalem Lernen in einigen Publikationen auch folgende Tabelle auf:
|
Übermittlungsart |
Erinnerbarkeit |
|---|---|
|
Hören |
ca. 20 % |
|
Sehen |
ca. 30 % |
|
Hören + Sehen |
ca. 50 % |
|
Hören + Sehen + Reden |
ca. 70 % |
|
Hören + Sehen + Reden + Tun |
ca. 90 % |
Eine solche Aufstellung findet sich zum ersten Mal bei Niggemann (1977), der schreibt, dass in Versuchsreihen gezeigt worden sei, ein vermittelter Stoff werde je nach Übermittlungsart unterschiedlich gut behalten - allerdings fehlen die konkreten Quellenangaben dazu (vgl. Szczesny 2004). Untersuchungen hätten ergeben, "dass auch die Merkfähigkeit, d.h. die gemerkte Wissensmenge, in einem Zeitdurchschnitt (gemessen nach 24 Stunden, nach einer Woche, nach einem Monat) bei ausschließlichem Referieren nur 17-20% beträgt" (Niggemann 1977, S. 153). Diese auch von anderen Autoren (z.B. Gudjons 2001, Klippert 2002) wiedergegebene Statistik setzt jedoch Behalten mit Verstehen gleich und behauptet letztlich, dass theoretische Einsicht am besten aus praktischer Erfahrung gewonnen werden kann. Dieses Postulat kann mit einem Hinweis auf Personen, die offensichtlich aus Erfahrung nichts gelernt haben, leicht widerlegt werden.
Weidenmann (1997, S. 69ff) vermutet eine Verbindung zur "Theorie der Hemisphären-Spezialisierung", bei der davon ausgegangen wird, dass man durch ein gleichzeitiges Angebot von Sprache und Bildern beide Hirnhälften "einschalten" und damit die Lern- und Behaltensleistung erhöhen könne. Allerdings sind Effekte multimodaler Lernangebote nur in ganz spezifischen Settings empirisch bestätigt worden. Einerseits verbessern Abbildungen das Behalten von Texten und die multicodale Präsentation von Informationen wird als weniger anstrengend erlebt, andererseits sind multimediale Informationen auch anfällig für Überlastungen und Interferenzen. Schließlich wirkt sich Multimodalität auch nachteilig aus, wenn die einzelnen Informationenkanäle schlecht aufeinander abgestimmt sind.
Fischer & Fischer (1968) unterscheiden unter einer pädagogischen Perspektive "Zuwachslerner", "intuitive Lerner", "Sinnespezialisten", "Sinnesgeneralisten" und "emotionell Beteiligte".
Schrader (1994) legt - bezogen auf Erwachsene in der beruflichen Weiterbildung - ebenfalls eine eher an der Unterrichtspraxis orientierte Typologie vor: "Theoretiker", "Anwendungsorientierte", "Musterschüler", "Gleichgültige" und "Unsichere".
Pask (1976, 1988) geht von einem dualistischen Ansatz aus und unterscheidet nach der Art und Weise des Entwicklungsverlaufs im Hinblick auf Abstraktionen aus konkreten Erfahrungen und Einzelheiten zwischen Serialisten, die stufenweise aus Konkretionen zu Abstraktionen gelangen, und Holisten, die laufend zwischen Konkretionen und Abstraktionen interferieren, sowie Versatilen, die kontextbezogen beide Muster anwenden.
Die einzige empirisch abgesicherte Differenzierung nach Sinnesmodalitäten ist die häufig vorgenommene Typisierung in Verbalisierer und Visualisierer. Allerdings dürfte es sich dabei um ein weitgehend durch kulturelle Erfahrungen beeinflusstes Phänomen handeln, denn nach Scheu (1977) kann man z.B. eine diesbezügliche geschlechtsspezifische Behandlung im Säuglingsalter beobachten, indem Mädchen sehr viel häufiger akustisch stimuliert werden, Jungen hingegen sehr viel stärker optisch angeregt werden. Dies findet in jener Lebensphase statt, in der der optischen Stimulation größere Bedeutung zukommt als der akustischen. Garai & Scheinfeld (1968) berichten, dass männliche Säuglinge sich mehr für das interessieren, was sie sehen und später besser bei Tests abschneiden, bei denen Bildaufgaben zu lösen sind. Dafür ist das Gehör bei Mädchen besser ausgebildet. Schon ab dem 3. Lebensmonat beginnt die Erziehung zum "Jungen-" und "Mädchenstereotyp". Dies zeigt sich z.B. darin, dass die Mutter bei Knaben eher die Muskelaktivität fördert als bei Mädchen (vgl. Scheu 1977, S. 61ff). Auch wird Mädchen in der Regel die Sprache subtil anders vermittelt als Jungen, denn Mädchen dürfen nicht laut reden, Erwachsenen nicht ins Wort fallen und bestimmte Wörter nicht aussprechen (vgl. Scheu 1977, S. 78). Wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, gibt es nur eine geringe Zahl von Kindern (10-15 Prozent), die dem auditiven Lerntyp zuzuordnen sind und daher von einem rein verbalen Vortrag profitieren. Ebenso viele Kinder einer Klasse kann man als "multimedial" einstufen. Alle übrigen behalten fast nichts von dem, was sie nur hören, sondern profitieren vor allem von Gesehenem (vgl. Richter 2000).
Fundierte Theorien
Die schon erwähnte unzureichende empirische Fundierung der Lernstil- bzw. -typentheorien - insbesondere was die Überprüfung ihrer Vorteile in der Lernpraxis betrifft - hängt in hohem Maße mit der prinzipiellen multifaktoriellen Bedingtheit von Lernprozessen zusammen. Lernprozesse sind in ganz bestimmten zeitlichen und räumlichen Kontexten immer mehr als die bloße Interaktion eines Lerners mit einem medial vermittelten Lehrstoff. In den meisten Fällen kommen Lehrstoffe ohnehin in komplexen medialen Settings und Kombinationen daher, die sich auch von einem didaktisch versierten Lehrer nur in geringem Maße variieren lassen. Eine mathematische Formel wird bei geringem Interesse des Lernenden an mathematischen Inhalten auch bei idealer medialer bzw. multimodaler Darbietung kaum leichter zu erlernen sein als bei "traditioneller" Präsentation im Unterricht.
In der Regel wird die Effektivität eines Lernstils auch von situativen Faktoren beeinflusst - so wird ein aktivierender Unterricht in einer sechsten Stunde bei manchen SchülerInnen wenig ausrichten, auch wenn der Lernstoff selber danach verlangt.
Psychologisch betrachtet unterscheiden sich Menschen einmal prinzipiell danach, ob sie von der Umwelt dominiert werden oder ob sie versuchen, diese zu dominieren. Daher stehen sich feldabhängige Lerner, die Sachverhalte so akzeptieren, wie sie ihnen präsentiert werden und eher faktenorientiert arbeiten, den feldunabhängigen Lernern gegenüber, die dazu neigen, die Umwelt nach ihren eigenen Vorstellungen zu (re)organisieren und zu (re)strukturieren. Während Feldabhängige oft Probleme haben, Informationen in einem komplexen Umfeld zu lokalisieren und daher mehr Führung und soziale Interaktion benötigen, brauchen Feldunabhängige tendenziell weniger Führung und sind insgesamt auch weniger an sozialer Interaktion orientiert. Dafür sind sie experimentierfreudig und arbeiten eher konzeptionell. Diese Unterscheidung kann jedoch nicht im Sinne einer generellen Typisierung verstanden werden, denn häufig hängt die Arbeitsweise vom Kontext ab. Es lässt sich auch zeigen, dass in der Regel jüngere Kinder vorwiegend feldabhängig sind und mit zunehmendem Alter stärker zur Feldunabhängigkeit neigen.
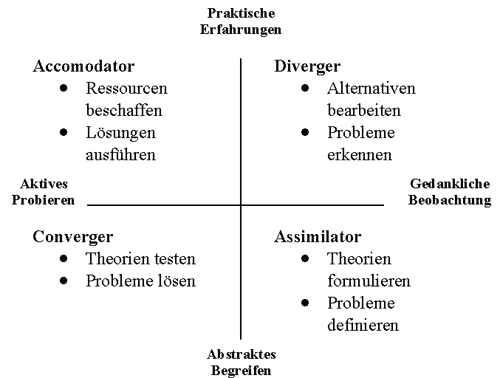 Ein empirisch gut abgesichertes Modell stammt von Kolb (1984), der in Anlehnung an Lewin den Prozesscharakter des Lernens betont. Er unterscheidet - unter Rückgriff auf Intelligenz- und Kreativitätsforschung sowie das Piagetsche Kognitionsmodell - vier Lernstile, die er in einem Koordinatensystem anordnet: Auf der X-Achse stehen sich die Pole gedanklich, reflektierendes Beobachten und aktives Probieren gegenüber, während sich auf der Y-Achse die Pole konkretes, praktisches Erfahren versus abstraktes, analytisches Begreifen befinden. Die konkreten Lernstiltypen ergeben sich dann jeweils aus der Kombination in den Quadranten und sind dadurch charakterisiert, wie Erfahrungen gesammelt und anschließend verarbeitet werden (vgl. Kolb 1984 und Smith & Kolb 1986). Grafisch lässt sich das wie folgt veranschaulichen:
Ein empirisch gut abgesichertes Modell stammt von Kolb (1984), der in Anlehnung an Lewin den Prozesscharakter des Lernens betont. Er unterscheidet - unter Rückgriff auf Intelligenz- und Kreativitätsforschung sowie das Piagetsche Kognitionsmodell - vier Lernstile, die er in einem Koordinatensystem anordnet: Auf der X-Achse stehen sich die Pole gedanklich, reflektierendes Beobachten und aktives Probieren gegenüber, während sich auf der Y-Achse die Pole konkretes, praktisches Erfahren versus abstraktes, analytisches Begreifen befinden. Die konkreten Lernstiltypen ergeben sich dann jeweils aus der Kombination in den Quadranten und sind dadurch charakterisiert, wie Erfahrungen gesammelt und anschließend verarbeitet werden (vgl. Kolb 1984 und Smith & Kolb 1986). Grafisch lässt sich das wie folgt veranschaulichen:
- Divergierer bevorzugen konkrete Erfahrung und reflektiertes Beobachten, wobei ihre Stärken in der Vorstellungsfähigkeit liegen. Sie neigen dazu, konkrete Situationen aus vielen Perspektiven zu betrachten und sind an Menschen interessiert.
- Assimilierer bevorzugen reflektiertes Beobachten und abstrakte Begriffsbildung bis zu theoretischen Modellen. Sie neigen zu induktiven Schlussfolgerungen und integrieren einzelne Fakten zu übergeordneten Konzepten.
- Konvergierer bevorzugen abstrakte Begriffsbildung und aktives Experimentieren. Ihre Stärken liegen in der Ausführung von Ideen. Sie neigen zu hypothetisch-deduktiven Schlussfolgerungen und befassen sich lieber mit Dingen oder Theorien (die sie gern überprüfen) als mit Personen.
- Akkomodierer bevorzugen aktives Experimentieren und konkrete Erfahrung. Ihre Stärken liegen in der Ausgestaltung von Aktivitäten. Sie neigen zu intuitiven Problemlösungen durch Versuch und Irrtum und befassen sich lieber mit Personen als mit Dingen oder Theorien.
Felder & Soloman (o.J.) unterscheiden vier bipolar angelegte Lernstildimensionen, wobei eine auf Sinnesmodalitäten abhebt, während alle anderen durch personale Merkmale des Arbeitsstils gekennzeichnet sind:
- Aktive Lerner lernen am besten, indem sie aktiv z. B. in einer Gruppenarbeit mit dem Lernstoff umgehen, während reflektive Lerner erst alleine still nachdenken.
- Sensorische Lerner sind geduldig bei Einzelheiten, Fakten, Abstraktionen und Formeln, sie lösen Probleme gerne durch gut eingeführte Methoden und werden durch Komplikationen und Überraschungen irritiert. Intuitive Lerner lieben die Abwechslung, sind lieber kreativ und haben eine Abneigung gegen Wiederholungen, Routine und Auswendiglernen, sie arbeiten eher schneller als sensorische und sie sind meist innovativer als diese.
- Visuelle Lerner lernen am leichtesten durch Schaubilder, Diagramme, Tabellen oder Demonstrationen. Verbale Lerner bevorzugen schriftliche oder gesprochene Erklärungen.
- Sequenzielle Lerner bevorzugen den detailreichen, logischen Aufbau eines Stoffes mit klar erkennbaren Zusammenhängen. Globale Lerner bevorzugen das zufällige, überblicksmäßige Aufnehmen ohne allzu viele Querverbindungen, haben aber mit Details ihre Schwierigkeiten.
Diese gut empirisch abgesicherten Theorien zeichnen sich durchwegs durch ihren hohen Abstraktionsgrad aus, der sie im Hinblick auf eine praktische Umsetzung wenig nützlich erscheinen lässt. Da Lernstoffe mehr oder minder die gesamte hier geschilderte Bandbreite an Aktivitäten erfordern, kann daraus für die Unterrichts- und Lernpraxis am ehesten wohl nur eine Empfehlung nach wechselnden Angeboten bei Darbietung, Übung und der Einprägung im Sinne eines Ausgleichs abgeleitet werden. So kann man aktiven Lernern nach einem traditionellen Vortrag Raum für Diskussion bieten, während man reflektiven Lernern die Gelegenheit geben sollte, durch Lektüre oder Zusammenfassungen das Diskutierte zu vertiefen oder über Anwendungen nachzudenken. Da bei den meisten Menschen das visuelle System dominiert, wird es auch für verbale Lerner kein Nachteil sein, einen Lernstoff in Form eines strukturierten Exzerptes aufzubereiten. Verbalen Lernern kann eine an eine Folienpräsentation anschließende Diskussion in Kleingruppen zu effektivem Lernen verhelfen. Da herkömmlicher Unterricht auf Grund seines sequenziellen Aufbaus ohnehin diesen Lernstil bevorzugt, sollte für globale Lerner immer der Bezug zum Gesamten eines Lerngebietes herstellbar sein.
Was bleibt übrig?
Lernen und Verstehen setzen häufig gerade eine Distanzierung von unmittelbarer Erfahrung und Anschauung voraus, denn durch diese wird die intellektuelle Leistung weder ersetzt noch ist sie ihr gleichzusetzen. In vielen Fällen müssen Abstraktionen von einer sinnlich vermittelten Realität vom Lernenden bereits verstanden worden sein, bevor eine Veranschaulichung oder ein Hantieren den nachhaltigen Erwerb unterstützen kann.
Durch die "Fixierung" auf Lernstile, also auf Anteile des Lernenden selbst, geraten häufig die Kontextbedingungen des Lernens in Vergessenheit: Die Konkretheit bzw. Dekontextualisierung der angebotenen Lerninhalte, die Qualität und Vollständigkeit der Instruktion bzw. des Unterrichts. So wird in der Schule beinahe ausschließlich dekontextualisiertes Wissen gefordert, bei welchem SchülerInnen nur selten die Verwendbarkeit und der Situationsbezug deutlich werden. Regelerkennung, Strategieableitung, Transferleistungen und Wissenskompilierung bleiben dem einzelnen Lernenden überlassen. Das Phänomen der "six hours retarded" - SchülerInnen, die bei schulischen Lernaufgaben versagen, in ihrer Alltagsumgebung aber äußerst intelligent und lernfähig sind - hängt ganz wesentlich mit diesen Lernbedingungen zusammen.
Didaktische Ansätze zur Förderung eines verständnisorientierten Wissenserwerbs müssen berücksichtigen, dass es sich dabei um einen aktiven, motivierten, konstruktiven und in wesentlichen Teilen selbstgesteuerten Prozess handelt (vgl. Looß 2001). Wesentlich bedeutsamer als das Vermittlungsmedium sind daher die sozialen und motivationalen Umstände der Interaktion mit einem Lernstoff, sodass Lerninhalte, die etwa sowohl sprachlich, bildhaft und auch haptisch codiert werden, nur dann zu einer besseren Informationsverarbeitung führen, wenn etwa die Beziehung zum Lehrenden oder das Klassenklima "stimmen". Eine nicht unbeträchtliche Prägung von Lernpräferenzen erfolgt schließlich auch durch die Institution selber, wobei deren Veränderung eher nur längerfristig möglich scheint.
An den zahlreichen konkurrierenden Lernstil-Konzepten und Lernstilinventaren mag etwas Zutreffendes sein, auch wenn die meisten bisher nicht validiert worden sind. Dennoch sind sie in der Regel gut geeignet, die Diversität von Lernenden zu verdeutlichen bzw. diese Thematik zu aktualisieren bzw. überhaupt erst ins Bewusstsein von Lehrenden und Lernenden zu rücken (vgl. Schulmeister 2004). Es kann nach einigen Untersuchungsergebnissen vorteilhafter sein, eine klare Lernstrategie zu verfolgen als überhaupt keine Lernstrategie zu haben, sodass es vielleicht generell Sinn macht, Lernstrategien zu lernen und zu lehren, auch wenn viele Experimente mit Trainings keine eindeutigen Ergebnisse lieferten.
 Die in Tests erhobenen Selbstbewertungen des eigenen Lernstils stimmen häufig nicht mit dem tatsächlich genutzten Lernstil überein, wie er etwa in Beobachtungen ermittelt wird (Nistor & Schäfer 2003). Nach Haller (o.J.) wird angesichts der mangelnden Güte solcher Lernstilinventare oft dennoch eine methodologische Korrektur und Relativierung erreicht. Diesem Zweck dient auch der "HALB-Test" (Stangl 2003) des Autors, der auch in einer Online-Version verfügbar ist.
Die in Tests erhobenen Selbstbewertungen des eigenen Lernstils stimmen häufig nicht mit dem tatsächlich genutzten Lernstil überein, wie er etwa in Beobachtungen ermittelt wird (Nistor & Schäfer 2003). Nach Haller (o.J.) wird angesichts der mangelnden Güte solcher Lernstilinventare oft dennoch eine methodologische Korrektur und Relativierung erreicht. Diesem Zweck dient auch der "HALB-Test" (Stangl 2003) des Autors, der auch in einer Online-Version verfügbar ist.
Zwar ist es sicherlich nicht sinnvoll, eine mittels solcher Tests gewonnene Typologie zur Grundlage einer detaillierten didaktischen Planung zu machen, etwa dass "typuspassende" Lernende und Lehrende einander zugeordnet werden, jedoch kann mit der Feststellung des Lernstils bzw. Lerntyps eine Art "Reflexionsdynamik" ausgelöst werden, "die bei den Betreffenden zu Überlegungen darüber führt, wie sie gewohnt sind zu lernen, welche Vorlieben und Abneigungen sie haben, welches ihre besonderen Strategien und Techniken sind, welche kognitiven Muster (z.B. in der Abfolge von Konkretion und Abstraktion) dabei für sie eine Rolle spielen …" (Haller o.J.). Konkreten Anwendungsnutzen der Lernstilforschung ortet Haller daher im darin implizierten Plädoyer für "didaktische Vielfalt in den Lehrangeboten und Lehrmethoden", denn die Berücksichtigung individueller Lernstile ist oft schon Ausdruck einer individualistischen Orientierung als Wertsetzung im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise, Lernen als allgemein gattungsgebundenes Verhalten zu betrachten, das vorgegebenen Mustern zu folgen hat.
Literatur
Düker, H. & Tausch, R. (1957). Über die Wirkung der Veranschaulichung von Unterrichtsstoffen auf das Behalten. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 4, 384-400.
Felder, R. M. & Soloman, B. A. (o.J.). Learning styles and strategies.
WWW: http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSdir/styles.htm (05-03-25)
Felder, R.M. & Henriques, E.R. (1995). Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. Foreign Language Annals, 28 (1), 21-31.
WWW: http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/FLAnnals.pdf (05-03-25)
Ferrell, B. G. (1983). A Factor Analytic Comparison of Four Learning-Styles Instruments. Journal of Educational Psychology, 75 (4), 33-39.
Fischer, B. B. & Fischer, L. (1979). Styles in Teaching and Learning. Educational Leadership, 36(4) , 245-254.
Garai, J. E., & Scheinfeld, A. (1968). Sex differences in mental and behavioral traits. Genetic Psychology Monografs, 77, 169-299.
Gudjons, H. (2001). Handlungsorientiert lehren und lernen. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
Haller, H.-D. (o.J.). Kulturbedingte und individuelle Merkmale der didaktischen Sozialisation von deutschen und ausländischen Studierenden.
WWW: http://wwwuser.gwdg.de/~hhaller/vwe.htm (05-04-04)
Jonassen, D.H. & Grabowski, B.L. (1993). Handbook of Individual Differences, Learning, and Instruction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Keefe, J.W. & Ferrell, B.G. (1990). Developing a defensible learning style paradigm. Educational Leadership, 48 (2), 57-61.
Klippert, H. (2002). Methoden-Training. Weinheim.
Kolb, D. A. (1976) The Learning Style Inventory: Technical Manual. Boston, Ma.: McBer.
Kolb, D. A. (1981). Learning Styles and Disciplinary Differences (S. 232 - 255). In Chickering, A. W. (Hrsg.), The Modern American College. San Francisco: Jossey-Bass.
Langfeldt, H.-P. (2001). "Stille Post" - Oder: Die Rezeptionsgeschichte unterrichtlich bedeutsamer Untersuchungen von Düker und Tausch (1957) Über die Wirkung der Veranschaulichung von Unterrichtsstoffen auf das Behalten. Unterrichtswissenschaft, 2, 98-107.
Looß, M. (2001). Lerntypen? Ein pädagogisches Konstrukt auf dem Prüfstein. Die Deutsche Schule, 93, Heft 2, 186-198.
Lozanov, G. (1978). Suggestology and Outlines of Suggestopedy. New York: Gordon & Breach.
Niggemann, W. (1977). Praxis der Erwachsenenbildung. Freiburg.
Nistor, N. & Schäfer, M. (2003). Lernstile in e-Lernumgebungen: Diskursanalytische Beobachtungen in asynchronen, textbasierten Konferenzen. Paper für die virtuelle Fachkonferenz "Grundlagen des Virtual Conferencing im Kontext von politischer Bildung und Kommunikation".
WWW: http://home.emp.paed.uni-muenchen.de/~nistor/work/edupolis_nistor.pdf (05-03-25)
Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Pask, Gordon (1976). Styles and Strategies of Learning. British Journal of Educational Psychology, 46, 128-148.
Pask, G. (1988). Learning Strategies, Teaching Strategies, and Conceptual or Learning Style (S. 83-100). In Schmeck, R. R. (Hrsg.), Learning Strategies and Learning Styles. New York, London: Plenum Press.
Richter, B. (2000). Neukonzeption eines Lerntypen-Tests.
WWW: http://www.gbg.kbs-koeln.de/lerntyp/main.htm (01-12-02)
Robotham, D. (1999). The application of learning style theory in higher education teaching.
WWW: http://www2.glos.ac.uk/gdn/discuss/kolb2.htm (05-04-11)
Scheu, U. (1977). Wir werden nicht als Mädchen geboren - wir werden dazu gemacht. Frankfurt: Fischer.
Schrader, J. (1994). Lerntypen bei Erwachsenen. Empirische Analysen zum Lernen und Lehren in der beruflichen Weiterbildung. Weinheim: Dt. Studien-Verlag.
Schräder-Naef, R. (1988). Rationeller Lernen lernen. Weinheim und Basel: Beltz.
Schulmeister, R. (2004). Diversität von Studierenden und die Konsequenzen für eLearning (S. 133-144). In Carstensen, D. & Barrios, B. (Hrsg), Campus 2004. Kommen die digitalen Medien in die Jahre? Münster,New York: Waxmann.
Sell, R. & Schimweg, R. (1998). Probleme lösen. In komplexen Zusammenhängen denken. Berlin, Heidelberg.
Stangl, W. (2003). HALB-Test.
WWW: https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/TEST/HALB/ (05-04-11)
Vester, F. (1975). Denken, Lernen, Vergessen. München: dtv.
Weidenmann, B. (1997). Multicodierung und Multimodalität im Lernprozess (S. 65-84). In Issing, L. J. & Klimsa, P. (Hrsg.), Informationen und Lernen mit Multimedia. Weinheim: Beltz.
Szczesny, M. (2004). Zur Pflege eines pädagogischen Mythos.
WWW: http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/pac/24417.html (05-03-01)
Erschienen 2005 in Praxis Schule 5-10, 31 Jg., Heft 3.
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::