Risikofaktoren und Entwicklungsmechanismen für jugendlichen Drogengebrauch und -mißbrauch
Es ist bekannt, dass Zellen und Gewebe dann am leichtesten beeinflussbar und störanfällig sind, wenn sie sich in der Phase der Zellteilung und großer Aktivität befinden, was etwa bei der Gehirnentwicklung in der Pubertät der Fall ist. Kommt es in dieser Zeit zu schädigenden Einflüssen, werden besonders diese Funktionen beeinträchtigt, deren Ausbildung gerade in dieser Phase stattfindet und die dadurch in ihrer Entwicklung gestört werden. Schädigungen durch Substanzkonsum in der Zeit der Pubertät bis in etwa Mitte der zwanziger Jahre betreffen vor allem jene Zentren, die für zielgerichtetes Handeln, Selektion von Eindrücken, Einschätzung und Planung sowie logisches Denken zuständig sind. Das Alter derjenigen, die zum erstenmal mit Drogen in Kontakt kommen, ist in den letzten Jahren auffallend gesunken. Heute kann man in Schulen bereits Zwölfjährige treffen, die Haschisch geraucht und andere Mittel ausprobiert haben. Doch das Alter beim Beginn des Drogenkonsums hat nach Ansicht von Experten einen erheblichen Einfluss auf die Suchtgefahr, da Drogen auch auf die Entwicklung des präfrontalen Cortex wirken, der kognitive Prozesse so reguliert, dass situationsgerechte Handlungen ausgeführt werden können, wobei die vollständige Entwicklung des präfrontalen Cortex erst in einem Alter von etwa fünfundzwanzig Jahren abgeschlossen ist. Dadurch hat vor allem der Konsum von Cannabis und Alkohol bei Jugendlichen und jungen Menschen erhebliche Auswirkungen auf den präfrontalen Cortex und führt dabei zu Entwicklungsstörungen. Die Folge ist unter anderem eine verminderte Selbstkontrolle, eine erhöhte Impulsivität, Antriebsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Störungen im Lernverhalten, beim Kurzzeitgedächtnis und im schlussfolgernden Denken. Bei einem Vierzigjährigen hingegen ist beim Konsum von Cannabis oder Alkohol die Suchtgefahr deutlich geringe, denn 35 Prozent all derjenigen, die im Alter bis zu 25 Jahren auch nur einmal eine Zigarette rauchen, werden ihr Leben lang damit zu kämpfen haben, nur wer in höherem Alter zu rauchen beginnt, kann in der Regel auch wieder leichter aufhören.
Eine "Drogenkarriere" beginnt häufig mit den medizinisch betrachtet eher harmlosen Cannabis-Produkten. Unter dem Druck der Peer-Groups und der kriminellen Szene steigen viele auf Präparate um, von denen sie schon nach wenigen Einnahmen körperlich abhängig werden.
In Europa beobachtet man eine eindeutige Bevorzugung des Alkohol- und Zigarettenkonsums, sowie den Cannabiskonsum.
Siehe dazu: Die Drogenkonsumenten werden immer jünger
Übergreifende Prinzipien
Die in der Literatur diskutierten Risikofaktoren überschneiden sich häufig und sind oftmals nicht für Alkohol- und Drogengebrauch spezifisch.
Auch hinsichtlich der Entwicklungsbedingungen sollten Gebrauch und Mißbrauch psychoaktiver Substanzen auseinandergehalten werden. Während ersterer vor allem durch soziale Erfahrungen während der Jugendzeit beeinflußt zu sein scheint, überwiegen bei Mißbrauch interne psychische Faktoren einschließlich psychopathologischer Prozesse, deren Wurzel häufig in der Kindheit liegt. So wird problematischen Alkohol- und Drogengebrauch mit der Übernahme von Erwachsenenrollen wieder ablegen, wer keine besonderen physischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen aus der Kindheit mitbringt und sich auf sein soziales Netzwerk als Protektionsfaktor verlassen kann. Verketten sich aber frühe Risikofaktoren genetischer, personaler und sozialökologischer Art und verstärken so ihre Wirkung, und können Protektionsfaktoren dieser Risikokumulation nicht die Waage halten, droht anhaltende Belastung durch Alkohol- und Drogengebrauch. Dieser Sachverhalt wird durch die Gegenüberstellung von Problemverhalten als "adolescence-limited" und "life course-persistent" auf den Begriff gebracht.
Dem Mißbrauch von Drogen wie Heroin oder Kokain geht regelmäßig der Gebrauch weniger problematischer Substanzen voraus, etwa Marihuana oder Spirituosen, die sozusagen die Tür öffnen ("gateway drugs"). Vor deren Konsum wiederum steht der Gebrauch von Alkohol, wie Bier und Wein. Bei diesen Zusammenhängen spielen der Abbau von Hemmungen durch abträgliche soziale Kontakte und wohl auch physiologische Prozesse eine Rolle. Die Minderheit der Konsumenten harter Drogen bleibt häufig nicht bei einer bestimmten Substanz, sondern verschärft den Mißbrauch und die abträglichen Folgen, indem sie etwa Opiate, Barbiturate und Alkohol kombiniert.
Problemverhaltens-Syndrom
Von Alkohol- und Drogengebrauch Jugendlicher abgehoben von anderen Problemverhaltensweisen (wie Delinquenz oder riskantem Sexualverhalten) zu sprechen, darf nicht die Tatsache übersehen lassen, daß diese Verhaltensweisen häufig gemeinsam als Problemverhaltens-Syndrom auftreten, ohne daß man sinnvoll sagen könnte, was Anlaß und was Folge war.
Hören Sie hinein in die neueste Folge unseres Podcasts:
Empfehlen Sie unsere Podcasts weiter!
Genetische Disposition
Eine Grundfrage betrifft die Bedeutung genetischer Faktoren. Während die Antwort bei psychoaktiven Drogen derzeit offen bleiben muß, scheint hinsichtlich des Alkoholgebrauchs eine genetisch begründete Vulnerabilität gesichert, die sich vor allem beim Vorliegen ungünstiger Umweltbedingungen äußert.
Cadoret et al. zeigten dies anhand von Adoptionsstudien. Wiesen die biologischen Eltern in ihrer Biographie eine Belastung durch Alkohol auf, so fand sich bei den in nicht blutsverwandte Familien adoptierten Kindern späterer Alkoholmißbrauch nur dann, wenn die Adoptionsfamilie ihrerseits einen niedrigen sozialen Status hatte. Der vermittelnde Mechanismus könnte eine genetische Disposition zu hohem Stimulationsbedürfnis und niedriger Angstvermeidung sein. Wer sich leicht durch Unbekanntes mitreißen läßt und dabei Furcht nicht kennt, dessen Risiko zu künftigem Alkohol- und Drogenmißbrauch ist unvergleichlich höher als bei durchschnittlicher Ausprägung dieser Dimensionen.
Attribute der Person
Probleme mit der Selbststeuerung während der Kindheit (Aufmerksamkeitsstörungen, mangelnde Impulskontrolle und, insbesondere bei Jungen, Aggressivität) sind Beispiele für Persönlichkeitsmerkmale, die künftigen Alkohol- und Drogengebrauch, nicht nur während der Jugendzeit, begünstigen können. So konsumierten solche Jugendlichen häufiger Drogen anfangs der Adoleszenz, die sich als Dreijährige durch geringe Ich-Kontrolle (Belohnungen können nicht aufgeschoben werden, impulsiv, emotional labil, leicht frustriert) auszeichneten.
Hinter den Zusammenhängen von Kindheit und jugendlichem Verhalten stehen einerseits das wechselseitige Aufschaukeln von kindlichen Entwicklungsproblemen und inadäquatem Elternverhalten, andererseits werden Kinder mit Verhaltensproblemen als Jugendliche eher an Gruppen Gleichaltriger ähnlichen Hintergrunds geraten, in deren Kontext sie dann die ersten Erfahrungen mit Alkohol und Drogen machen. Solche Entwicklungslinien lassen sich längsschnittlich bis zur Verfestigung abweichender Lebensstile im frühen Erwachsenenalter verfolgen.
Familiäre Risiken
Jugendliche, die Alkohol und Drogen häufig konsumieren, unterscheiden sich schon während der Kindheit von ihren Altersgenossen im elterlichen Erziehungsverhalten.
Nach Baumrind hatten die Eltern derer, die Mißbrauch zeigten, ihre Kinder in einer Kombination von geringer Konventionalität, wenig Aufsicht und Herausforderung, geringer Einflußnahme und wenig Unterstützung erzogen; kurzum, das häusliche Milieu war durch Desinteresse und Instabilität gekennzeichnet. Jugendliche, die Alkohol wenig und/oder Cannabis höchstens gelegentlich zu sich nahmen, hatten hingegen während der Kindheit Erfahrungen gemacht, die Wärme und Zuwendung mit klaren Erwartungen verbindet ("authoritative parenting"). Letzteres schützt vor dem Mißbrauch von Alkohol und Drogen wegen der breiten Förderung sozialer und kognitiver Kompetenzen, die mit ersteren inkompatibel sind.
Übrigens: Auch bestimmter Fernsehkonsum kann das Trinken fördern, denn in einer englische Studie, in der Studenten jeweils einen Film anschauten, in dem entweder sehr viel oder sehr wenig getrunken wurde, tranken während der Vorführung im Durchschnitt fast doppelt so viel Alkohol wie diejenigen, die dies kaum demonstriert bekamen. Das galt auch für Werbespots, in denen Alkohol getrunken wurde-
Inkonsistenz in normativen Anforderungen und Nachlässigkeiten in der Aufsicht, häufig aus Überforderung, sind weitere Besonderheiten der Eltern-Kind-Interaktion, die mit der späteren Entwicklung von Alkohol- und Drogengebrauch in Zusammenhang gebracht werden. Unter solchen Umständen werden frühe Vorboten des Umgangs mit problematischen Peergruppen übersehen.
Psychosoziale Belastungsfaktoren und Drogenmissbrauch
Die Ergebnisse der Adverse Childhood
Experiences (ACE) Studie (Felitti 2002) belegen
eindeutig, daß psychosoziale Belastungsfaktoren in der
Kindheit lebenslange Folgewirkungen besitzen können.
Diese Studie ist die ausführliche Verlaufsuntersuchung
von über 17000 erwachsenen Amerikanern, bei denen der
aktuelle Gesundheitszustand zu belastenden Kindheitsfaktoren
in Beziehung gesetzt wurde, die im Mittel ein halbes
Jahrhundert früher aufgetreten waren. Ein zentrales
Ergebnis der Untersuchung war, daß belastende
Kindheitserfahrungen (Mißbrauchskategorien waren u.a.
wiederholter körperlicher Missbrauch, wiederholter
emotionaler und ![]() sexueller
Mißbrauch) auch fünfzig Jahre
später tiefgreifende Folgen haben, wobei sich diese
psychosozialen Erfahrungen mittlerweile in eine
körperliche Erkrankung umgewandelt haben.
sexueller
Mißbrauch) auch fünfzig Jahre
später tiefgreifende Folgen haben, wobei sich diese
psychosozialen Erfahrungen mittlerweile in eine
körperliche Erkrankung umgewandelt haben.
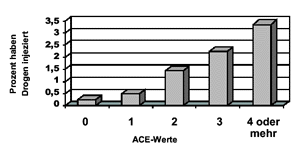 Patienten mit einem ACE-Wert von vier oder mehr besitzen
ein um 460% höheres Risiko, an einer Depression zu
erkranken, als diejenigen mit einem ACE-Wert von null. So
besitzt beispielsweise ein männliches Kind mit einem
ACE-Wert von sechs eine um 4600 % erhöhte
Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben ein
Drogenbenutzer zu werden verglichen mit einem
männlichen Kind mit einem ACE-Wert von null (vgl.
Felitti 2002).
Patienten mit einem ACE-Wert von vier oder mehr besitzen
ein um 460% höheres Risiko, an einer Depression zu
erkranken, als diejenigen mit einem ACE-Wert von null. So
besitzt beispielsweise ein männliches Kind mit einem
ACE-Wert von sechs eine um 4600 % erhöhte
Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben ein
Drogenbenutzer zu werden verglichen mit einem
männlichen Kind mit einem ACE-Wert von null (vgl.
Felitti 2002).
Quelle:
Felitti, Vincent J. (2002). The relationship of adverse
childhood experiences to adult health: Turning gold into
lead. Z Psychosom Med Psychother, 48, 359-369.
Die fünf Bereiche der familiär-elterlichen
Belastung (Dysfunktionen) waren: ein Haushaltsmitglied war
im Gefängnis, die Mutter erfuhr körperliche
Gewalt, ein Familienmitglied war alkohol- oder drogenkrank,
ein Familienmitglied war chronisch depressiv, seelisch krank
oder suizidal, zumindest ein biologischer Elternteil wurde
in der Kindheit verloren, unabhängig von der dazu
führenden Ursache. Ein Individuum, das keine dieser
Kategorien erfüllte, hatte einen ACE-Wert von null. Ein
Individuum, das vier Bedingungen ausgesetzt war, hatte einen
ACE-Wert von vier.
Problematische Peerkontexte
Da der weit verbreitete Gebrauch von Drogen unter Jugendlichen ein für unseren Kulturkreis vergleichsweise neues Phänomen ist, kann das elterliche Vorbild erst in jüngerer Zeit eine Rolle spielen, da zuvor entsprechende Erfahrungen nicht vorlagen. Als Faustregel gilt deshalb, daß von Gleichaltrigen ausgehende Einflüsse für kulturell nicht tradierte Substanzen stärker sind als familiäre Risikofaktoren.
"Gleich zu Gleich gesellt sich gern" ist in diesem Zusammenhang ein Grundsatz, der nicht immer von positiven Ergebnissen geprägt ist. Nach Kandel gilt, daß solche Jugendliche sich gegenseitig bei Normüberschreitungen stützen, deren Persönlichkeit und Lebensumstände dies ohnehin schon begünstigen. Die Bildung eines eigenen Verhaltenskodex, der im Sinne eines wechselseitigen Unterstützungssystems emotionale Sicherheit in der Gruppe verleiht und erste Identitätsentwürfe ermöglicht, geschieht dann auf der Basis von Werten, die im Gegensatz zu positiven Entwicklungszielen stehen.
Als wichtigen Anlaß für problematische Beziehungen zu Gleichaltrigen sah Kaplan die Enttäuschung, den Erwartungen von Eltern, Schule und anderen normativen Entwicklungskontexten nicht entsprochen zu haben. Jugendliche suchen dann andere Möglichkeiten, ihre beeinträchtigte Selbstachtung zu stabilisieren und gewinnen dadurch Kontakt zu Umfeldern, die Alkohol- und Drogengebrauch befördern, wie beispielsweise Diskotheken und andere jugendtypische Treffpunkte.
Unterschiede im Entwicklungstempo spielen eine eigene Rolle bei Beziehungen zu Gleichaltrigen. Jugendliche, die früher als die meisten die Pubertät durchlaufen, zeichnen sich zumindest vorübergehend durch mehr Erfahrungen mit Alkohol und Drogen aus. Dies liegt vor allem daran, daß sie ihres erwachseneren Aussehens wegen Umgang mit älteren Jugendlichen finden, deren Konsumgewohnheiten sie übernehmen, nicht zuletzt um dazuzugehören und eigene Irritationen der körperlichen Entwicklung wegen zu bewältigen.
Drei Bedingungsfelder für die Drogensucht
Sucht ist eine Gruppe körperlicher, Verhaltens- und kognitiver Phänomene, bei denen der Konsum einer Substanz oder einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang hat gegenüber anderen Verhaltensweisen, die von ihr früher höher bewertet wurden. Ein entscheidendes Charakteristikum der Abhängigkeit ist der oft starke, gelegentlich übermächtige Wunsch, psychotrope Substanzen oder Medikamente (ärztlich verordnet oder nicht), Alkohol oder Tabak zu konsumieren.
Bedingungsfelder für die Drogensucht sind:
- Eine psychisch instabile Persönlichkeit mit starken Tendenzen zur Selbsterniedrigung, insbesondere auch in Situationen der Überforderung.
- Kontakt mit einer Gruppe von Drogenkonsumenten
- Mangelnde Kontrolle und soziale Einbindung, fehlende Sozialisation in eine Gruppe (Familie, Freundeskreis) mit einem adäquaten Angebot an "beglückenden" Erlebnissen anderer Art.
Häufige Faktoren für Drogenmißbrauch und Abhängigkeit
In einer Langzeitstudie von Mannheimer Forschern unter der Leitung von Miriam Schneider wurde nachgewiesen, dass Jugendliche, die in der Pubertät das erste Mal Alkohol trinken, ihr Risiko erhöhen, auch später im Leben mehr und öfter Alkohol zu konsumieren, denn das Belohnungssystem des Gehirns verändert sich während der Pubertät stark, wodurch das Gehirn in dieser Phase auch anfälliger für Belohnungen ist, die von Suchtstoffen geliefert werden. Den Untersuchungen zufolge scheint das Risiko eines höheren Alkoholkonsums im weiteren Leben nicht nur geringer zu sein, wenn man erst nach der Pubertät zum ersten Mal Alkohol trinkt, sondern es scheint sogar dann leicht geringer, wenn man schon vor der Pubertät erstmals zu Bier oder anderen Alkoholika greift. Präventionsprogramme sollten daher sehr viel gezielter auf junge Menschen in der Pubertät zugeschnitten werden.
Allgemeine Einflüsse
- Konfliktsituationen verschiedener Art
- Überdruß an der Konsumgesellschaft
- Einfluß der Medien (Werbung, fehlende Werte)
- Steigerung des Luxuskonsums, Lebensgenusses
- Gesellschaft ohne positiven Lebenssinn
- Vermassung
- Isolierung und Einsamkeit, seelische Unfreiheit
- Ursachen aus dem Familienbereich
Konflikte zwischen Eltern und Kindern
- zerrüttete Familienverhältnisse, Scheidungswaisen, Schlüsselkinder, fehlende "Nestwärme"
- Leistungsdruck und übersteigerte Forderungen der Eltern
- Mangel an Liebe, Verständnis und Anerkennung
- fehlende Erziehung zur Selbständigkeit
- fragwürdiger Erziehungsstil (autoritär oder zu locker)
- Fernsehen statt innerfamiliärer Kontakte "Fassaden- Familie"
Individuelle persönliche Ursachen
- Neugier, Langeweile
- Geltungsbedürfnis in der Gruppe
- Flucht vor unangenehmen Situationen und Gefühlen
- Angst vor der Zukunft, Vereinsamung
- Orientierungslosigkeit, fehlende Leitbilder
- mangelndes Selbstwertgefühl, Beziehungsschwierigkeiten, Depressionen
- Protest gegen die Erwachsenenwelt, Ablehnung des Leistungsprinzips
- Sinnlosigkeit des Lebens
- Belastungen in der Pubertätskrise
Ursachen aus dem Schulbereich
- Über- und Unterforderung
- fehlende Zusammenarbeit mit Schule und Elternhaus
- gestörtes Verhältnis zu Lehrern
- nicht ausreichende menschliche Wärme
Begriffe |
|
liegt immer dann vor, wenn eine psychoaktive Substanz nicht ihrem Zweck entsprechend benutzt wird. Immer dann, wenn eine Droge oder ein Rauschmittel eingesetzt wird, um einen unliebsamen Gefühlszustand zum Verschwinden zu bringen, liegt Mißbrauch vor. Dabei kann es sich sowohl um erlaubte (legale) als auch um verbotene (illegale) Suchtmittel handeln. |
|
sind jene psychotrope Substanzen bzw. Stoffe, die durch ihre chemische Zusammensetzung auf das Zentralnervensystem einwirken und dadurch Einfluß auf Denken, Fühlen, Wahrnehmung, Verhalten nehmen. |
|
liegt nach der WHO dann vor, wenn sich beim Entzug der Droge, die über einen längeren Zeitraum gewohnheitsmäßig eingenommen wurde, Mißbehagen und Beschwerden zeigen. Als weiteres Merkmal gilt, daß diese Erscheinungen durch die neuerliche Zufuhr der Droge (oder einer ähnlich wirkenden Droge) wieder zum Abklingen gebracht werden können. |
Schutzfaktoren gegenüber jugendlichem Drogenkonsum
Schutzfaktoren sind Teile der Persönlichkeit oder bestimmte Bereiche der sozialen Umwelt, die einer Person zur Verfügung stehen, um eine positive Bewältigung der altersgemäßen Entwicklungsaufgaben und Stressreicher Situationen zu ermöglichen. Dabei wird eine Bewältigung im Sinne von Problembearbeitung oder Konfliktlösung eher positiv bewertet und für erstrebenswert gehalten. Strategien, die nicht zu einer Auseinandersetzung mit der Situation bzw. der Ausgangslage führen, werden eher negativ bewertet, da sie stärker zur Vermeidung der ursächlichen Ausgangslage beitragen, z.B. Flucht in den Rausch, Gewalt oder Rückzug, als einem aktiven Lösungs- oder Veränderungsversuch.
Viele Menschen verfügen über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die ihnen helfen, gut mit Anforderungen umzugehen. Menschen, die diese Merkmale gar nicht oder nur in geringerem Ausmaße besitzen, laufen eher Gefahr, problematische Verhaltensweisen wie Drogenkonsum zu zeigen.
Die wichtigsten Schutzfaktoren im Zusammenhang mit dem Risikoverhalten Drogenkonsum und für die Vermeidung von jugendlichem Drogenmißbrauch:
- Personale Schutzfaktoren
- Beziehungs- und Konfliktfähigkeit (Kommunikationsfähigkeiten)
- realistische Selbsteinschätzung (positive Seiten + Grenzen)
- hohe Eigenaktivität (Langeweile vertreiben, sich selbst angenehm beschäftigen können)
- ausreichende Selbstachtung
- hoher Selbstwert (sich so annehmen, wie man ist)
- möglichst viele verschiedene positive Bewältigungsstrategien für Stress und Alltagsprobleme
- Soziale Schutzfaktoren
- gutes Verhältnis zu den Eltern (Vertrauen und Unterstützung in schwierigen Situationen)
- Freundschaften zu Gleichaltrigen (Vertrauen, Unterstützung und Deutungshilfe im Alltag)
- geringe Belastungen/Stress durch schulische Umwelt, d.h. gutes Schulklima, positives Klassenklima, vertrauensvolle und mitmenschliche Beziehung zu Lehrerinnen und Lehrern
Schutzfaktoren, die vor allem in der Suchtprävention gefördert werden müssen, sind:
- Allgemein
- Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
- Beziehungs- und Konfliktlösefähigkeit
- Widerstandsfähigkeit und Selbstbehauptung
- Genuß- und Erlebnisfähigkeit
- Unterstützung bei der jugendlichen Sinnsuche und Sinnerfüllung
- Drogenspezifisch
- sachliche Informationen über Wirkungen von Drogen (insbesondere kurzfristige Auswirkungen)
- Ursachen und Entwicklung von süchtigem Verhalten
- Alternative Verhaltensweisen zum Drogenkonsum (z.B. Entspannungstechniken)
- Strategien gegen Gruppendruck in Situationen, in denen Drogen eine Rolle spielen
Quellen
Universität Bielefeld - SFB 227 - Evaluation von
Gesundheitsförderung in der Schule - Infoseiten
http://www.uni-bielefeld.de/SFB227/pieper/schutzfa.htm (02-05-26)
Schneider M. (2013). Puberty as a critical period of addiction vulnerability due to functional maturation processes in the endocannabinoid system.
Schulische Suchtprävention
Suchtprävention zielt auf die Förderung von individuellen Schutzfaktoren ab, die der Ausübung von Risikoverhaltensweisen, z.B. aggressives Verhalten, Drogenkonsum, entgegenwirken, d.h. es sollen in einem institutionellen Kontext, wie z.B. Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule, Jugendfreizeitstätte, Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernt werden, die den Kindern und Jugendlichen helfen, besser mit Problemen und Sorgen, Schwierigkeiten im Alltag, zwischenmenschlicher Kommunikation und den Entwicklungsaufgaben der Kindheits- und Jugendphase fertig zu werden.
Die Ursache von problematischem Verhalten in der Jugendphase wird vor allem im vielfältigen Zusammenspiel von Person und Umwelt gesehen, das zu einer Überforderung von individuellen Handlungsstrategien führen kann. Die Überforderung individueller Fertigkeiten kann in problematische substanzspezifische oder substanzunspezifische Handlungsweisen münden, wie z.B. Drogenmißbrauch, Gewalt oder gesundheitliche Störungen, wenn kein anderes, weniger riskantes Verhalten zur Bearbeitung der Problemsituation zur Verfügung steht.
Daher wird im Rahmen des Kompetenzförderungsansatzes davon ausgegangen, daß die Motivation für jugendliches Risikoverhalten immer in der zugrunde liegenden Funktion des Verhaltens in der jeweiligen Situation für die jeweilige Person zu suchen ist. Primärprävention wird nur dann wirklich wirksam, wenn sie es schafft, diese persönlichen Ziele aufzudecken, ins Bewußtsein zu rücken und mit den Jugendlichen praktikable Alternativen zu dem Risikoverhalten zu erarbeiten und einzuüben.
Die Kompetenzförderung versucht, durch systematisches Training von sozialen und personalen Kompetenzen den Jugendlichen eben diese Alternativen zu vermitteln. Die alternativen Verhaltensweisen sollen entweder von vornherein gesundheitsschädigendes Verhalten vermeiden oder im Laufe einer Interventionsmaßnahme an die Stelle des Risikoverhaltens treten und so zu funktionalen Äquivalenten werden, das heißt zu angemessenen Bewältigungsstrategien für die verschiedenen Anforderungen des Alltags und der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen.
Neben einer allgemeinen Kompetenzstärkung werden für den Bereich der Suchtprävention folgende Ziele angestrebt:
- Abstinenz bei illegalen Drogen
- weitestgehende Abstinenz gegenüber Tabakerzeugnissen
- selbstkontrollierter, verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol
- bestimmungsgemäßer Gebrauch von Arzneimitteln
Aufgrund der starken Verbreitung und der kulturellen Integration von legalen Drogen, ist es notwendig, daß Kinder und Jugendliche einen altersgemäßen Umgang und adäquaten Gebrauch mit diesen Substanzen erlernen. Daher hat sich das Präventionsziel der völligen Abstinenz so nicht bewährt, es stellt aber eine positiv bewertete Option eines jeden Jugendlichen dar.
Einige Kompetenzen im Umgang mit Situationen, in denen Drogenkonsum eine Rolle spielt, sollen in suchtpräventiven Maßnahmen besonders angesprochen und gefördert werden. Diese sind: Gruppendruck widerstehen können, Wissen über kurz- und langfristige soziale, psychische und physiologische Auswirkungen von Drogengebrauch.
Quelle:
Universität Bielefeld - SFB 227 - Evaluation von
Gesundheitsförderung in der Schule - Infoseiten
http://www.uni-bielefeld.de/SFB227/pieper/praevent.htm (02-05-26)
Eurobarometer-Befragung zur Einstellung junger Europäer zu Drogen
Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission im Jahre 2002 in allen Mitgliedstaaten befragte insgesamt 16129 Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren: Knapp ein Drittel der jungen Europäer (28,9 %) hat schon einmal Cannabis probiert, mehr als ein Zehntel (11,3 %) hat es im letzten Monat genommen.
Eine Mehrheit der Befragten hält den Zugang zu Drogen für unproblematisch, wobei sie am leichtesten in Bars, Diskotheken, in der Schule oder in Schulnähe erhältlich seien. Der Konsum von Drogen, Tabak und Alkohol ist in den Großstädten am höchsten, wobei der Unterschied bei illegalen Drogen - außer Cannabis - am höchsten ist. Nur 16 % der Befragten gaben an, daß sie weder regelmäßig rauchen oder trinken noch Drogen probiert haben oder direkt mit Drogen in Berührung gekommen sind.
Wichtigster Grund für das Ausprobieren der Drogen ist die Neugier (61,3 %), gefolgt vom Druck seitens anderer Jugendlicher (46,4 %), dem Wunsch nach einem "Kick" (40,7 %) und Problemen in der Familie (29,7 %). Die Abhängigkeit gilt als Hauptgrund dafür, dass einige Schwierigkeiten beim Ausstieg haben. Die von Heroin ausgehende Gefahr wird von einem sehr großen Teil der Befragten jedes Mitgliedstaats als sehr hoch eingeschätzt. Abgesehen von Tabak und Alkohol wird dagegen in den meisten Mitgliedstaaten Cannabis von den im Fragebogen genannten Rauschmitteln als am wenigsten gefährlich eingestuft. 11,5 % der Befragten sehen es sogar als "überhaupt nicht gefährlich" an.
Quelle:
http://europa.eu.int/comm/
justice_home/unit/drogue_de.htm
(02-10-25)
Suchtgiftprävention verstärkt schon für 13-Jährige
Schon 13-Jährige sollen verstärkt auf die Gefahren von Suchtgiftmissbrauch hingewiesen werden. "PEP", das "peer education project", hat zum Ziel, Jugendliche ab der dritten Klasse Hauptschule oder AHS von Drogen fern zu halten. Ausgewählte Schüler, sogenannte "peers", sollen ihren gleichaltrigen Kollegen die Gefahren von Suchtgift nahe bringen.
Mehr als 80 Prozent der unter 14-Jährigen haben bereits erste Erfahrungen mit Zigaretten gesammelt. 18 Prozent der Elf- bis 15-Jährigen trinken zumindest einmal in der Woche Alkohol. Jugendliche und Kinder können oft nicht dem Druck ihrer Altersgenossen standhalten und haben Angst, "nein" zu Drogen zu sagen.
Die "peers" sollen daher nachhaltig in das Verhaltensmuster ihrer gleichaltrigen Mitschüler eingreifen. Derzeit gibt es in Oberösterreich 120 ausgebildete "peers" an 17 Schulen. Natürlich ist es aber auch wichtig, Lehrer, Eltern und das weitere soziale Umfeld in das Projekt mit einzubeziehen. Mit verschiedenen Maßnahmen wie dem Drogenkoffer und dem "Suchtkoordinator" - einer speziell ausgebildeten Lehrkraft - soll in Schulen Prävention betrieben werden.
Mit dem Modell "PEP" sollen Jugendliche in
oberösterreichischen Schulen von Drogen fern gehalten
werden
(APA 22. September 1999)
Hören Sie hinein in die neueste Folge unseres Podcasts:
Empfehlen Sie unsere Podcasts weiter!
Die Drogenkonsumenten werden immer jünger
Der Konsum von legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen setzt immer früher ein. Schon im Grundschulalter haben Medikamente mit schmerzstillender oder leistungssteigernder Wirkung große Verbreitung. Im Alter von sieben Jahren gibt es die ersten Probierer von Zigaretten, im Alter von neun die ersten Probierer von Alkohol. Im Alter von zwölf Jahren muß bereits mit fünf Prozent regelmäßigen Alkoholkonsumenten und sieben Prozent regelmäßigen Zigarettenrauchern gerechnet werden. Bei den illegalen Substanzen liegt Cannabis an der Spitze der Entwicklung; der Einstieg erfolgt meist im Alter um die 15 Jahre mit etwa vier Prozent regelmäßigen Nutzern pro Jahrgang. In den letzten Jahren haben auch Designerdrogen mit aufputschender und anregender Wirkung stark an Verbreitung gewonnen; sie erreichen im Alter von 15 Jahren eine Verbreitung von etwa vier Prozent regelmäßiger Nutzung.
Diese Ergebnisse aus Erhebungen und Analysen eines Forschungsteams unter Leitung von Professor Klaus Hurrelmann (Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld) zeigten, daß überwiegend psychische und soziale Motive für den Einstieg in den Drogenkonsum wirksam sind. "Dreh- und Angelpunkt" ist eine Einschränkung des Selbstwertgefühls. Der Hintergrund kann in gestörter Anerkennung in der Familie und in Konflikten mit den Eltern, in schulischen Leistungskrisen, Kontaktproblemen in der Gleichaltrigengruppe und gegenüber dem anderen Geschlecht und in einer unklaren Zukunftsperspektive liegen.
Vorbeugende Strategien müssen unmittelbar auf die soziale und psychische Ausgangslage der Konsumenten Rücksicht nehmen. In Zusammenarbeit mit Schulklassen in Dortmund und Bielefeld wurden von der Bielefelder Gruppe in den letzten Jahren Konzepte für den schulischen Bereich entwickelt. Durch eine betont sachliche Information über legale und illegale psychoaktive Substanzen, die altersangemessen aufgebaut wird, konnte bei den Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Jahrgänge kritisches Wissen über Drogen und Sucht aufgebaut werden. Sowohl gegenüber Tabak als auch gegenüber Alkohol konnte eine "mentale Distanz" gebildet werden: Die Schülerinnen und Schüler aus den zehn Schulklassen mit einem vorbeugenden Programm zeigten nach zwei Jahren deutlich höhere Ablehnungen des Konsums von Tabak und Alkohol als die Schülerinnen und Schüler aus den Vergleichsklassen, in denen kein Programm durchgeführt wurde.
Ein besonderes Problem für die vorbeugende Arbeit stellen nach den Bielefelder Studien diejenigen Jugendlichen dar, die schon häufig zu legalen und illegalen Drogen greifen. Diese Jugendlichen werden von schulischen Vorbeugeprogrammen nicht mehr angesprochen. In Zusammenarbeit mit mehreren Beratungseinrichtungen in Dortmund, Köln und Bielefeld wurde hierzu eine systematische Bestandsaufnahme vorgenommen. Ergebnis ist, daß auch die Jugendhilfe, Drogenhilfe und psychiatrische Kliniken nur schwer in der Lage sind, die unter 18-jährigen stark Drogengefährdeten zu erreichen. Die Untersuchungen zeigen zugleich, wie schnell es zu einer Verfestigung einer "Drogenkarriere" kommt, wenn nicht frühzeitige Hilfen einsetzen. Die Untersuchung schätzt, daß etwa fünf Prozent aller unter 18-Jährigen in deutschen Großstädten zu dieser Risikogruppe gehören.
Das Team unter der Leitung von Hurrelmann befragte Jugendliche aus dieser Risikogruppe an verschiedenen Szene-Orten in Köln, Dortmund und Bielefeld, die dafür bekannt sind, daß sich dort Drogen konsumierende Jugendliche aufhalten. Die Interviews mit über 165 Jugendlichen zeigen nicht nur einen hohen Zigaretten- und Alkoholkonsum, sondern auch einen gefährlichen Mix von psychoaktiven Arzneimitteln, Cannabis und LSD. "Die viel konsumierenden Jugendlichen haben oft sehr schlechte Beziehungen zu ihren Eltern und erleben zuhause Spannungen und Krisen, haben einen Freundeskreis, der selbst viele legale und illegale Drogen nimmt, schwänzen die Schule, haben schlechte Noten und meist auch ein geringes Selbstvertrauen. Viele von ihnen sind sozial und psychisch labil und ohne festen Halt. Die Straßenszene ist ihr eigentliches Zuhause, hier rutschen sie immer mehr in die Drogenszene hinein. Nur wenn durch sozialpädagogische Fachleute und Drogenhelfer in dieser Phase aufsuchende Beratung angeboten wird, können diese Jugendlichen noch aus einer Drogenkarriere aussteigen," so Hurrelmann.
Die 165 stark suchtgefährdeten Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahre glauben, über genügend Kenntnisse für einen kontrollierten Umgang mit Drogen zu verfügen. Niemand der Befragten nahm eine Drogenberatungsstelle in Anspruch. Nahezu 65 Prozent der suchtgefährdeten Jugendlichen bevorzugte bei Drogenproblemen Ratschläge und Hilfe eines Freundes oder einer Freundin. Professionelle Helferinnen oder Helfer wurden gemieden, aber immerhin 20 Prozent konsultierten einen Arzt.
"Diese Verhaltensweise unterstreicht, daß jugendliche Drogenkonsumenten eine enge Vertrauensbasis benötigen, um über ihre Drogenprobleme reden zu können. Dies spricht dafür, Ärztinnen und Ärzte stärker als bisher in die Beratung einzubeziehen." Professor Hurrelmann und sein Team fordern eine Kooperation von Schule, Gesundheitsamt, Kassenärztlicher Vereinigung, Jugendhilfe und Polizei: "Durch frühzeitiges Eingreifen kann bei suchtgefährdeten Jugendlichen die Entwicklung zu manifester Abhängigkeit unterbrochen werden. Dies würde eine Verringerung der Zahl chronischer Abhängigkeitserkrankungen nach sich ziehen und sich wiederum in einer Verringerung der finanziellen Belastungen für die Gesellschaft in Form sinkender Gesundheits-, Sozial- und Gerichtskosten äußern. So ließen sich beispielsweise Folgekosten durch stationäre Entwöhnungsbehandlungen reduzieren. Am besten wäre es, wenn in Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen regelmäßig Ärzte und Jugendfachleute Beratungen abhalten."
Quelle
Informationsdienst Wissenschaft (idw) Ein Projekt der Universitäten Bayreuth, Bochum und der
TU Clausthal
WWW: <http://idw-online.de/>
Kontaktadresse: service@idw-online.de
inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::